

Hier sind alle Beiträge zu aktuellen Themen aus dem Jahr 2022 gesammelt.
An diesen Beiträgen werden keine Veränderungen mehr vorgenommen, auch Links werden nicht mehr aktualisiert.
Beiträge aus vorangegangenen Jahren befinden sich im Archiv.

29.12.2022
In diesem Winter gab es bisher gerade mal 10 Tage, an denen Frost herrschte - vom 10. bis zum 19.12.. An diesen 10 Tagen gab es laut
Statistik
des Verkehrsministeriums 155 Flugbewegungen zwischen 23:00 und 0:00 Uhr, darunter 117 Starts, die fast ausschliesslich wegen "Safety-Gründen (Enteisung)" genehmigt wurden.
Um diese Tatsache zu bewerten, sind technische und rechtliche Aspekte zu betrachten. Wie meist, sind die technischen Aspekte komplex, aber relativ eindeutig, während die juristischen Interpretationsspielräume lassen.
Aus Sicherheitsgründen ist es notwendig, dass relevante Aussenflächen und Funktionselemente von Flugzeugen vor und während des Starts frei von Eis sind. Es liegt formal in der Verantwortung der Pilotin/des Piloten, sich vor dem Start davon zu überzeugen und ggf. eine Enteisung zu veranlassen. De facto schliessen die Airlines an allen grossen Flughäfen Serviceverträge mit Providern ab, die bei entsprechenden Wetterlagen die notwendigen Inspektionen vornehmen und geeignete Maßnahmen durchführen, um die Eisfreiheit bis zum Start zu gewährleisten. Am Frankfurter Flughafen gibt es dafür die Fraport-Tochter N*ICE, die auf ihrer Webseite und den bereitgestellten Dokumenten die wesentlichen Strukturen beschreibt.
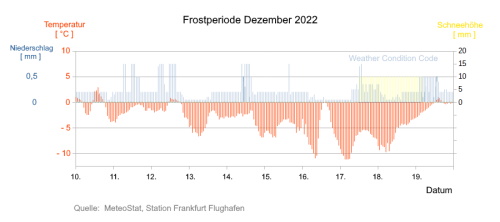
So war das Wetter im kurzen Winter 2022 (zum Vergrössern klicken) ...
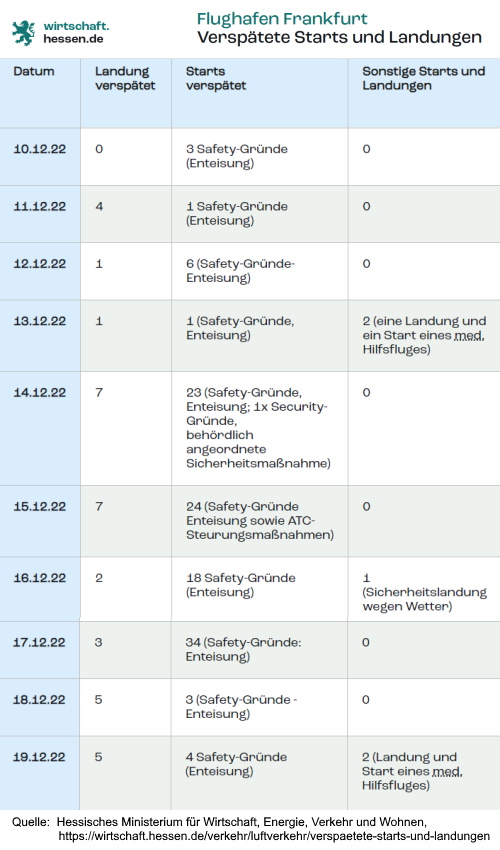
... und das waren die Folgen.
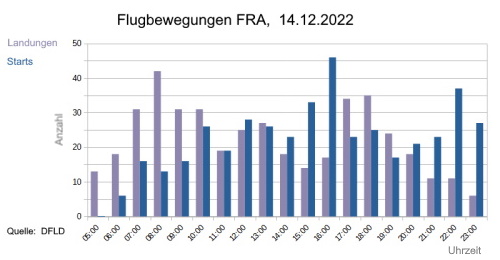
Und das sollen die Auswirkungen "erheblicher Flugplanverschiebungen" sein.
Nicht einfach zu beantworten ist die Frage, unter welchen Wetterbedingungen Enteisungen notwendig werden können. Die 'Sicherheits-Datenbank'
SKYbrary
beschreibt in einem eigenen
Artikel
ausführlich die Risiken von Vereisungen, gibt Empfehlungen zur Vermeidung und listet eine lange Liste von Unfällen auf, die auf unzureichende Maßnahmen zurückzuführen waren.
Daraus wird klar, dass die üblichen Wetter-Parameter alleine nicht ausreichen, um die Notwendigkeit zu beurteilen, und auch spezielle Parameter wie die Temperatur der Flugzeughülle eine Rolle spielen können. Daraus lässt sich ableiten, dass unter Frostbedingungen zumindest eine Inspektion der Flugzeuge bei der Startvorbereitung fest eingeplant werden muss und auch die etwa notwendige Zeit für eine Enteisung keine ungeplante Verzögerung darstellen kann. Sie gehören zum normalen Ablauf wie das Betanken des Flugzeugs oder das Verladen des Gepäcks.
Ein solcher Ablauf darf höchstens dann aus dem Takt kommen, wenn die Wetterbedingungen so komplex werden, dass die üblichen Vorbereitungen nicht ausreichen. So kann es z.B. vorkommen, dass Flugzeuge mehrfach enteist werden müssen, weil die sog 'Holdover Time', also die Zeit, in der die Enteisungs-Behandlung wirkt, überschritten wird. Dann ist eine zeitaufwändigere Nachbehandlung notwendig, die zu weiteren Verzögerungen führen kann. Wie eine
Detail-Betrachtung
der Wetterbedingungen zeigt, waren solche Situationen aber äusserst selten. Auf keinen Fall können damit die massiven Verspätungen am 15. und 16.12. erklärt werden.
Vielmehr ist es wohl so, dass Fraport selbst die Erklärung für die Verspätungen liefert in einer
Pressemitteilung
vom 16.12., in der es heisst:
"Vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Personalengpässe und aktuell hoher Krankenstände kommt es auch am Flughafen Frankfurt zu Personalunterdeckungen, insbesondere an den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabfertigung. ... „Zusätzlich zur angespannten Personalsituation haben wir auch im Winterflugplan und gerade vor den Weihnachtsferien am Flughafen ausgeprägte Aufkommensspitzen, d. h. Flüge sind ungleichmäßig über den Tag verteilt. ... Wenn dann noch die im Winter nicht unüblichen wetterbedingten Herausforderungen (Schneetage, Enteisung) hinzukommen, führt das, neben den betrieblichen Herausforderungen für den Flugbetrieb, auch zu einem höheren Passagieraufkommen in den Terminals (Umbuchungen, etc.) und zu erhöhten Wartezeiten an den Prozessstellen.“"
Damit ist klar gesagt, woran der Betrieb eigentlich hakt, und dass die Wetterbedingungen bestenfalls eine sekundäre Rolle spielen. Die eigentliche Ursache ist der
eindeutig selbstverschuldete
Personalmangel im Abfertigungsbereich. Wenn man der Ankündigung von N*ICE in ihrer
Preseason Information
glauben darf, sind Kapazitäten für die Enteisung technisch und personell ausreichend vorhanden. Eine
Pressemitteilung des BBI
weist ausserdem darauf hin, dass zwischen geplanter und tatsächlicher Abflugzeit in einigen Fällen Zeitspannen liegen, die keinesfalls mit mangelnden Kapazitäten bei der Enteisung erklärt werden können.
Hier kommen nun die juristischen Aspekte ins Spiel. Jeder einzelne Start nach 23:00 Uhr muss "durch die örtliche Luftaufsichtsstelle" erlaubt werden. Das zuständige Verkehrsministerium hat noch am 15.12. in einer
Pressemitteilung
erklärt, dass am 14.12. 23 Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden, wobei
"Voraussetzung ist, dass die Verspätungsgründe außerhalb des Einflussbereichs der jeweiligen Fluglinie liegen".
Zu den noch zahlreicheren Genehmigungen in den folgenden Tagen gab es nur nahezu wortgleiche Meldungen mit aktualisierten Zahlen
am 16.12.
und
am 18.12.,
aber keinen weitergehenden Kommentar mehr, nur eine Standard-Mail, die im Auftrag der Fluglärmschutzbeauftragten am 22.12. an die offenbar zahlreichen Beschwerdeführer:innen verschickt wurde. Darin wird zunächst die Problematik winterlicher Verkehrsbedingungen allgemein erläutert, ehe es dann zur Situation am Flughafen etwas konkreter heisst:
" Insbesondere seit dem Schneefall am Mittwoch, 14.12. ist es infolge von zusätzlichen wetterbedingten Verspätungen insgesamt zu erheblichen Flugplanverschiebungen gekommen. Der Schneefall hatte am 14.12. vormittags eine längere Nicht-Nutzung von verschiedenen Start- und Landebahnen in Frankfurt zur Folge, wodurch es zu Verspätungen kam. Der Anflug auf den Flughafen wurde dabei wetterbedingt durch die DFS reguliert (reduziert), d.h. Flüge nach Frankfurt wurden schon am Startflughafen verzögert bzw. verspätet. ... Zur Stabilisierung des Betriebs und zur Entlastung des Systems haben die Fluggesellschaften in Frankfurt bereits seit dem 14.12. täglich eine 3-stellige Anzahl Flugbewegungen annulliert."
Ansonsten wird nur noch darauf hingewiesen, dass die Bedingungen am 19.12. besonders problematisch waren - allerdings ohne eine Erklärung, warum da nur 4 Ausnahmegenehmigungen notwendig waren, während am 15. und 16. bei ruhigem Wetter 24 bzw 18 erteilt wurden.
Auch die Ausführungen zum 14.12. sind nicht nachvollziehbar.
"Längere Nicht-Nutzung von verschiedenen Start- und Landebahnen"
gab es an diesem Tag nicht, lediglich die Landebahn Nordwest wurde von ca. 13:00 bis 16:00 Uhr nicht genutzt, aber das dürfte eher Folge, nicht Ursache der relativ geringen Zahl von Landungen in diesem Zeitraum gewesen sein. Alle anderen Bahnen waren durchgehend in Betrieb, wenn auch mit unterschiedlichen Auslastungen.
Auch das Tagesmuster von Starts und Landungen sieht nicht ungewöhnlich aus. Selbst wenn der Peak von Landungen zwischen 17:00 und 19:00 Uhr auf Maßnahmen der DFS zurückzuführen sein sollte und sonst früher gelegen hätte, sollte das in einem normalen Ablauf nicht zu Staus bei Starts ab 22:00 Uhr führen. Enteisungen dauern 20 bis 30 Minuten, keine 3 Stunden, und die Gesamtzahl der Flugbewegungen (850) lag deutlich niedriger als die von Fraport und N*ICE behauptete Kapazität.
Dass die Startzahlen ab 17:00 Uhr (nach Ende der Niederschläge) niedrig liegen und sehr viel langsamer wieder hochlaufen als nach 14:00 Uhr, deutet auf andere Gründe hin, die nichts mit dem Wetter zu tun haben.
Und wenn diese Wetter-Erklärungen schon für den 14.12. nicht plausibel sind, wären sie für den 15. und 16.12. bei ruhigem, niederschlagsfreiem Winterwetter völlig absurd. Hier spielen wohl erst recht
"Personalunterdeckungen, insbesondere an den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabfertigung"
die entscheidende Rolle.
Wenn aber die Verzögerungen nicht einzig und allein auf das Wetter zurückzuführen sind, dann greift die Aussage aus dem
Planfeststellungsbeschluss
(A II Ziffer 6 PFB):
"Im Übrigen darf die Genehmigungsbehörde Ausnahmen von den betrieblichen Einschränkungen nur in Fällen besonderer Härte zulassen. Kein Fall besonderer Härte liegt vor, wenn durch die Betriebseinschränkung die Flugzeugumlaufplanung des Luftverkehrsunternehmens erschwert oder Maßnahmen des Passagiertransfers bzw. der Passagierunterbringung erforderlich werden."
Mit anderen Worten: allein die Tatsache, dass ein Flieger am geplanten Tag nicht mehr starten kann, ist kein Grund, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Von einem Rechtsanspruch auf eine solche Genehmigung ist ohnehin nirgendwo die Rede.
Den Ansprüchen der 'Luftverkehrsunternehmen' stehen die Auflagen aus §29b Luftverkehrsgesetz entgegen, wo es heisst:
"(1) Flugplatzunternehmer, Luftfahrzeughalter und Luftfahrzeugführer sind verpflichtet, beim Betrieb von Luftfahrzeugen in der Luft und am Boden vermeidbare Geräusche zu verhindern und die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu beschränken, wenn dies erforderlich ist, um die Bevölkerung vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Lärm zu schützen.
Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen.
(2) Die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisation haben auf den Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken."
Auf die Bedeutung dieser gesetzlichen Regelung insbesondere für den Schutz der "Kernnacht" von 23:00 - 5:00 Uhr hat auch das Bundesverwaltungsgericht hingewiesen, als es den Versuch der hessischen Landesregierung, die in der Mediation vereinbarten Nachtflugbeschränkungen wieder aufzuweichen, zurückgewiesen hat. Dies darf man als rechtlichen Hinweis darauf lesen, dass an die Rechtfertigung solcher Ausnahmegenehmigungen besonders hohe Anforderungen zu stellen sind.
Eine Aufsichtsbehörde, die zwischen den Profitinteressen der Fluggesellschaften, den Transportinteressen der Flugpassagiere und den Interessen der Flughafenanrainer auf Schutz vor besonders gesundheitsschädlichem Nachtlärm nach Recht und Gesetz abwägt, hätte also diese Genehmigungen in den vorliegenden Fällen nicht erteilen dürfen. Eine solche Behörde gibt es aber in Hessen leider nicht.
Was es gibt, ist eine Kumpanei zwischen Verkehrsministerium und dem Flughafenbetreiber Fraport, die dafür sorgt, dass das Management-Versagen und die unsoziale Politik der Fraport-Bosse nicht bestraft werden. Stattdessen ziehen sie gemeinsam eine miese Show ab, die den Betroffenen vorgaukeln soll, dass das alles nach Recht und Gesetz und im öffentlichen Interesse so ablaufen muss und sie die Folgen hinzunehmen haben.
Dieses Vorgehen
hat Tradition,
und auch diesmal wird die Bevölkerung perverser Weise noch mit dem Lärm völlig unnötig mitten in der Nacht startender Kurzstreckenflüge (insgesamt 25, davon 14 der Lufthansa) gequält. Was fehlt, ist das Geschrei nach offizieller weiterer Aufweichung der Nachtflugbeschränkungen. Dafür ist das Image der Beteiligten aktuell wohl doch nicht gut genug.

Dass der Fluglärm in Raunheim zeitweise unerträglich ist, hat Thomas Jühe immer wieder in Wort und Bild deutlich gemacht.
15.12.2022
Ende 1999 war Bürgermeister-Wahl in Raunheim. Die CDU sah mit einem lokal bekannten Kandidaten erstmals seit Jahrzehnten eine Chance, das Amt zu übernehmen. Die personell ausgezehrte Raunheimer SPD hatte einen jungen, in Raunheim bis dahin weitgehend unbekannten Lehrer aus Dreieich als Kandidaten geholt. Er gewann die Wahl denkbar knapp.
Zunächst konnte er das Amt nicht antreten, weil ein medizinischer Befund auf eine schwere Krankheit hindeutete. Damals erwies sich die Diagnose als falsch, und im Mai 2000 konnte er eine erfolgreiche politische Karriere beginnen, die nun nach 22 Jahren durch eine wirkliche Krankheit jäh beendet wurde. Am 12.12.2022 ist Thomas Jühe, bis Ende November Bürgermeister und seither Ehrenbürgermeister von Raunheim, verstorben.
Ebenfalls Ende der Neunziger Jahre haben sich Raunheimer Bürger:innen im Rahmen des damaligen ersten Stadtleitbild-Prozesses wieder organisiert mit den Belastungen durch den Frankfurter Flughafen auseinandergesetzt. Das dort erarbeitete Kapitel "Raunheim und der Flughafen Frankfurt" wurde zum Gründungsdokument der "Bürgerinitiative gegen Fluglärm Raunheim", die sich damit gegen das Ergebnis der sog. "Mediation" zum Flughafen-Ausbau wandte, das im Januar 2000 verkündet wurde.
Mit dem Amtsantritt von Thomas Jühe begann eine Zusammenarbeit, die nicht immer konfliktfrei, aber stets produktiv und kollegial war und über Höhen und Tiefen gehalten hat, bis sie durch seine Krankheit beendet wurde. Obgleich er von Beginn an als Bürgermeister eine Menge Baustellen zu bearbeiten hatte, war das Thema 'Fluglärm' von Anfang an ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit, und er wandte in den ersten Jahren sehr viel Zeit auf, um die Kommune in den juristischen Auseinandersetzungen um den Flughafenausbau gut zu positionieren. Dabei war seine Herangehensweise immer die eines politischen Beamten. Er versuchte, die Möglichkeiten, die die bestehenden Rahmenbedingungen boten, maximal im Interessen seiner Kommune zu nutzen. Wo diese Rahmenbedingungen unzureichend waren, versuchte er, die politischen Entscheidungsträger so mit Sachargumenten zu bombardieren, dass sie zu positiven Veränderungen gezwungen wurden.

Thomas Jühe am Infostand der BI beim Bahnhofstrassenfest ...

... bei einer Aktion vor dem Berliner Reichstag ...

... und beim Erklären der Flugrouten-Problematik.
So entstanden zunächst das
Fluglärm-Entlastungskonzept Raunheim 2002
und dessen
Fortschreibung 2006,
womit die Fluglärm-Belastung in Raunheim und Möglichkeiten zu ihrer Reduzierung gründlich fachlich belegt wurden. Ausserdem wurde ab 2001 eine ausführliche Dokumentation der
Wirbelschleppen-Schäden im Stadtgebiet begonnen.
Beide Aktivitäten blieben nicht ohne Wirkung, dennoch war der Umgang von Politik und Justiz mit den vorgelegten Fakten auch für Thomas Jühe desillusionierend. Insbesondere die Tatsache, dass auch die Dokumentation von über 100 Wirbelschleppen-Schadensfällen in Raunheim nicht genügte, um ein Fraport-Gutachten, dass die Möglichkeit solcher Schäden leugnete, im Verfahren um den Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens
zu widerlegen,
machte ihm die Begrenztheit solcher juristischer Vorgehensweisen deutlich.
Seine Schlussfolgerung war, dass es umso wichtiger sei, im System von innen heraus alle Möglichkeiten zu nutzen, um Verbesserungen durchzusetzen. Schon 2003 wurde er Vorsitzender sowohl der Frankfurter Fluglärmkommission als auch der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen und hat wesentlich zur Professionalisierung und Effektivierung dieser Gremien beigetragen. Auch die Nachfolge-Organisationen des sog. 'Regionalen Dialogforums' zum Flughafen-Ausbau, insbesondere das 'Forum Flughafen und Region' und das 'Expertengremium Aktiver Schallschutz' versuchte er zu nutzen, um die identifizierten Möglichkeiten zum besseren Schallschutz und die Entwicklung neuer Möglichkeiten dafür durchzusetzen.
Die Erfolge waren auch hier begrenzt. Zwar wurde insbesondere die Fluglärmkommission ein wesentlich kritischeres Gremium und hat mit fachlichen Inputs und kritischen Stellungnahmen Landesregierung, DFS und Fraport etliches abgefordert und die Entwicklung des Flugbetriebs im Rhein-Main-Gebiet im Sinne des Lärmschutzes positiv beeinflusst, aber letztendlich die weitere Ausbreitung und Zunahme des Fluglärms nicht aufhalten können.
Aber gerade weil Thomas Jühe die Begrenztheit der Wirkung fachlicher Argumentationen sehr klar gesehen hat, hat er sich immer darum bemüht, andere dabei zu unterstützen, ihre Interessen an einem Schutz vor Lärm und an einer gesunden Umwelt zu vertreten und dafür Druck auf die Luftverkehrswirtschaft und ihre politischen Vertreter auszuüben. Deshalb konnte die BI selbst dann auf seine Unterstützung zählen, wenn sie die Arbeit der Gremien, in denen er aktiv war, kritisiert hat.
In dem Maße, in dem der öffentliche Druck nachgelassen oder sich in illusionäre Forderungen verrannt hat, wurde es auch für ihn schwieriger, in den Gremien Erfolge zu erzielen. Ohnehin war von Anfang an eine der Hauptaufgaben, die mit dem geplanten Ausbau drohenden Verschlimmerungen soweit wie möglich abzuwenden. Dies wurde besonders deutlich in der Frage der künftig geplanten Flugrouten.
Mit dem Bau der Nordwestbahn und dem dadurch bedingten weitgehenden Wegfall der Nordabflüge vom Parallelbahnsystem drohte der Teil der Abflüge, der nicht über die Startbahn West abgewickelt werden kann, bei Betriebsrichtung 25 direkt über Raunheim geführt zu werden. Damit wäre das Stadtgebiet ganzjährig durch Überflüge in einer unerträglichen Weise verlärmt worden. Mit der Konzeption und Durchsetzung der unmittelbar nach dem Start nach Süden abdrehenden Abflugroute konnte diese Katastrophe weitgehend abgewendet werden.
Thomas Jühe war daran in einer Weise beteiligt, dass er von den Medien zum
Vater der Südumfliegung
ernannt wurde. Wer künftig in Raunheim Politik machen will, wird dieses Vermächtnis mit Nachdruck verteidigen müssen, denn dauerhaft gesichert ist in diesem Bereich fast nichts.
Wo Thomas Aufgaben und Möglichkeiten zur Fluglärm-Bekämpfung für die Zukunft gesehen hat, wird vielleicht am ehestens deutlich in zwei Papieren, die er in letzter Zeit verfasst bzw. mit verfasst hat: einer
Denkschrift zum Flugverkehr
nach der Corona-Krise und den
ADF-Forderungen zur Bundestagswahl 2021. Was davon künftig umgesetzt werden kann, ist offen.
Man kann nur hoffen, dass viele so denken wie die langjährige Geschäftsführerin der ADF und der FLK Frankfurt, Anja Wollert, die
erklärte
„Wir alle sind sehr traurig und tief betroffen über den viel zu frühen Verlust. Gleichzeitig sind wir unendlich dankbar für den gemeinsam zurückgelegten Weg, die erreichten Erfolge und auch den Umgang mit (noch) nicht erreichten Zielen. Mit Mut, Entschlossenheit und Beharrlichkeit werden wir auch künftig versuchen, eine Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm zu bewirken. Das couragierte und verantwortungsvolle Wirken von Thomas Jühe wird uns dabei immer Vorbild sein.“
Auch die BI wird sich bemühen, in diesem Sinne weiter zu arbeiten.

Privatjets emittieren besonders viel klimaschädliche Substanzen, und das überwiegend für gesellschaftlich schädliche oder sogar
eindeutig kriminelle
Aktivitäten.
(Hintergrundgrafik: Illustration von Matt Rota für
ProPublica
und
ICIJ.)
05.12.2022
... und das gleich in den unterschiedlichsten Formaten:
G7,
G20,
G195 alias
COP27,
und auch in der
ICAO-A41.
Manchmal wurde es dabei sogar lyrisch: UN-Generalsekretär Guterres
sagte zur Eröffnung
der COP:
"We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator"
("Wir sind auf der Schnellstrasse in die Klima-Hölle, mit dem Fuss immer noch auf dem Gaspedal").
Gerüchteweise spielte er damit an auf einen
AC/DC-Hit,
in dem es frei übersetzt heisst:
"Keine Stopp-Schilder, kein Tempolimit, nichts bremst mich ... ich bin auf der Schnellstrasse zur Hölle".
Das kann man als pointierte Zusammenfassung der Berichte
des Weltklimarates IPCC,
des UN-Umweltprogramms UNEP,
der Internationalen Energieagentur IEA
und der
Welt-Meteorologie-Organisation WMO
betrachten, die allesamt aussagen, dass die Welt das 1,5°C-Ziel des Pariser Klima-Abkommens deutlich verfehlen wird, wenn nicht umgehend drastischste Maßnahmen ergriffen werden. Das
globale Kohlenstoff-Budget,
d.h. die Menge an Kohlendioxid, die noch emittiert werden darf, um z.B. das 1,5°C-Ziel mit einer Chance von 2:1 noch einhalten zu können, ist beim gegenwärtigen Emissionsniveau
bereits 2030 erschöpft.
Das Überschreiten
mehrerer Klima-Kipppunkte
wird damit immer wahrscheinlicher.
Der deutschen Bundesregierung war das Guterres-Bild zu negativ. Der Bundeskanzler hat in der COP auch als amtierender G7-Präsident für seinen
Klimaclub geworben,
um
"beim klimaneutralen Umbau unserer Volkswirtschaften und unserer Industrie"
voranzukommen. Ein solches Vorankommen wäre dringend notwendig, da Deutschland an der 'Schnellstraße zur Hölle'
eifrig mitbetoniert
und seine ohnehin unzureichenden Klimaziele
deutlich verfehlen
wird, ebenso wie die
Wirtschaft der G7
und
der G20
insgesamt. Die Resonanz war jedoch eher verhalten, denn wie das in exklusiven Clubs eben so ist: mitspielen darf nur, wer sich Spielgerät und Beitrag leisten kann. Alle anderen dürfen bestenfalls von der Seitenlinie zugucken, selbst wenn auf dem Feld mit ihren Lebensgrundlagen gespielt wird - und das gefällt vielen garnicht.
Derzeit sind die potentiellen Klubmitglieder auch hauptsächlich damit beschäftigt, einen
klimaschädlichen Erdgas-Boom
zu initiieren, wobei Deutschland u.a. mit der
Senegal-Connection
eine führende Rolle spielt. Damit gefährdet Deutschland auch die notwendige
Energiewende in Afrika,
wovor die Internationale Energieagentur
ausdrücklich warnt:
"Neue langfristige Gasprojekte riskieren, ihre Investitionskosten nicht wieder hereinholen zu können, wenn es der Welt gelingt, die Gasnachfrage in Übereinstimmung mit der Erreichung von Netto-Null-Emissionen Mitte des Jahrhunderts zu senken"
(eigene Übersetzung).
Ausserdem hat der Kanzler einen
globalen Schutzschirm
angekündigt, der
"mehr und schnellere finanzielle Hilfen für Länder des globalen Südens"
mobilisieren soll,
"wenn sie durch den Klimawandel Schäden erleiden",
allerdings schon vorab
als Knirps
verspottet wurde. Verglichen mit den
Schäden,
die die
Gruppe der verletzlichsten Länder
bereits für die letzten Jahre
bilanziert
haben (über 500 Mrd. Euro), sind die zugesagten 170 Mill. Euro allerdings noch weniger als ein "Tropfen auf den heissen Stein".
Seine Entwicklungs-Ministerin versuchte, diese Aktivitäten als eine Brücke zu den Entwicklungsländern
zu beschreiben,
eine
Bridge over troubled water.
Ihre Botschaft lautete also, ebenfalls frei übersetzt:
"Wenn Du auf dem Weg in den Untergang bist, werde ich bei Dir sein und Dich trösten".
Tags drauf
ermunterte sie
die afrikanischen Länder auch noch,
"die Finsternis nicht zu fürchten ... [und] durch Stürme und Regen zu gehen, auch wenn deine Träume zerblasen werden":
You'll never walk alone.
Zynismus, Dummheit oder ein ungewohnter Anflug von Systemkritik? Wahrscheinlich hatte die Ministerin einfach nur die Songtexte nicht präsent, und ihre Bilder beschreiben die von den Maßnahmen der Bundesregierung eröffneten Perspektiven ganz ungewollt treffend. Denn Deutschland wird sein
nationales Kohlenstoff-Budget,
das nach dem einschlägigen
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
praktisch Verfassungsrang hat, noch schneller überziehen als andere und trägt damit dazu bei, die Welt auf einen Kurs einer Erwärmung von 2°C oder mehr zu schicken.
Natürlich war die COP auch wieder Ziel hunderter offener und verdeckter
Lobbyisten der fossilen Industrien,
darunter auch der Luftfahrtindustrie, während Vertreter:innen der Hauptbetroffenen und Klimaaktivist:innen in der Regie
des ägyptischen Auslandsgeheimdienstes
ausgeschlossen,
überwacht
und
an den Rand gedrängt
wurden.
Unter anderem hat es sich die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation ICAO, eigentlich eine UN-Unterorganisation, aber in ihrem Handeln nicht von einer Industrie-Lobbyvertretung zu unterscheiden, nicht nehmen lassen, ihre nur wenige Wochen vorher gefassten
Beschlüsse zu Umweltthemen,
darunter insbesondere ihr neues
langfristig anzustrebendes Ziel (long term aspirational goal, LTAG)
zu präsentieren.
Viel Beifall gab es dafür bisher nicht. Schon die Generalversammlung selbst wurde
von Protesten begleitet.
Gewerkschaften verlangten
ein deutlicheres Bekenntnis zu
"einem gerechten Übergang zu einer kohlenstofffreien Zukunft, ... die Dekarbonisierung der Luftverkehrsbranche auf sozialverträgliche Weise, ... einen qualitativ hochwertigen sozialen Dialog, Investitionen in die Ausbildung und die Erstellung branchenspezifischer Maßnahmenpläne".
In Bezug auf das einzig derzeit angewendete 'Klimaschutz-Instrument' der Luftfahrt, das
Kompensations-System CORSIA,
liefert eine
Analyse der Auswirkungen
der ICAO-Beschlüsse ein vernichtendes Ergebnis: damit würden
"magere 22% der gesamten internationalen Emissionen im Jahr 2030 kompensiert" (eigene Übersetzung).
Für das neue 'langfristige Ziel' gab es zwar freundliche Worte, u.a. von einer
NGO-Koalition
und dem progressiven Think Tank
ICCT,
aber nur, weil damit eingestanden wird, dass die bisher propagierten Ziele, und damit auch die dafür vorgesehenen Maßnahmen, völlig unzureichend sind. Der ICCT hat auch gleich
Szenarien
vorgelegt, die zeigen, was passieren müsste, damit die Luftfahrt wenigstens mit einem Ziel einer globalen Temperatur-Erhöhung
"deutlich unter 2°C"
kompatibel bleiben könnte. Warum die ICAO-Szenarien das nicht leisten können, erläutert ein
Fact Sheet
des Netzwerks 'Stay grounded'.
Was aber aktuell wirklich passiert, beschreibt ein
Beitrag der Tagesschau:
"Um rund ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr sind die globalen Kohlendioxid-Emissionen in 2022 gestiegen, ... der zweithöchste Zuwachs der Geschichte."
und
"Dass die Emissionen steigen, hat in diesem Jahr vor allem einen Grund: Der internationale Flugverkehr hat nach der Pandemie wieder kräftig angezogen".
Konsequenter Weise sprengen die
Gewinne der Energiekonzerne
alle Grenzen.
Wer sich die Ergebnisse der COP27 ganz prosaisch ansehen will, findet sie in leicht verständlicher Form in einem
Tagesschau-Beitrag,
etwas ausführlicher in einem
klimareporter°-Artikel,
mit sehr vielen Details (und in englisch)
bei CarbonBrief
oder als
Insider-Bericht.
Gewerkschaftsvertreter
sehen die Ergebnisse
"zwiespältig",
beklagen
"die Verwässerung der Verpflichtungen gegenüber den Beschäftigten und deren zunehmende Ausgrenzung"
und fordern
"einen gerechten Übergang für die Arbeitnehmenden im Einklang mit dem Pariser Abkommen ... , um den Bedürfnissen der Beschäftigten und den Bedürfnissen des globalen Südens in vollem Umfang gerecht zu werden".
Der
Abschlussbericht
enthält viele wohlklingende Formulierungen, aber da kommt es eher darauf an, was
nicht drin steht:
"Das Arbeitsprogramm zur Emissionsreduktion ist ein Witz. Es gibt keine Jahresziele, und auch Ziele für die einzelnen Sektoren haben es nicht ins Programm geschafft. ... [Es] verbietet sogar eine Verschärfung der Klimaziele. ... Der Ausstieg aus den fossilen Energien hat es wieder mal nicht in den Abschlussbericht geschafft".
Zu ergänzen wäre: auch die
militärischen Emissionen
werden nach wie vor kaum erfasst. Bestrebungen, das zu ändern, werden
auch in der EU abgeblockt. Immerhin war es während dieser COP erstmals möglich, das Thema in einem
Blue Zone Side Event
zum Krieg in der Ukraine zu diskutieren.
Auch in Wissenschaftskreisen herrscht überwiegend Frust und Enttäuschung. Die Spitzen der deutschen Klimaforschung urteilen: Ergebnisse sind nicht gut genug und beklagen "Die Welt muss ihre Emissionen innerhalb von sieben Jahren um 50 % senken - und in Sharm haben wir immer noch darüber gestritten, ob wir aus der Kohle aussteigen oder nicht, und waren nicht einmal bereit, über fossile Brennstoffe zu sprechen. Die Diskrepanz könnte nicht größer sein". Weitere Stimmen zu den Ergebnissen der COP hat das Science Media Center zusammengestellt.
Video: Aktionen von 'Scientist Rebellion' und 'Extinction Rebellion' gegen Privatjets.
Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. Während einige auf
neue Foren hoffen, mit denen Taten auf den Weg gebracht werden können, gehen andere dazu über,
Extrem-Szenarien
zu untersuchen, deren Eintreten zunehmend wahrscheinlicher wird.
Die konsequentesten Klimaforscher:innen haben schon vor dieser Konferenz
festgestellt,
dass es keinen plausiblen Weg zur Erreichung des 1,5°C-Ziels mehr gibt, und
wurden aktiv,
indem sie im Rahmen der Kampagne
Make them pay
elf internationale Privat-Flughäfen bzw. -Terminals
blockierten.
Dabei ist es natürlich kein Zufall, dass sie sich Privatjets als Ziel ausgesucht haben. Privatjets sind die Basis des sog.
Geschäftsflugverkehrs, stossen
überproportional viel
Treibhausgase aus und dienen überwiegend dem
Luxuskonsum der Superreichen,
die durch ihren Lebensstil, aber insbesondere
durch ihre Investitionen
die Klima-Katastrophe anheizen. Passender Weise gab es aktuell auch
Enthüllungen,
die zeigen, dass zu diesen Superreichen auch ein relevanter Teil dessen gehört, was auch offiziell als
organisierte Kriminalität
bezeichnet wird.
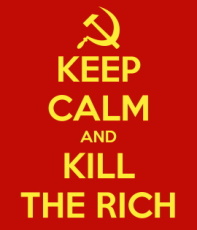
Linksextremistische Unterwanderung droht ...
Und obwohl diese besonders obszöne Zurschaustellung von Reichtum und Arroganz sogar auf EU-Ebene zu
Verbots-Diskussionen
geführt hat, reagierten staatliche Institutionen mit absurder Härte auf die Aktionen, und es kam, wie schon bei Straßenblockaden der
Letzten Generation,
zu Arresten und
rechtswidriger Präventivhaft.
Als dann aber auch noch mit einer
weiteren Aktion
der allgemeine Flugbetrieb in Berlin kurzzeitig gestört wurde, rasteten Politiker:innen
von AfD bis zu den Grünen
vollständig aus
und versuchten diese Art von Aktionen
zu kriminalisieren.
Dies änderte sich auch nicht, nachdem klar war, dass durch die Aktion
niemand gefährdet wurde:
"Menschen seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, weil die Klimademonstranten die Start- und Landebahn nicht betreten haben und weit weg vom Terminal demonstriert hätten", erklärte ein Flughafensprecher. Trotzdem wird die Aktion zum Anlass genommen, öffentlich nach
neuen Strafverschärfungen
zu schreien. Weil das derzeit aber wohl noch nicht als durchsetzbar gilt, bleibt es vorläufig bei
Einschüchterungs-Versuchen.
Dabei faseln 'Sicherheitsbehörden' von
"Linksextremisten",
die versuchten,
"Fridays For Future und die Letzte Generation zu unterwandern und aus der Klimakrise eine Systemkrise zu machen".
Eine perverse Aussage, denn alle wissen, dass die Klimakrise eine Systemkrise ist: der Slogan
"System change, not climate change"
ist seit Jahren eine Kernaussage der Bewegungen für Klimagerechtigkeit. Das aber darf offiziell natürlich nicht wahr sein.
Stimmen aus der Wissenschaft
kommen daher auch zu ganz anderen Einschätzungen und stellen u.a. auch die Relationen wieder her:
"Zum anderen sind auch die aktuellen Protestformen der Letzten Generation nur sehr begrenzte Regelüberschreitungen, bei denen es maximal zu Sachbeschädigungen in einem geringen Rahmen kommt. Angriffe auf Personen finden nicht statt. Das Gewaltniveau und vermutlich auch die Summe der Sachschäden jedes Fußballbundesliga-Samstages dürften deutlich höher liegen".
Was bleibt als Fazit ? Die
Zeitenwende
hat dazu geführt, dass vieles, was vor einem Jahr noch als selbstverständlich galt, heute nicht mehr wahr sein soll. Der Kampf gegen das weitere Wachstum der Treibhausgas-Emissionen wird geopolitischen Machtspielen untergeordnet, Widerstand dagegen wird kriminalisiert. Milliarden Euro werden in Aufrüstung und den Ausbau fossiler Infrastrukturen investiert, während Verkehrs- und Energie-Wende nicht vorankommen. Die Aussichten, die Klimakatastrophe noch irgendwie einzudämmen, werden immer trüber.
Das Wachstum des Luftverkehrs ist nach wie vor sakrosankt, und wer ernsthaft versucht, das zu behindern, bekommt die volle Härte der Staatsmacht zu spüren. Wer in dieser Situation weiter gegen die negativen Folgen des Flugverkehrs vorgehen will, wird die
Erfahrungen
berücksichtigen müssen, die in der Bewegung gegen die Startbahn West, in der Anti-AKW-Bewegung und in vielen anderen Bewegungen gemacht wurden. Es gibt unterschiedliche Formen des Widerstands, von gutbürgerlich bis radikal. Solange sie gewaltfrei bleiben, müssen alle diese Formen in einer Bewegung, die erfolgreich sein will, ihren Platz haben. Versuche der Spaltung und der Kriminalisierung
zivilen Ungehorsams
müssen zurückgewiesen werden.
Es spricht nichts dagegen, es deutlich zu sagen, wenn man es bescheuert findet, Kunstwerke mit Essen zu bewerfen. Gleichzeitig muss aber deutlich werden, dass die politischen Gegner diejenigen sind, die wegen solcher Aktionen von "extremistischer Unterwanderung" und der Bildung einer "Klima-RAF" schwätzen und damit von ihrem Versagen bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe ablenken wollen. Die wahren Extremisten, die diese Gesellschaft zu zerstören drohen, kleben nicht auf Rollwegen oder Strassen - sie sitzen in Konzern-Zentralen.

Bild und Planskizze (letztere für bessere Vergleichbarkeit der Dimensionen nicht perspektivisch verkürzt) der zusammenhängenden Terminals 1 und 2
20.11.2022
Eine eigene Pressemeldung war es der Fraport nicht wert, aber im Rahmen der Präsentation der
Fraport-Quartalsmitteilung Q3/9M 2022
gab es in der
Roadshow
für Investoren einen kurzen Hinweis im "Outlook" (Folie 82):
"Temporary Closure of FRA T2"
("Vorübergehende Schliessung von FRA T2").
Das Fachblatt
aero.de
berichtet am 14.11. unter der Überschrift
Das T2 hat 2026 vorerst ausgedient
über die Aussagen von Fraports oberstem Finanzmenschen, CFO Prof. Zieschang, dazu:
„Fraport will das Terminal 2 laut Zieschang als "Backup-Terminal" erhalten, vorerst aber nicht modernisieren. ... "Da ist die nächsten Jahre nichts geplant", dementierte Zieschang. "Wir haben es, wie es ist und nur auf sehr lange Sicht könnte es sein, dass wir Geld (ins T2, Red.) investieren."“
Einen Tag später ist das aber schon nicht mehr wahr, und aero.de berichtet, was auch die Frankfurter Rundschau schon am 15.11. mitzuteilen hatte, aber am 18.11. auch noch mal
korrigiert
hat:
Das T2 geht 2026 vorerst vom Netz.
Die Fraport-offizielle Aussage ist nun:
"Wir werden die zusätzliche Kapazität mit der Inbetriebnahme vom Terminal 3 nutzen, um ab 2026 eine umfassende technische Modernisierung von Terminal 2 durchzuführen".
Dazu werde nach der letzten Rundschau-Version
"die Passagierabfertigung ab 2026 für zwei bis drei Jahre geschlossen, während Tiefgarage, Sky Line-Bahn und Gepäckanlage weiterlaufen sollen. Auch die Flugzeugparkplätze am Terminal 2 sollen weiter genutzt werden",
aber
"die bislang im Terminal 2 beheimateten Airlines müssten im Laufe des Jahres 2026 in die neuen Gebäude im Süden des Flughafens in Frankfurt umziehen. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Terminal 2 aber ... vollständig ans Netz genommen werden".
Andere Blätter wie z.B. der
aerotelegraph
haben das wieder etwas anders verstanden, sprechen weiter vom
"Reserve-Terminal"
und zitieren Fraport so:
"Mindestens drei Jahre lang wird aber das Gebäude nicht mehr in Betrieb sein. ... In den kommenden Jahren werde man nicht mehr zusätzlich in das Gebäude investieren, ... aber ... ab 2026 eine umfassende technische Modernisierung vornehmen"
Wie ist dieses Informationschaos zu bewerten? Haben die bei der Präsentation anwesenden Reporter einfach nicht genau hingehört, oder hat Herr Zieschang, ganz Finanzmensch, bei der Pressekonferenz wirtschaftlich Klartext geredet und musste sich anschliessend von Schulte & Co. wieder kommunikations-strategisch einnorden lassen?
Der BUND Hessen hat jedenfalls den ersten Aero-Bericht zum Anlass für einen
Kommentar
genommen, in dem es heisst:
"Einmal mehr zeigt sich, dass der Ausbau des Frankfurter Flughafens eine riesige Fehlplanung darstellt. Der Flughafen benötigt keine drei Terminals. Die Schließung von Terminal 2 bei Eröffnung des Terminals 3 belegt, dass die Ausbaukapazität auf Kosten des Bannwalds völlig überschätzt wurde. In Folge des Klimawandels ist Wachstumsglaube für die Luftfahrt nicht mehr zeitgemäß. Es ist vorhersehbar, dass Terminal 2 nie mehr geöffnet wird".
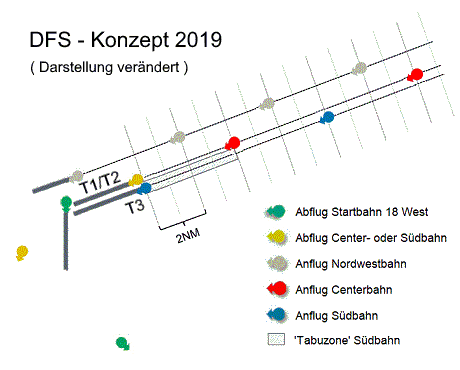
So uhrwerk-artig möchte die DFS die Abläufe künftig gestalten ...
(Quelle: FLK-Präsentation der DFS)

... aber das geht nicht ohne genug Betrieb in Terminal 3.
(Quelle: Wikimedia, verändert)
Wenn man spekulieren möchte, was Fraport tatsächlich vorhat, lohnt erstmal ein Blick auf die bekannten Fakten, zunächst über Terminal 2.
Der 1994 eröffnete Glaspalast prägt zwar das Erscheinungsbild des Flughafens von aussen, ist aber insgesamt von geringerer Bedeutung. Vor dem Pandemie-Einbruch wurden nur rund 20% des Betriebs darüber abgewickelt, während der Pandemie wurde es komplett dichtgemacht. Es gilt als architektonisch bedeutsam, aber betrieblich in vielerlei Hinsicht ineffizient und wurde in den 28 Jahren seines Bestehens relativ wenig modernisiert. 2019 hat sich Fraport eine
Machbarkeitsstudie
für die weitere Nutzung von T2 erstellen lassen, aber was da drin steht, ist nicht bekannt. Die Absicht, es für eine grundlegende Modernisierung zu schliessen, solange der Betrieb noch hochläuft und genügend andere Kapazitäten vorhanden sind, klingt aber zunächst durchaus plausibel.
Auf der anderen Seite soll Terminal 3 schon bei Eröffnung deutlich mehr Kapazität bieten, als Terminal 2 je haben könnte, und das auf aktuellem technischen Stand. Ausserdem ist eine Erweiterung um einen vierten 'Finger' in der Planung ja schon vorgesehen, und damit würde die Kapazität gegenüber Terminal 2 fast verdoppelt. Derzeit redet Fraport zwar von diesem letzten Ausbau-Schritt nicht mehr und gibt die T3-Kapazität mit 19 statt mit 25 Millionen Passagieren im Jahr an, aber völlig vom Tisch sind die Planungen deshalb natürlich nicht. Damit bieten sich unterschiedliche Optionen, über die heute noch nicht entschieden werden muss.
Primäres Interesse von Fraport ist natürlich, Terminal 3 schon bei Inbetriebnahme möglichst gut auszulasten, allein schon deshalb, damit der dort optimal plazierte 'Retail-Sektor', also die schönen neuen Glitzer-Shops, die erwarteten Gewinne abwerfen. Das geht am einfachsten, wenn man von vorneherein festlegt, dass eine bestimmte Zahl von Airlines dahin umziehen muss, und das wird mit der Schliessung von Terminal 2 sicher erreicht.
Vor allem aber sprechen flugbetriebliche Interessen dafür, Terminal 3 möglichst schnell hochzufahren. Man muss wohl davon ausgehen, dass Fraport nach wie vor kapazitäts-steigernde neue
Betriebskonzepte
anstrebt ähnlich dem, dessen
Probebetrieb
vor zwei Jahren zunächst gescheitert ist. Dieses Konzept sah vor, dass beide Parallelbahnen gleichermaßen für Starts und Landungen genutzt werden können und startende Maschinen ohne besondere Sicherheitsabstände auf beiden Bahnen zwischen die landenden Maschinen 'eingeschleust' werden können.
So etwas funktioniert natürlich am Besten, wenn die Maschinen auf der Südbahn möglichst ohne Kreuzungsverkehr und lange Wege zur Rollbahn und davon weg kommen, d.h. im Süden ausreichende Terminal-Kapazitäten vorhanden sind und genutzt werden. Und da der Platzhirsch Lufthansa und die Star Alliance in Terminal 1 bleiben und damit der Hauptteil des Verkehrs dort abgewickelt wird, macht es betrieblich Sinn, alles andere nach Süden abzuschieben.
Tatsächlich lautete das
Fazit der DFS aus dem damaligen Probebetrieb ja auch, dass für eine
"zielführende Anwendbarkeit"
des Konzepts
"zwingend notwendige Anpassungen"
durchgeführt werden müssten, u.a.
"eine ausgewogene Verkehrsverteilung der Starts auf die Pisten des Parallelbahnsystems"
und
"die weitestgehende Vermeidung von Transferprozessen/Pistenkreuzungen (z.B. Zuführung von Starts: auf der Centerpiste aus dem Norden und auf der Südpiste aus dem Süden)".
Mit anderen Worten: Terminal 3 soll Kapazitätssteigerungen nicht nur dadurch ermöglichen, dass mehr Passagiere abgefertigt werden können, sondern auch dadurch, dass Starts und Landungen dichter gepackt und damit mehr Flugbewegungen pro Stunde realisiert werden können. Auch wenn das auf absehbare Zeit nicht ganztägig gebraucht, sondern nur stundenweise praktiziert werden sollte, würde das zu weiterer Verlärmung und mehr Risiken führen.
Die Schliessung von Terminal 2 bei Inbetriebnahme von Terminal 3 ist also für Fraport eine betriebs-technisch und -wirtschaftlich völlig logische Maßnahme. Ob und ggf. wann Terminal 2 dann wieder in Betrieb genommen wird, brauchen sie aktuell noch nicht zu entscheiden und können abwarten, wie sich die Kapazitäts-Nachfrage tatsächlich entwickelt.
Natürlich hält Fraport offiziell an ihren Wachstums-Phantasien fest und möchte bei Bedarf alle Kapazitäts-Reserven voll ausnutzen können. Dass sie die Absicht der Wiederinbetriebnahme behaupten, zielt wohl einerseits auf Anleger und Investoren, denen anspruchsvolle Ziele vorgestellt werden müssen, und andererseits auf die Öffentlichkeit, die es natürlich auch nicht gerne sieht, wenn Steuergelder ausgegeben und Umwelt geschädigt wird, um Überkapazitäten zu schaffen.
Was wirklich passieren wird, wird davon abhängen, wie schnell die fortschreitende Klimakatastrophe die Wachstumspläne der Luftverkehrswirtschaft Makulatur werden lässt. Ob das bereits 2030 oder erst zehn oder zwanzig Jahre später soweit sein wird, kann man heute nicht mit Sicherheit sagen. Nur dass es dahin kommen wird, ist (leider) inzwischen sicher.
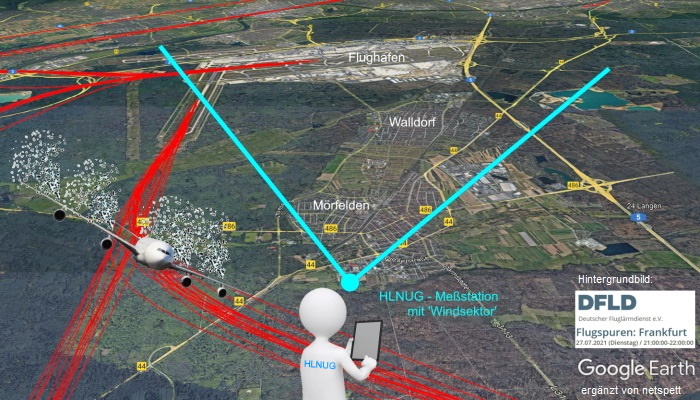
Das HLNUG definiert sich einen 'Windsektor', aus dem der Wind kommen muss, damit die gemessenen Partikel dem Flughafen als Quelle zugeordnet werden. In diesem Sektor liegt der größte Teil des Flughafengeländes und ein gutes Stück östlich davon, aber seltsamer Weise nicht die Startbahn West und die zugehörigen Abflugrouten.
(Für genaue Darstellung des Windsektors Bild anklicken.)
13.09.2022
Es war eine gute Nachricht für die Bürger von Mörfelden-Walldorf, die das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zur Veranstaltung am 07.09. ins Rathaus Walldorf mitbrachte.
16 Monate lang, von Ende Februar 2021 bis Ende Juni 2022, wurden am Südrand von Mörfelden ultrafeine Partikel (UFP) gemessen, und die mittlere Belastung war auch, wenn der Wind während der Betriebszeiten des Flughafens (5 - 23 Uhr) von dort wehte, kaum höher als sonst. Insgesamt überstiegen die Werte kaum die Hintergrundbelastung in vielen Frankfurter Ortsteilen.
Die Vortragsfolien mit den neuesten Auswertungen sind aktuell noch nicht verfügbar, enthalten aber auch nichts grundsätzlich Neues. Anzahlkonzentrationen von 6.000 - 8.000 Teilchen pro Kubikzentimeter für Partikel einer Größe zwischen 10 und 500 Nanometern, wie sie bereits im letzten
Bericht des HLNUG vom Januar 2022 dargestellt wurden, sind zwar keine Reinluft, aber für das Rhein-Main-Gebiet eher im unteren Bereich.
Allerdings liegt der gesamte Meßzeitraum bis Januar in der großen "COVID-Delle", in der die Flugbewegungs-Zahlen deutlich geringer waren als vor der Pandemie. Aber auch wenn man die Werte der letzten drei Monate der Meßperiode im
HLNUG-Meßdatenportal
betrachtet, in denen bereits wieder über 80% der 2019er Flugzahlen erreicht wurden, sind die UFP-Werte nur rund 20% höher.
Leider sind diese (relativ) guten Zahlen nicht die ganze Wahrheit.
Das liegt daran, dass die Auswertungen des HLNUG viel zu wünschen übrig lassen und viele wichtige Fragen mit großer Hartnäckigkeit ignorieren.
Für technisch Interessierte haben wir die wesentlichen Mängel bereits im Februar in Form einer Kritik des 4. HLNUG-Berichts (als
Webseite und als
PDF-Dokument) zusammengefasst.
Hier relevant sind erstens die Definition des 'Windsektors', aus dem der Wind kommen muss, damit die Partikel als Flughafen-bedingt gewertet werden, zweitens die völlige Ignoranz gegenüber dem, was auf dem Flughafen tatsächlich passiert, d.h. ob und wo geflogen wird, und drittens die Annahme, dass nur langfristige mittlere Belastungswerte relevant sind und kurzzeitige Spitzenwerte keine Bedeutung haben.
Die Windsektoren werden für alle Meßstationen nach einem nicht genau beschriebenen, fragwürdigen Verfahren definiert, das
etliche merkwürdige Resultate produziert. Der
Windsektor Mörfelden ist da keine Ausnahme. Interessant ist, dass die mathematischen Ergebnisse des Verfahrens offensichtlich keiner Plausibilitätskontrolle unterzogen wurden und das HLNUG von den Merkwürdigkeiten garnichts weiss. Der HLNUG-Referent in Walldorf wirkte jedenfalls leicht irritiert, als er damit konfrontiert wurde, dass die Startbahn West nicht zu seinem Flughafensektor gehört.
Wenn aber
"ein möglicher Einfluss startender Flugzeuge auf die UFP-Belastung in Mörfelden ... Gegenstand aktueller und zukünftiger Untersuchungen"
sein soll, wie es im
4. UFP-Bericht des HLNUG heisst, ist das genau der Bereich, wo man hinschauen muss. Und die Meßdaten lassen das durchaus zu.
Das zeigen wir am Fallbeispiel eines Tages, an dem an der HLNUG-Meßstation über Stunden deutlich erhöhte Partikelanzahl-Konzentrationen, in der Spitze über 37.000 Partikel pro Kubikzentimeter, erreicht wurden.
(Das haben wir schon getan, bevor uns die HLNUG-Vertreterin als Antwort auf entsprechende Kritik dazu aufgefordert hat, die Auswertungen, die wir für notwendig halten, selbst zu machen. Aber eine Unverschämtheit ist diese Aufforderung trotzdem. Wer wird denn dafür bezahlt, die Luftqualität in Hessen zu überwachen und rechtzeitig vor drohenden Gefahren zu warnen? Im Übrigen wären nicht Einzelfall-Untersuchungen notwendig, sondern systematische Langzeitauswertungen, die die Grenzen dessen, was ehrenamtlich möglich ist, weit überschreiten.)
Der 27. Juli 2021 war der Tag, an dem in Mörfelden mit 37.307 Partikel pro Kubikzentimeter die höchste Anzahlkonzentration in dem für Flugzeug-Emissionen besonders relevanten Grössenbereich von 10 - 50 Nanometern gemessen wurden, zumindest, wenn man sich auf plausible Messungen beschränkt. Das ist mehr als das Neunfache des Durchschnittswertes.
Es gibt deutlich höhere Meßwerte. So wurden in den ersten Tagen der Meßperiode, Ende Februar 2021, häufig hohe Werte, teilweise über 60.000 Partikel/cm³ im genannten Grössenbereich, gemessen, obwohl es da relativ wenig Flugbewegungen am Flughafen insgesamt gab (< 500/Tag), der Wind überwiegend aus östlichen bis südlichen Richtungen wehte und meist kein einziger Abflug auf der Route an Mörfelden vorbei stattfand.
Der absolut höchste Wert mit 68.723 Partikel/cm³ trat am 20.09.21 auf, beschränkt auf einen einzigen Halbstundenwert und begleitet von (breiteren und weniger ausgeprägten) Maxima bei Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid und den gröberen Feinstaub-Fraktionen. In diesen Fällen muss man davon ausgehen, dass die gemessenen Belastungen durch lokale Ereignisse in der Nähe der Meßstation hervorgerufen wurden.
Das HLNUG macht sich nicht die Mühe, solche Ausreisser zu identifizieren und zu kennzeichnen. Stattdessen steht unter allen Meßergebnissen, egal wie alt, "Es handelt sich um nicht abschließend geprüfte Messdaten". Ob sie die Werte für ihre eigenen Auswertungen einer Korrektur unterziehen, ist nicht dokumentiert.
Die Werte vom 27.07. scheinen deswegen plausibel, weil sie relativ gut mit einer plausiblen Quelle korrelieren und andere Schadstoffe ein anderes Verhalten zeigen. Insbesondere bleibt das Stickstoffmonoxid, das erhöht sein müsste, wenn in der Nähe der Meßstation ein Motor laufen würde, auf Hintergrundniveau.
Bei solchen Detail-Betrachtungen müssen neben der Windrichtung auch noch andere meteorologische Parameter beachtet werden, die die Partikel-Ausbreitung beeinflussen können, sich aber bei Betrachtung längerer Zeiträume mehr oder weniger "herausmitteln". Das sind insbesondere die Windstärke, die Verteilung und Absinkgeschwindigkeit beeinflusst, und der Niederschlag, der die Ausbreitung reduziert, indem er Teilchen aus der Luft "herauswäscht".
Unter Berücksichtigung all dessen lassen sich die Meßwerte vom 27.07. wie folgt interpretieren:
Aus dieser Betrachtung lässt sich eine Hypothese über den Einfluss der Starts auf die UFP-Belastung formulieren, die folgendermaßen lautet:
Um diese Hypothese zu überprüfen, wäre es notwendig, aus dem gesamten Meßzeitraum die Zeiten herauszusuchen, in denen die meteorologischen und Betriebs-Parameter passen und zu sehen, ob die Werte tatsächlich jedesmal ansteigen.
Für eine genaue Überprüfung müssten diese Parameter allerdings wesentlich genauer zur Verfügung stehen. Nicht nur müssten die UFP-Werte und die meteorologischen Parameter zeitlich höher aufgelöst sein, es sollte auch bekannt sein, wie stark die jeweils startenden Flugzeuge emittieren, also Flugzeugtyp, Startgewicht etc..
Das HLNUG wird diese Prüfung nicht machen, und ob im Rahmen des
geplanten UFP-Projekts solche Untersuchungen vorgenommen werden, ist noch nicht bekannt. Allzu große Erwartungen sollte man besser nicht haben.
Aber auch wenn die Hypothese zutrifft, wäre das für Mörfelden nicht die ganz grosse Katastrophe. Die Konstellationen, unter denen die ultrafeinen Partikel aus den Triebwerken der startenden Flugzeuge das Stadtgebiet in relevanten Konzentrationen erreichen, scheinen relativ selten zu sein, so dass auch bei wieder zunehmendem Flugbetrieb die Zeiten hoher Belastung beschränkt bleiben sollten.
Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass bei Ultrafeinstaub auch kurze Zeiten hoher Belastung
negative Effekte haben können, weil bei hohen eingeatmeten Konzentrationen die Wahrscheinlichkeit, dass toxische Partikel die diversen Filtersysteme des Organismus überwinden und über den Blutkreislauf zu den inneren Organen einschließlich dem Gehirn vordringen können, deutlich erhöht ist. Für UFP aus Flugzeug-Triebwerken wurden dabei insbesondere auch
Atemwegsentzündungen nachgewiesen.
Generell würde die Richtigkeit der obigen Hypothese bedeuten, dass zumindest am Anfang einer Abflugrouten das Risiko hoher Belastungen ebenso erhöht ist wie unter den Anflugrouten. Das könnte also z.B. für Raunheim bedeuten, dass bei östlichen und südlichen Winden auch die Abflüge über die Südumfliegung die UFP-Belastung zumindest im südöstlichen Stadtgebiet deutlich erhöhen könnten. Gleiches könnte auch noch für andere Abflugrouten gelten.
Aber auch wenn die erhöhten Partikel-Konzentrationen nicht über bewohntem Gebiet herunterkommen: unschädlich werden sie nur, wenn die ultrafeinen Partikel in andere Formen umgewandelt werden. Das geschieht in mehr oder weniger kurzer Zeit durch physikalisch-chemische Umwandlungen in der Luft oder durch Anlagerung an Oberflächen wie Blätter, Boden o.ä.. Vorher können sie aber auch über Feld und Wald Schaden anrichten, wenn da zufällig jemand ist, der sie einatmet.
Um die Risiken in allen Bereichen abschätzen zu können, brauchte es ein Modell, das die Ausbreitung und das Absinken der von den Triebwerken emittierten ultrafeinen Teilchen halbwegs realistisch beschreiben kann. Man muss allerdings befürchten, dass diejenigen, die die Entwicklung eines solchen Modells finanzieren könnten (und müssten), daran absolut kein Interesse haben und wir daher noch lange im Unklaren bleiben darüber, welchen Gefahren der Flugverkehr uns mit diesen Emissionen aussetzt.
Nach dem
Vorsorge-Prinzip sollte aber allein die Möglichkeit ernsthafter Schäden genügen, um Minderungsmaßnahmen einzuleiten. Und es gibt wahrlich noch
sehr viel mehr gute Gründe dafür, dass der Luftverkehr schrumpfen muss.
Inzwischen stehen auch die
Vortragsfolien
zur Veranstaltung zu Verfügung (möglicherweise schon seit längerem, aber wir sind erst jetzt drüber gestolpert).
Besonders interessant erscheinen uns darin die Folien 17 und 18, auf denen die "UFP-Konzentration Mörfelden-Walldorf - Abhängigkeit von der Windrichtung" dargestellt wird. Da sieht man zunächst, dass für den gesamten UFP-Größenbereich von 10 - 500 nm zwischen 0:00 und 5:00 Uhr ein Maximum bei Wind aus Richtung Ostnordost auftritt, das sogar noch höher ist als das Maximum aus Richtung Nord zwischen 5:00 und 23:00 Uhr. Für den UFP-Größenbereich von 10-30 nm gibt es dieses Maximum auch noch, allerdings deutlich niedriger als das Maximum aus Richtung Nord für die Zeit zwischen 5:00 und 23:00 Uhr.
Auf Folie 18 kann man auch noch erahnen, wie der "Windsektor Flughafen-Einfluss:" bestimmt wurde: wo das Maximum der Teilchen für den UFP-Größenbereich von 10-30 nm auftritt, muss der Einfluss des Flughafens vorherrschen. Dass dieser Sektor im Osten deutlich über den Flughafen hinausreicht, interessiert dabei nicht. Wollte man diese Aussage ernst nehmen, müsste man davon ausgehen, dass die Emissionen des Endanflugs für Landungen auf der Südbahn über ca. 8 km Entfernung an der Meßstation Mörfelden registriert werden können - was anderswo heftig bestritten wird.
Betrachtet man das
Umfeld der Meßstation
genauer, erscheint eine andere Erklärung wesentlich plausibler. Im Zeitbereich zwischen 0:00 und 5:00 Uhr registriert die Station den LKW-Verkehr, der von dem Gewerbegebiet im Osten Mörfeldens mit einem ALDI-Zentrallager, einem DHL-Lager und der Societäts-Druckerei ausgeht, während zwischen 5:00 und 23:00 Uhr die PKW-Emissionen dominieren, die von der B486 und der B44, die nur in wenigen hundert Metern an der Station vorbeiführen, ausgehen.
Der Flugverkehr hat damit, wie oben dargestellt, nur in ganz speziellen Situationen, bei Winden aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen, etwas zu tun. Aber ohne nähere Untersuchungen bleibt auch das pure Spekulation.
Am 20.10.2022 erhielten wir eine Mail aus dem HLNUG, deren Text ausdrücklich nicht zur Veröffentlichung freigegeben ist, die aber im Anhang eine "
Stellungnahme
des HLNUG zur Mail der BI Raunheim vom 14.09.2022"
enthielt, die wir veröffentlichen dürfen. Die zitierte Mail vom 14.09. enthielt unseren obigen Beitrag, natürlich ohne das Update vom 18.10..
Diese Stellungnahme fordert in mehrfacher Hinsicht zu einer Antwort heraus, da sie zwar auf die Mehrzahl der vorgetragenen Kritiken garnicht eingeht, in einigen Details aber weitere Rückschlüsse auf die Behandlung der Meßdaten durch das HLNUG und die Qualität der vorgelegten Auswertungen zulässt. Da aber das Meiste davon nur von begrenztem allgemeinen Interesse sein dürfte, haben wir alles in eine Entgegnung gepackt, die Interessierte (wieder als
Webseite
oder als
PDF-Dokument)
nachlesen können. Hier wollen wir nur auf einen Punkt eingehen, der generell im Umgang mit HLNUG-Daten wichtig ist.
Denn wir haben einen Fehler gemacht, der anderen vielleicht auch passieren könnte. In den
"Bemerkungen zur Auswertung des 27.07.2021"
stellt das HLNUG fest:
"Das HLNUG gibt die Partikelkonzentration in MEZ, der DFLD die Flugbewegungen und Winddaten in MESZ und MeteoStat die Niederschlagsdaten in MESZ an" (MEZ: Mitteleuropäische Zeit, MESZ: Mitteleuropäische Sommerzeit). Daraus ergibt sich ein zeitlicher Versatz von einer Stunde zwischen den jeweiligen Datenreihen, den wir in den Betrachtungen oben und auch in der Kritik des 4. HLNUG-Berichts nicht beachtet haben.
Zu unserer Entschuldigung können wir anführen, dass zwar das Nichtbeachten unterschiedlicher Zeitskalen ein typischer Anfänger-Fehler in der Meteorologie ist, aber andererseits die Nicht-Verwendung der gültigen Ortszeit bei lokalen Daten, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, auch ungewöhnlich ist. (Dass man die interne Datenbank nicht mit solchen Zeitsprüngen belastet, ist sehr verständlich, aber die öffentliche Darstellung ist etwas anderes. Und dass es Publikums-freundlicher geht, beweisen Datenportale wie MeteoStat oder die DFLD-Seiten.)
Das HLNUG weist im Meßdatenportal auf diesen besonderen Sachverhalt nicht gerade deutlich hin. Man kann es sehen, wenn man in der "graphischen Darstellung" der Meßwerte mit dem Mauszeiger über einen Meßpunkt fährt: dann erscheint ein Fenster, in dem die Uhrzeit mit dem Hinweis "MEZ" und der zugehörige Datenwert angezeigt wird. Ausserdem gibt es in den Readme-Files zu den Datendownloads einen entsprechenden Hinweis. Bei gründlichem Hinsehen hätten wir es also wissen können.
Die Konsequenzen dieses Fehlers sind allerdings keineswegs so dramatisch, wie das HLNUG sie darstellt. Sie behaupten:
"Aufgrund dieser falschen Zuordnungen haben die von Ihnen abgeleiteten Korrelationen zwischen Flugbewegungen, Niederschlag und Partikelkonzentration keinen weiteren Bestand".
Aber auch hier lohnt es sich, genau hinzusehen, denn tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.
Die Begründung dafür steht in der Entgegnung, wo wir es uns auch nicht verkneifen konnten, noch ein paar zusätzliche Argumente für unsere Interpretation der Meßdaten zusammenzutragen. Unser Fazit bleibt:
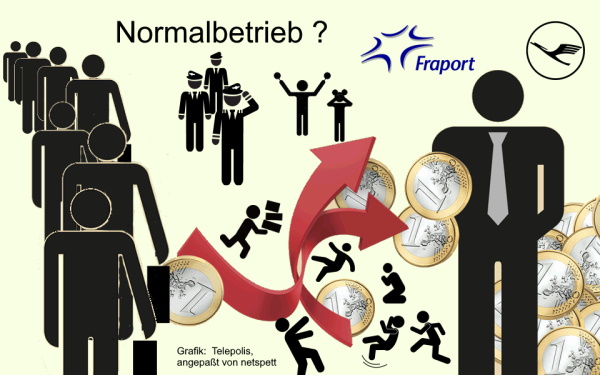
Die Passagiere stehen Schlange, warten, suchen ihr Gepäck; die Belegschaften rotieren,
um den Betrieb irgendwie am Laufen zu halten; die Konzerne streichen die Profite ein;
Gesundheit, soziale Gerechtigkeit, Umwelt und Klima gehen dabei drauf:
alltäglicher Wahnsinn im kapitalistischen 'Normalbetrieb'.
28.08.2022
„Ende Juni erschien in mehreren Tageszeitungen eine
ganzseitige Anzeige, unterschrieben von 13 Top-Managern der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Sie enthielt eine Entschuldigung für "zu lange Wartezeiten, zahlreiche Flugstreichungen und Unregelmäßigkeiten im Luftverkehr", die Ankündigung, dass es damit auch zumindest in diesem Sommer weitergehen werde, und die Aufforderung an die Politik, "die Rahmenbedingungen [zu] verbessern, um einen reibungslosen und leistungsfähigen Luftverkehr zu gewährleisten", damit "auch in der Zukunft die Freiheit des Fliegens grenzenlos ist".“
So begann ein
Beitrag, den wir vor mehr als vier Jahren hier veröffentlicht haben. Die Anzeige erschien im Juni 2018, könnte aber ebenso gut vor ein paar Wochen aufgegeben worden sein.
Sicher würden heute die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine als Ursachen betont, aber der Kern des Problems ist nach wie vor ein anderer. Ebenso wenig geändert haben sich die Arroganz und Hybris der Top-Manager, die zum großen Teil immer noch aktiv sind und im Wesentlichen die Verantwortung tragen für das, was öffentlich als Chaos und Stress empfunden wird und für die Belegschaften von Flughäfen und Airlines Arbeitshetze und Sozialabbau bedeutet.
Es mag erstaunlich klingen, hier auf solche Kontinuitäten zu verweisen angesichts des
Zusammenbruchs des Luftverkehrs während der Corona-Pandemie und der allenthalben verkündeten
Zeitenwenden nach dem russischen Überfall auf die Ukraine (Dieser Link führt zu einem von der Regierung gesponsorter Think-Tank, der geführt wird vom langjährigen Airbus-Top-Manager, Rüstungs-Lobbyisten und Bundeswehrmajor Thomas Enders - man merkt es beim Lesen, und es ist ein schönes Beispiel, wie Lobbyismus in diesem Bereich funktioniert).
Tatsächlich haben aber Konzerne wie die
Lufthansa und
Fraport die Corona-Pandemie dazu genutzt, noch schneller und radikaler umzusetzen, was sie seit langem tun: umstrukturieren und sich
profitabler aufstellen, indem teure Teile der
Belegschaften abgebaut und Arbeits- und Tarif-Bedingungen verschlechtert werden. Und auch wenn sie das erreichte Tiefstniveau angesichts von Arbeitskräftemangel und öffentlichem Druck nicht überall halten können, verbessern die neuen Strukturen die Arbeitgeber-Positionen langfristig, und Arbeitnehmer*innen müssen um jede kleine Verbesserung erbittert kämpfen.
Selbst im 'Spiegel' darf ein Arbeitsrechtler unumwunden das
jahrelange Lohndumping am Frankfurter Flughafen (und die zwiespältige Rolle etlicher Gewerkschafts-Vertreter*innen dabei) anprangern. Und dass die Umbauten des Lufthansa-Konzerns im letzten Jahrzehnt, von der
Gründung von Eurowings vor fast 10 Jahren und diversen
Übernahmen, u.a. von Brussels Airlines und Air Berlin, bis zu den aktuellen Gründungen der Billigtöchter
Eurowings Discover
und
'Cityline 2' vor allem zur Senkung der Personalkosten dienten, war jeweils offenkundig. Bei letzteren wird übrigens "das Selbstbewusstsein unserer Mitarbeitenden gestärkt" nicht durch angemessene Löhne, sondern Zugeständnisse anderer Art: dort sind dem Kabinenpersonal "sichtbare Tätowierungen bis zu 8 Quadratzentimetern ebenso erlaubt wie Piercings", und "seit kurzem dürfen auch Männer Nagellack und dezente Schminke tragen". Geld ist eben nicht alles.
Wie dieser Wandel in den letzten Jahrzehnten ablief und vor allem, was er für die Beschäftigten in der Luftverkehrswirtschaft bedeutete, beschreibt eine kürzlich erschienene Studie mit dem Titel "Verlierer*innen in einer beflügelten Branche – Der Wandel von Beschäftigungsstrukturen und Arbeitsbedingungen im deutschen Luftverkehr". Trotz ihrer klaren Bedeutung für das Verständnis der Hintergründe der aktuellen Entwicklungen im Luftverkehr hat sie nur eine relativ begrenzte Resonanz gefunden, u.a. in Frankfurter Rundschau und Tagesschau. Das mag an der klaren politischen Ausrichtung liegen: die Studie wurde von der Bundestagsfraktion der LINKEN in Auftrag gegeben, und einer der Autoren ist der langjährige Ausbaugegner und Ex-Bundestagsabgeordnete aus Mörfelden-Walldorf, Jörg Cezanne. Eine Vorab-Zusammenfassung wurde schon letztes Jahr im 'Verkehrspolitischen Zirkular' der Fraktion veröffentlicht. Ein Zitat aus dieser Zusammenfassung gibt eine Kernaussage der Studie wieder:
In einem Haifischbecken fühlen sich natürlich die Haifische am wohlsten, selbst wenn auch dort nicht alles zu ihrer Zufriedenheit verläuft und sie vor Überraschungen nicht sicher sein können. So hat Fraport wohl wirklich geglaubt, sie müssten Fluggesellschaften mit Rabatten locken, um die Passagierzahlen zu erreichen, mit denen sie jetzt zu kämpfen haben. Aber diese unnötige Ausgabe können sie leicht verschmerzen, zumal sie die Rabatte ja in weiser Voraussicht gedeckelt haben.
Ob der Umbau wirklich auch für die Konzerne zu radikal war und sie das aktuelle Chaos eigentlich lieber vermieden hätten, ist umstritten.
Aktuell jedenfalls können sie mit den Folgen gut leben.
Dass die reisewütige Kundschaft Zumutungen weitgehend klaglos ertragen würde, hatte sich schon früher, zuletzt 2018/19, gezeigt. Flughäfen haben untereinander ohnehin nur wenig Konkurrenz zu befürchten (die wenigstens Urlauber können frei wählen, ob sie von London, Frankfurt oder Istanbul aus in den Urlaub fliegen), und die Airlines konnten davon ausgehen, dass, wenn die Abfertigung an den Flughäfen die entscheidende Engstelle sein würde, ihre Konkurrenten ebenso betroffen sein würden und sie vielleicht einige Aufträge, aber zumindest keine Marktanteile verlieren würden. Und mit weniger Leistung denselben oder sogar noch größeren Profit zu machen, ist keine schlechte Aussicht.
Dass die auf Kante genähte Personaldecke durch hohe Krankenstände dann doch noch zu kurz geworden ist und die Leistungen stärker als geplant zurückgefahren werden mussten, kann zwar nicht wirklich überraschen, bleibt aber in den Konsequenzen im Rahmen. Sowohl
Lufthansa als auch
Fraport machen jedenfalls auch mit ihrem Chaosbetrieb inzwischen wieder satte Gewinne.
Das Ganze läuft so gut, dass Lufthansa auch die Flüge im Winterflugplan
reduzieren will. Wegen höherer Ticketpreise sinkt die Gewinnprognose trotzdem nicht. Deshalb kann sie es sich auch leisten, die aktuellen Tarifverhandlungen knallhart zu führen und auch
Streiks zu riskieren. Selbst im aktuell besonders profitträchtigen Frachtbereich möchte sie der Belegschaft so wenig wie möglich abgeben.
Und einen weiteren grossen Vorteil hat die Situation ja auch noch: kaum jemand regt sich auf, wenn die gestressten Airlines
Nachtflugbeschränkungen nicht einhalten oder ihre Maschinen
leer durch die Gegend fliegen lassen.
Die herrschende Politik hat diese
Billig-Strategien nicht nur von Anfang an
gefordert und gefördert, sie unterstützt sie nach wie vor aktiv. Zwar kann eine der populistischen
Nothilfemaßnahmen, mit denen die Ampel-Koalition den Mißmut der Reisewilligen von sich ablenken wollte, inzwischen als gescheitert gelten: der Versuch, rund 2.000 fehlende Fachkräfte in gewohnter neokolonialistischer Manier einfach anderswo, wo das Lohnniveau noch tiefer liegt, wegzukaufen, brachte nur 140 Bewerbungen und
32 erteilte Einreise-Visa (Stand 24.08.22).
Von der grundsätzlichen Unterstützung des weiteren Wachstums des Flugverkehrs auf der Basis der neoliberalen
Luftverkehrsstrategie der EU aber wollen die Koalitionäre nicht abgehen, obwohl sie wissen, dass das aufgrund der nicht behebbaren
Klimadefizite des Luftverkehrs eindeutig
verfassungswidrig ist. Und das gilt nicht nur für den
klimapolitischen Totalausfall im von der Porsche-Partei geführten Verkehrsministerium. Auch die Grünen würden nicht viel mehr tun als
winzige Schritte wie eine längst überfällige
Kerosin-Besteuerung gehen und damit nicht etwa den Flugverkehr reduzieren, sondern "einen Anreiz für die Nutzung von klimafreundlichen Treibstoffen schaffen". Aber selbst das verhindert ja der schreckliche Koalitionszwang weitgehend.
Dennoch wäre es denkbar, dass aktuell ein gewisser Wendepunkt erreicht ist. Dass dem Flugverkehr generell Grenzen gesetzt sind, haben wir eingangs bereits zitiert. Und auch die Lohnsenkungen und der Personalabbau können nicht beliebig weiter gehen. Es mag ihnen noch gelingen, die Pilotengehälter auf das Niveau von Lokführern oder anderen nicht (mehr) privilegierten Berufen zu drücken, aber sie werden das Lohnniveau bei den Bodenverkehrsdiensten nicht dauerhaft unter dem Existenzminimum halten können. Und auch die Möglichkeiten der Rationalisierung und der Produktivitätserhöhung durch Digitalisierung sind begrenzt. Daher ist es konsequent, wenn von
Ryanair bis Lufthansa alle betonen, dass die Aera der extremen Billigflüge vorbei sei und Fliegen wieder teurer werden müsse.
Von der notwendigen Trendwende hin zu einem deutlich reduzierten,
nachhaltig betreibbaren Flugverkehr ist das allerdings noch sehr weit entfernt. Es ist natürlich keine Rede davon, dass die Preise für Flugtickets tatsächlich die realen Kosten, inklusive der angerichteten Umweltschäden, decken sollen. Dafür brauchte es drastische Veränderungen in den Geschäftsmodellen von Flughäfen und Airlines, und eine Politik, die die Rahmenbedingungen dafür gemäß den bestehenden ökologischen Grenzen setzt. Im Moment sieht es allerdings eher so aus, als müsse das System erst
komplett zusammenbrechen, bevor solche Änderungen möglich sind. Bis dahin sind wir alle aufgefordert: "Don’t Look Up".
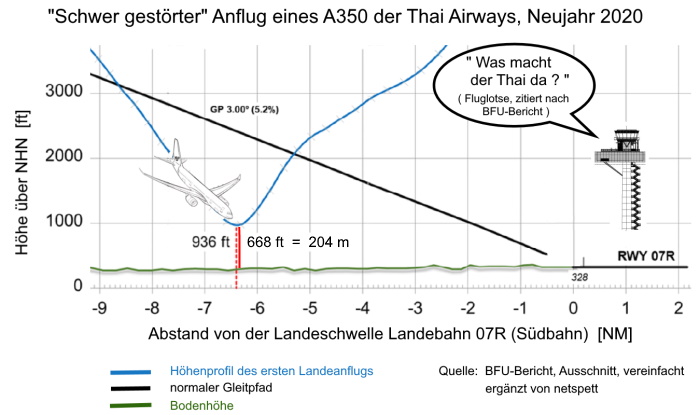
Ein Flugzeug stürzt durch Pilotenfehler beinahe ab, Fluglotsen wundern sich, aber greifen nicht ein:
das ist an sich schon eine Katastrophe. (Für Details des Vorfalls Grafik anklicken)
22.08.2022
Fast zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis die 'Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen' BFU ihren Bericht zu einer "schweren Störung" des Flugverkehrs am Flughafen Frankfurt an Neujahr 2020 vorgelegt hat. Damals war ein A350 der Thai Airways im Landeanflug auf die Südbahn zwischen Bischofsheim und Rüsselsheim bis auf 200 Meter Flughöhe abgesunken, ehe der Pilot die Maschine abgefangen hat und durchstartete.
Wie schon bei dem Vorfall selbst, war es wieder der
Aviation Herald, der zuerst die wesentlichen Inhalte des BFU-Berichts meldete, ehe der
aerotelegraph nachzog und damit auch die Vorlage für die gleichlautende
Berichterstattung in FR und FNP lieferte.
Alle zitieren die vier Ursachen, die die BFU benennt, und die allesamt auf Fehler der Piloten hinauslaufen: das 'Flight Management System' wurde falsch programmiert, die 'automatische Flugsteuerung' wurde falsch bedient, die Piloten begriffen die 'Lage' des Flugzeugs 'im Raum' nicht richtig, und die 'Kommunikation und Zusammenarbeit' der Piloten war mangelhaft.
Rätselhaft bleibt, wieso das passieren konnte, obwohl alle vier beteiligten Piloten (zwei aktive Piloten und zwei weitere, die den Start- und Lande-Vorgang überwachen sollten) "von der BFU aufgrund ihrer langjährigen fliegerischen Tätigkeiten und hohen Gesamtflugerfahrung als erfahren eingestuft" wurden. Sie waren an den vorgesehenen Plätzen und hatten die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten.
Auch gab es nichts, was "auf einen Defekt der Navigations- oder der Empfangsanlage für den Localizer- und die Gleitwegantenne hätte schließen lassen. Anhand der FDR-Daten des betreffenden Fluges wurden keine Warnungen identifiziert oder Parameter erkannt, die auf einen technischen Fehler schließen lassen". Mit anderen Worten: eigentlich war alles so, wie es sein sollte.
Die Probleme begannen mit einer Lotsen-Anweisung. Die Flugzeugbesatzung hatte Stunden vorher gemeldet, dass ein Passagier bei Ankunft medizinische Unterstützung benötigen würde und ein Krankenwagen bereitstehen solle. Der erste am Flughafen zuständige Lotse fragte nach, ob diese Information korrekt sei und ob zusätzliche Unterstützung benötigt werde. Die Besatzung bestätigte, dass alles geregelt sei. Trotzdem entschied der nächste zuständige Lotse, dass ein medizinischer Notfall vorläge und der Anflug daher möglichst verkürzt werden sollte. Er wies die Piloten an, vom geplanten Anflug abzuweichen, nach Norden abzudrehen und schneller zu sinken, bis sie über Mainz wieder auf den Gleitpfad stossen und zum Endanflug ansetzen sollten.
Die BFU beurteilt diese Anweisung als "nicht erforderlich, da keine medizinische Luftnotlage vorlag", kommt zu dem Schluss, dass dadurch "die Cockpitbesatzung einem zeitlichen Stress ausgesetzt" wurde und "sieht in der Anweisung den Sinkflug zu beschleunigen und den Flugweg zu verkürzen einen beitragenden Faktor" zu den dann folgenden Pilotenfehlern.
Der BFU-Bericht beschreibt ausführlich, dass die Piloten von dem unvermuteten Manöver offensichtlich überfordert waren und welche Fehler sie in der Folge machten. Aus den angegebenen Geschwindigkeiten, Sinkraten und Flughöhen wird deutlich, dass die Maschine auf dem Opelgelände aufgeschlagen wäre, wenn der Pilot noch 30 Sekunden länger für die Einleitung des Durchstart-Manövers gebraucht hätte. Was ihn die Situation im letzten Moment noch erkennen und retten liess, bleibt unklar, denn die technischen Systeme im Flugzeug hatten offenbar schon viel früher gewarnt, ohne dass einer der Piloten reagiert hätte. Insofern erscheint es durchaus berechtigt, wenn die BFU-Schlussfolgerungen auf menschliches Versagen als Hauptgrund für den Zwischenfall hinweisen.
Was der Bericht aber auch beschreibt, was es allerdings nicht in die Schlussfolgerungen geschafft hat und damit in den Medienberichten auch keine Rolle spielt, sind die Fehler und technischen Mängel bei der Flugsicherung.
Der zweite Lotse, im Jargon "Feeder" oder "Einspeiser" genannt, weil er die ankommenden Flugzeuge zu der Perlenkette auffädeln soll, die sich dann über Gegen- und Endanflug bis zur Landebahn bewegt, hat nicht nur durch ein kurzfristig angeordnetes, eigentlich unnötiges Manöver die Piloten gestresst. Er hat auch zwei Warnmeldungen ignoriert, die ihm hätten zeigen können, dass die Piloten das Manöver nicht bewältigt hatten und die Maschine nicht korrekt auf den Endanflug "eingepeist" war. Auch als er einen Kollegen fragen hörte, "[…] was macht der Thai da?", hat er sich nicht weiter darum gekümmert (der Kollege offensichtlich auch nicht). Das Schlimme daran ist: hier handelte es sich offenbar nicht um individuelles menschliches Versagen und Verstösse gegen bestehende Vorschriften, sondern um ganz normale, offiziell tolerierte Praxis! Die Ausführungen dazu im Bericht lesen sich wie unfreiwillige Satire.
Danach gibt es bei der DFS zwei Systeme, die "das Flugverkehrskontrollpersonal warnen, wenn ein Luftfahrzeug zu tief fliegt oder vom Anflugweg abweicht". Das eine, "grundsätzlich geeignetere System" namens APM ('Approach Path Monitor') war in Frankfurt nicht "adaptiert", "da aufgrund der Nähe der Pisten zueinander sowie in der Nähe liegender weiterer Flugplätze (Wiesbaden Erbenheim, Mainz Finthen) eine hohe Zahl von Fehlalarmen zu erwarten sei". Das andere, "gemäß seiner originären Logik nicht für die Überwachung von Anflügen konzipiert", (MSAW, 'Minimum Safe Altitude Warning'), erzeugt in der ersten Stufe Warnungen, die denen eines anderen Systems ähneln, das "viele Fehlalarme" auslöst und deswegen in der Regel ignoriert wird (Aussage des Lotsen: er habe "den Alarm möglicherweise als Fehlalarm interpretiert. Es blinke sehr oft grün".) Eigentlich hätte das System auch eine (vermutlich deutlichere) Warnung der zweiten Stufe auslösen müssen, aber da war das Flugzeug bereits in der "Inhibition Area EDDF", einer Zone, in der alle derartigen Warnungen unterdrückt werden, um "ungewollte Alarmierungen im Bereich des Endanfluges, in dem sich anfliegende Luftfahrzeuge dem Boden naturgemäß annähern, zu verhindern".
Mit anderen Worten: von zwei Sicherungssystemen war eins garnicht nicht in Betrieb, das andere wurde in der ersten Stufe nicht ernst genommen und wird ab einer gewissen Nähe zum Flughafen ohnehin generell unterdrückt. Eine Anflugüberwachung, die eine derart gravierende Abweichung vom Gleitpfad hätte zuverlässig feststellen und angemessen warnen können, gab es nicht.
Der 'Einspeise-Lotse', der nach eigener Aussage "den Endanflug überwacht" hat, war dafür auf offensichtlich völlig unzureichende Beobachtungen angewiesen. Er habe "gesehen, dass das Luftfahrzeug den
Localizer durchflogen habe. Das Luftfahrzeug sei weder zu schnell, noch zu hoch gewesen. Auch das Überschießen des Leitstrahls komme häufiger vor, beispielsweise um Höhe abzubauen. Da sich das Luftfahrzeug im Sinkflug befand, sei er davon ausgegangen, dass es sich auf dem Gleitpfad befände. Sonst wäre es seiner Ansicht nach nicht weiter gesunken".
Selbst wenn er die vom MSAW generierten Alarme wahrgenommen hätte, hätte das wohl nicht geholfen. "Dass der Alarm aufgrund einer Bodenannäherung generiert wurde, habe er nicht in Betracht gezogen, da sich kein Berg in der Nähe befände. Er hätte ohnehin nichts anderes gemacht, da sich der Airbus seiner Ansicht nach auf dem Gleitpfad befand. ... Er habe gesehen, dass das Luftfahrzeug nach dem Durchfliegen des Localizer bereits wieder auf diesen zurückdrehte. Daraufhin habe er die Anweisung an die Cockpitbesatzung gegeben auf die Funkfrequenz von Frankfurt Tower zu wechseln", denn "Wenn der Endanflug für den Einspeiser „gut aussehe“ könne er das betroffene Flugzeug zum Tower schicken".
Das "reduzierte Situationsbewusstsein ... über die Lage im Raum", das die BFU den Piloten attestiert, war offensichtlich auch bei den Lotsen vorhanden. Sie hatten "jederzeit die Möglichkeit, ein Fehlanflugverfahren anzuweisen", aber keiner hat es getan.
Ein unabhängiger Bericht hätte also nicht nur das Versagen der Piloten feststellen müssen, er hätte auch die DFS für die aufgezeigten systematischen Mängel deutlich kritisieren und umgehend Verbesserungen einfordern müssen. Der BFU-Bericht leistet das nicht und kann es aufgrund der Einbindung der BFU in des System der Luftverkehrswirtschaft vermutlich auch nicht. Nicht umsonst wird im Vorspann jedes BFU-Berichtes die gesetzliche Grundlage für ihre Arbeit genannt, und danach "ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen". Man muss wohl dankbar sein, dass der Bericht die Fakten und Befunde offen beschreibt.
Eine kritische Bewertung der Ergebnisse wäre Aufgabe anderer Akteure, z.B. kritischer Medien, die hier überwiegend versagen. Aber auch Aufsichtsbehörden aller Ebenen und Gremien und Organisationen, die sich den Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Flugverkehrs zur Aufgabe gemacht haben, von Parteien bis zu Bürgerinitiativen, von der Fluglärmkommission bis zum Landtag wären gefordert, solche Mängel aufzudecken und Verbesserungen einzufordern. Das wird einerseits erschwert dadurch, dass es fast immer ewig dauert, bis solche Berichte vorliegen (hier 2,5 Jahre!), aber vor allem fehlt es fast überall an Interesse, Zeit und Fachkompetenz, um sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Parteien und Gremien vertrauen überwiegend ohnehin lieber auf die Selbstheilungskräfte des Systems.
Und immerhin kann der Bericht am Schluss ja auch noch mitteilen: "Das Flugsicherungsunternehmen hat der BFU im März 2022 mitgeteilt, dass das APM für Anflüge auf den Verkehrsflughafen Frankfurt/Main parametriert und aktiviert worden sei". Das heisst, mehr als zwei Jahre nach diesem Ereignis hat die DFS jetzt ein System in Betrieb, das es ihr erlauben könnte, Abweichungen vom geplanten Anflug tatsächlich festzustellen. Ob es technisch leistet, was es soll, und ob damit auch die anderen hier deutlich gewordenen Mängel beseitigt wurden, wird die Öffentlichkeit wohl erst erfahren, wenn es wieder einmal zu einem solchen Vorfall kommt. Oder wenn an einer anderen Stelle im völlig überlasteten Luftraum Rhein-Main ein eigentlich notwendiges Sicherheitssystem nicht 'adaptiert' werden kann oder
aufgegeben werden muss, um noch etwas mehr Kapazität aus dem System herauszuholen.
(alle kursiv gesetzten Zitate sind dem BFU-Bericht entnommen)
21.07.2022
Das von der hessischen Landesregierung beim Forum Flughafen und Region beauftragte Projekt zur "Untersuchung der Ultrafeinstaub-Belastung in der Rhein-Main-Region" hat langsam aber doch die nächsten Schritte gemacht. Ein detailliertes Konzept liegt vor, wurde wissenschaftlich begutachtet und in eine Ausschreibung umgesetzt, in der die inhaltlichen Vorgaben an die Forschenden in einer Leistungsbeschreibung zusammengefasst sind. Zusammen mit der Leistungsbeschreibung für die Entwicklung des Studiendesigns der Belastungsstudie geben diese drei Papiere (Design-Konzept, Begutachtung und Leistungsbeschreibung) und die kleinen Unterschiede zwischen ihnen einen kleinen Einblick darin, wie die Diskussionen bei der Steuerung dieses Projektes verlaufen - und wer dabei das Sagen hat.
Aktuell ist ausserdem die Erstellung eines Designs für den zweiten Teil des Projekts ausgeschrieben, für die Wirkungsstudie, in der die gesundheitlichen Folgen der UFP-Belastungen untersucht werden sollen. Auch darin gibt es eine Leistungsbeschreibung, die die Erwartungen der Auftraggeber umreisst.
Wenn bei einem solchen Projektstand der Geschäftsführer des Umwelthauses, Herr Charalambis, über einen bunt zusammengewürfelten Mailverteiler zu einem "Austausch zwischen den Bürgerinitiativen und dem FFR" einlädt, bei dem 45 Minuten für Präsentation und Diskussion von "Schwerpunktsetzungen und Denkansätze zur Untersuchung von UFP aus Sicht der Bürgerinitiativen" vorgesehen sind, dann ist klar, dass es da nicht wirklich darum gehen kann, "Gemeinsamkeiten und Unterschiede in unseren Sichtweisen herauszuarbeiten und ggf. zu diskutieren". Selbst im Umwelthaus, das von den Belangen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ziemlich weit entfernt ist, dürfte bekannt sein, dass es innerhalb der BIs notwendigerweise unterschiedliche Interessenlagen und Anschauungen gibt und eine einheitliche Sichtweise zu etwas, was bis vor ein paar Wochen fast so etwas wie ein Geheimprojekt war, nicht existieren kann. (Die letzte öffentlich einsehbare Darstellung des Projekts war eine Präsentation in der Sitzung der Fluglärmkommission am 17.02.2021. Zwar sitzen im Konvent des FFR, der die wesentlichen Fragen dazu diskutiert, auch Vertreter*innen von Kommunen, Parteien und Verbänden, aber auch von denen dringt in der Regel nichts an die Öffentlichkeit.)
Entsprechend verlief dann auch das Treffen am 11.07.22. Vor knapp 30 Teilnehmer*innen, je eine Hälfte Projekt-Beteiligte und BI-Mitglieder, in Präsenz im 'Airport Garden Loft' in Raunheim und Online stellten zunächst Herr Charalambis und Frau Rose vom HLNUG bisherige und geplante Aktivitäten vor, bevor BI-Mitglieder ihre Statements zu unterschiedlichsten Aspekten des Projekts abgaben. Herr
Wörner, den das Umwelthaus für die Moderation reaktiviert hatte, machte sich einen Spass daraus, aufzuzeigen, dass er in Letzteren sowohl das Eine als auch das Gegenteil davon gehört hätte, und verteilte ein paar Streicheleinheiten an die, deren Beiträge ihm zumindest teilweise gefallen hatten.
Für die BIFR hatten wir gemäß dem Wunsch von Herrn Charalambis einige Materialien vorher eingereicht, darunter unseren
Forderungskatalog von 2017 und eine knappe
Zusammenfassung dessen, was wir im letzten Jahr
als notwendig beschrieben hatten. Geholfen hat es nicht, denn zumindest Herr Wörner hatte nichts davon gelesen, und was er dazu gehört hat, hat ihm nicht gefallen, also gab es keine Diskussion darüber.
Immerhin wurde in Aussicht gestellt, dass die BIs vielleicht nochmal zum Plausch eingeladen werden, wenn alle wichtigen Entscheidungen über die Wirkungsstudie gefallen sind. Vielleicht sind bis dahin sogar wirklich alle wichtigen Dokumente auf der
Projekt-Webseite zu finden, und wenn es richtig gut läuft, gibt auch das
Transparenzpapier wenigstens einen halbwegs aktuellen Stand wieder. Dann könnte sich die Öffentlichkeit zumindest ein bißchen ernst genommen fühlen.
Wo aber steht das Projekt aktuell? Die Qualität des Gesamtprojekts steht und fällt natürlich mit der möglichst genauen Erfassung der räumlichen und zeitlichen Verteilungen der Immissionen und damit der Belastungen, denen die Menschen ausgesetzt sind. Nur wenn man einigermaßen genau weiss, wer wann und wie lange und in welchem Umfang einem bestimmten Stressfaktor ausgesetzt war, hat man überhaupt eine Chance, abzuschätzen, welche Bedeutung dieser Stressfaktor für die Gesundheit gehabt haben könnte (und selbst dann ist es noch schwer genug). Genau hier liegen aber auch die Probleme des bisherigen Projektansatzes.
Grundlage der Belastungsbeurteilung ist die sog. Immissionskartierung, d.h. eine flächendeckende Bestimmung, wo wann wieviel und welche Art von ultrafeinen Partikeln in der Atemluft der Menschen zu finden sind. Da flächendeckende Messungen unmöglich sind, muss dafür ein Modell entwickelt werden, das berechnen kann, wie sich UFP aus den jeweils vorhandenen Quellen unter Berücksichtigung von meteorologischen (Wind, Niederschlag usw.) und geografischen (Oberflächenbeschaffenheit, Hindernisstrukturen usw.) Parametern ausbreiten, verändern und am Boden ankommen. Um ein solches Modell entwickeln zu können, muss man erstens alle wesentlichen Prozesse verstehen, die die UFP-Ausbreitung und -Umwandlung beeinflussen, und zweitens genügend Meßergebnisse an den richtigen Stellen haben, um die Qualität des Modells bewerten zu können. Genau daran ist das
Vorgängerprojekt am Frankfurter Flughafen gescheitert.
In der Frage, wo, wie und was gemessen werden soll und wie diese Messungen auszuwerten sind, gab es von Anfang an
Differenzen. Das war schon bei der Veröffentlichung der
ersten Meßwerte des HLNUG in Raunheim im Jahr 2016 so und setzte sich bei allen neuen Ergebnissen fort, ob sie nun
von BIs oder
vom HLNUG geliefert wurden.
Das Interesse der Luftverkehrswirtschaft und ihrer Lobbyisten war dabei erstens, den Blick auf das Flughafengelände als Quelle zu beschränken, und erst, als das HLNUG aufgrund seiner Messungen in seinem
2. Zwischenbericht eindeutig feststellte: "Das Gebiet, auf dem ultrafeine Partikel aus Flugzeugtriebwerken freigesetzt werden, die dann auch Auswirkungen auf die bodennahen UFP-Konzentrationen haben können, beschränkt sich nicht nur auf das Flughafengelände selbst, sondern erstreckt sich auch entlang der Anfluglinien", war man zähneknirschend bereit, auch noch ein paar Kilometer Anfluglinie einzubeziehen. In der
Leistungsbeschreibung der Belastungsstudien-Designstudie liest sich das so: es sei "zu klären, wie weit sich UFP vom Flughafen ... in das Umland ausbreiten und bis zu welcher Flughöhe UFP-Emissionen von startenden und landenden Luftfahrzeugen für Immissionen auf Bodenniveau relevant bzw. nachweisbar sind", und dabei bleibt es auch trotz einiger vorsichtiger Hinweise im Studiendesign und der Stellungnahme der Qualitätssicherung, dass mehr nötig sein könnte.
Zweitens ging es immer darum, die Rolle der kurzzeitigen Immissionspeaks herunterzuspielen, die unter den Anfluglinien durchaus Grössenordnungen von mehreren Hunderttausend Partikeln pro Kubikzentimeter erreichen können. Solche Peaks könnten durchaus
drastischere gesundheitliche Folgen haben, als die über längere Zeiträume gemittelte Anzahlkonzentration erwarten liesse. Auch hier bleibt es aber dabei, dass zeitlich hochauflösende Messungen garnicht oder zumindest nicht an den richtigen Stellen stattfinden werden.
Der letzte Punkt ist besonders relevant, wenn man die spezifischen gesundheitlichen Risiken von UFP aus Flugzeugen gegenüber andern Quellen untersuchen will. Das Institut für Atmosphäre und Umwelt der Frankfurter Universität hat beispielsweise in an der HLNUG-Station Schwanheim gesammelten UFP eine ganze Reihe von
Flugzeugturbinen-spezifischen Stoffen, darunter auch eindeutig neurotoxische Substanzen, nachgewiesen. Ob sie in gesundheitlich relevanten Mengen in der Atemluft von Menschen vorkommen, wäre noch zu überprüfen. Wahrscheinlich ist aber, dass Menschen, die immer wieder (z.B. bei jedem Überflug), wenn auch nur kurzzeitig, extrem hohen UFP-Konzentrationen ausgesetzt sind, die diese Stoffe transportieren, ein deutlich höheres Risiko haben, relevante Mengen davon aufzunehmen.
Aber das möchte das FFR ohnehin nicht so genau wissen. Während das "detaillierte Konzept" für die Belastungsstudie immerhin noch einen eigenen Abschnitt "Toxikologische Messungen" enthält (wenn auch nur als Vorschlag für ein 'Ergänzungsmodul'), kommt sowas in der Leistungsbeschreibung nicht mehr vor. Und was man nicht gemessen hat, dessen Wirkung kann man auch nicht untersuchen.
(Nebenbei bemerkt: es würde sich natürlich anbieten, aufgenommene Mengen und gesundheitliche Folgen an einem Kollektiv zu untersuchen, das dieser Quelle primär und dauerhaft ausgesetzt ist: die Beschäftigten am Frankfurter Flughafen. Aber man kann sich denken, was Fraport davon hält.)
Dass es auch ein Fehler (bzw. eine absichtliche Auslassung) ist, die Emissionen der Flugzeuge nicht im gesamten An- und Abflug in der Region zu untersuchen, verdeutlich eine
neuere Arbeit aus dem Karlsruhe Institut für Technologie. Dort werden seit fast 20 Jahren Meßflüge mit Leichtflugzeugen durchgeführt, um die Verteilung ultrafeiner Partikel in der unteren Atmosphärenschicht zu untersuchen. Die aktuelle Veröffentlichung beschäftigt sich zwar hauptsächlich mit den klimatischen Wirkungen der UFP und berücksichtigt Flugzeugemissionen nicht, macht aber deutlich, dass UFP, die in grösserer Höhe in die atmosphärische Mischungsschicht emittiert werden, konvektiv nach oben, aber auch nach unten zum Boden transportiert werden können. Da Flugzeugemissionen durch die Wirbelschleppen ohnehin schon einen Impuls nach unten haben, kann man davon ausgehen, dass davon auch bis in Höhen von weit über 1.000 Metern einiges unten ankommen kann, wenn auch nicht direkt unter der Flugroute, sondern eventuell in grösserer Entfernung.
Messungen vertikaler Höhenprofile soll es aber im Projekt hauptsächlich dazu geben, die "Vertikalverteilung der Partikel in der Abluftfahne des Flughafens" zu messen, und das bevorzugt mit Türmen, deren Höhe natürlich sehr begrenzt ist. Der "Einfluss von An- und Abflügen bzw. Überflügen" und die Nutzung von "leichten, unbemannten Flugkörpern (Unmanned Aerial Vehicle, UAV)" werden zwar erwähnt, ohne aber konkrete Anforderungen oder einen bestimmten Umfang zu definieren. Es wird auf das "detaillierte Konzept" verwiesen, das (auch wieder im 'Ergänzungsmodul') einen Standort in Schwanheim vorschlägt und ansonsten äusserst vage bleibt.
Man darf also davon ausgehen, dass ein relevanter Teil der Luftverkehrs-bedingten Immissionen im Projekt nicht erfasst wird.
Die oben schon erwähnte
Zusammenfassung unserer Forderungen an das Projekt konzentrierte sich genau auf diese beiden Punkte mit Vorschlägen für je ein Meßprojekt, das etwas mehr Klarheit bringen könnte. Das wäre einmal ein Meßfeld unter einer Endanflugstrecke (z.B. in Raunheim) mit vielen Partikelzählern großflächig und in der Höhe verteilt, um festzustellen, wie sich Wirbelschleppen und Partikel unter den anfliegenden Flugzeugen ausbreiten, wo sie am Boden ankommen und welche Konzentrationen sie dort kurz- und langfristig erzeugen. Dass Wirbelschleppen praktisch im ganzen Stadtgebiet am Boden ankommen können, wissen wir ja von
den Schäden, die sie bisher erzeugt haben.
Das zweite Projekt wären Vertikalprofile um die höheren Anflugstrecken herum, um herauszufinden, wohin sich diese Emissionen verteilen und wo sie ggf. ebenfalls am Boden ankommen könnten.
Natürlich waren diese Vorschläge nicht im Detail ausgearbeitet und würden in vollem Umfang durchgeführt wahrscheinlich einen erheblichen Teil der finanziellen Mittel des Gesamtprojekts verbrauchen. Sie sollten aber auch lediglich dazu dienen, wesentliche Mängel des bisherigen Projektdesigns zu verdeutlichen und die Diskussion darüber voranzubringen. Aber daran gab es nirgendwo Interesse.
Diese und weitere Mängel, von denen man einige sogar der Stellungnahme der "Wissenschaftlichen Qualitätssicherung" entnehmen kann, sind natürlich nicht zufällig, sondern entsprechen dem Interesse der Luftverkehrswirtschaft, die gesundheitlichen Folgen des Flugverkehrs nicht in allzu negativem Licht erscheinen zu lassen.
Man kann natürlich darauf hoffen, dass den durchführenden Wissenschaftler*innen trotz der schlechten Ausgangsbedingungen doch noch die eine oder andere interessante Aussage gelingt. Dies war ja bei der
NORAH-Studie durchaus der Fall, aber dort war auch die Belastungssituation deutlicher bestimmt, weil Lärm relativ einfach meßbar und erfahrbar ist. Ob auf der Basis der zu erwartenden unzureichenden Erfassung der Ultrafeinstaub-Belastung gesundheitliche Wirkungen halbwegs solide erfasst werden können, darf man getrost bezweifeln.
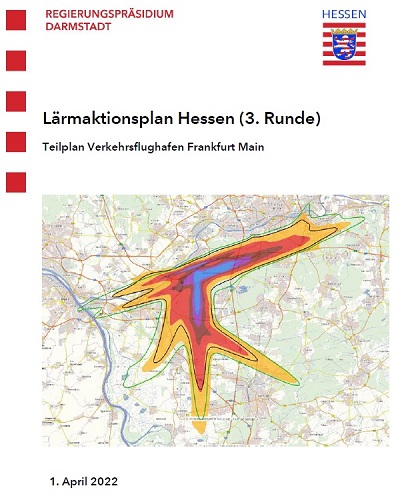
Das Titelblatt des Machwerks
(Bei der Übertragung ist eine Ziffer verloren gegangen,
aber so wird es dem Inhalt eher gerecht.)
28.04.2022
Wäre es ein
Theaterstück,
würden die Akteure wohl mit einem Pfeifkonzert von der Bühne gejagt werden. Zwar sind definitionsgemäß "unwahrscheinliche oder extravagante ... Situationen, Verkleidungen und Verwechslungen", mitunter auch "sprachlicher Humor inklusive Wortspielen" und vor allem "bewusste Absurdität oder Unsinn" durchaus vorhanden, aber es fehlt die "überraschende Wendung", die die Lösung bringt, und von "Happy End" kann ganz und gar nicht die Rede sein.
Wie wir aber bereits im Sommer letzten Jahres in
einem Beitrag anlässlich der "Öffentlichkeitsbeteiligung" zu diesem Plan erläutert haben, ist es eine Farce in der
metaphorischen Bedeutung dieses Wortes: eine "lächerliche Sache oder Szene, Unsinn, ein durch unangemessene Herangehensweise verfehlter, abgewerteter oder auch abwertender Vorgang".
Seit dem 11. April 2022 gibt es nun also einen neuen Lärmaktionsplan für den Flughafen Frankfurt, basierend auf den Lärmdaten des Jahres 2017. (Da der Plan nach EU-Vorgabe alle fünf Jahre erstellt werden muss, können die Verfasser*innen also gleich weitermachen und die Daten 2022 zusammenstellen, die dann so etwa im Jahr 2028 in einen neuen Plan einfliessen können.)
Gegenüber dem Entwurf hat die endgültige Fassung 29 Seiten mehr, die gebraucht werden, um zu begründen, warum die Vorschläge der Öffentlichkeit zum Lärmschutz nicht umgesetzt werden können, bzw. an wen sie für diese Begründung überwiesen wurden. Wesentlich Neues ist nicht zu finden.
Wie das RP mit Einwendungen von Betroffenen umgeht, wird exemplarisch in folgendem Absatz deutlich:
Dass eine mittlere Verwaltungsbehörde, deren gesetzlicher Auftrag hier darin besteht, "den Umgebungslärm so weit erforderlich und insbesondere in Fällen, in denen das Ausmaß der Belastung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann, zu verhindern und zu mindern" (Art.1 Abs. 1 c der
EU-Umgebungslärmrichtlinie), sich traut, in so dreister Weise die Profitinteressen des Flughafenbetreibers zum "öffentlichen Interesse" zu erklären und die Gesundheitsgefahren für die Anwohner vom Tisch zu wischen, hat Züge von obrigkeitsstaatlichem Größenwahn.
Andererseits wird eine Art von
schwarzem Humor deutlich, wenn es nur eine Seite weiter heisst: "Der Lärmaktionsplan setzt keinen Rahmen für die Entscheidung über die Zulässigkeit von (anderen) Vorhaben und auch die enthaltenen Maßnahmen und Festlegungen haben voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen" - insbesondere nicht auf den Umgebungslärm, der vom Flughafen ausgeht und mit dem Plan eigentlich reduziert werden sollte.
Das öffentliche Echo auf diesen Plan blieb verdientermaßen minimal. Lediglich die Frankfurter Rundschau
berichtete unmittelbar nach Veröffentlichung, konzentrierte sich dabei aber auf die Ablehnung einer Ausweitung der bestehenden Nachtflugbeschränkungen. Wohl deshalb wurde acht Tage später nochmal ein Artikel
nachgeschoben, der zwar grottenschlecht ist, aber zumindest in der Überschrift nach positiver Aktion klingt: "Kritischer Wert am Flughafen Frankfurt vereinzelt überschritten: Neuer Aktionsplan gilt".
Das erweckt zumindest den Anschein, als sollten mit dem Plan vorhandene Mißstände abgestellt werden. Aber welche Mißstände? Die erwähnten Überschreitungen sollen "in Frankfurt und Kelsterbach" auftreten. Als Raunheimer wundert man sich da natürlich. Was haben die, was wir nicht haben? Müssen wir neidisch werden?
Bei dem "kritischen Wert", um den es hier geht, handelt es sich um eine Empfehlung des Umweltbundesamtes aus einem
Konzept für einen "umweltschonenden Luftverkehr", dessen Kurzfassung wir schon bei Erscheinen vor über zwei Jahren
kritisiert hatten. Im Abschnitt 5.3.1 'Lärmkontingentierung' (S. 115) wird dort unter Bezug auf die wesentlich strengeren
Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO ein zaghafter erster Schritt gefordert: es soll "die Einhaltung eines maximalen LAeq, Tag von 63 dB(A) bis 2030 sichergestellt werden, um gravierende gesundheitliche Auswirkungen zu vermeiden".
Die Lärmaktionsplanung befürwortet dieses Ziel, denn es "war im Jahr mit den bisher höchsten Verkehrszahlen 2019 am Flughafen Frankfurt Main bereits weitgehend eingehalten, die Zahl von betroffener Wohnbevölkerung bei einem LAeq, 6-22 von mindestens 63 dB(A) lag ... bei unter 50 Personen" (S. 63). Auf S. 66 heisst es dann "28 Personen waren im Jahr 2019 von LAeq,T Pegelwerten größer gleich 63 dB(A) betroffen." Den nachfolgenden Tabellen kann man dann aber entnehmen, dass in Frankfurt 6 Wohnungen mit 13 Bewohnern und in Kelsterbach 22 Wohnungen mit 46 Bewohnern in Pegelbereichen über 65 dB(A) liegen.
Abgesehen von den widersprüchlichen Details handelt es sich hier um eine Empfehlung, die unmittelbar rein garnichts bewirkt und auch niemanden zu etwas verpflichtet, denn die vom UBA entwickelten Lärmkontigentierungsmodelle fallen in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes, der keinerlei Ambitionen in dieser Richtung hat.
Zur qualitativen Einordnung dieser Empfehlung kann man die Tatsache heranziehen, dass ein Durchschnittswert von 63 dB(A) in Raunheim bisher nur im
Horrormonat April 2019 erreicht wurde, als zu 70% Betriebsrichtung 07 geflogen wurde (was wir in diesem Jahr auch wieder erreichen werden, aber bei immer noch weniger Flugbewegungen und daher niedrigerem Monatspegel).
Werte über 60 dB(A) wurden auch sonst praktisch nur an der Meßstation in Raunheim erreicht. Da könnten die Flugbewegungen also durchaus noch kräftig steigen, bevor diese "Begrenzung" wirklich greift. Die WHO empfiehlt im übrigen einen Wert von 45 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts. Diese Werte werden allerdings praktisch im gesamten Rhein-Main-Gebiet überschritten.
Man könnte die Liste von Widersprüchen, Absurditäten und Unverschämtheiten weiter fortführen, aber es wird auch so deutlich: dieser "Lärmaktionsplan" ist nicht dafür da, die Situation der Flughafen-Anwohner in irgendeiner Weise zu verbessern. Er ist einerseits eine Pflichtübung, die dazu dient, EU-Vorgaben formal zu erfüllen, aber alle Schlupflöcher nutzt, um die eigentlich intendierten Ziele nicht angehen zu müssen. Er ist andererseits eine Alibi-Veranstaltung, die den Betroffenen, deren Gesundheit durch den Flugbetrieb gefährdet ist, Aktivitäten vorgaukeln soll, ohne auch nur das Geringste zu bewirken.
Positiv kann man bestenfalls vermerken, dass er eine Fleißarbeit ist, die nahezu alles zusammenträgt, was aktuell an offiziellen Regelungen, Planungen und Bewertungen zum Thema Fluglärm vorhanden ist. Stünde auf dem Titelblatt "Übersicht über die aktuelle Fluglärm-Politik von Bundes- und Landes-Regierung am Flughafen Frankfurt" oder etwas ähnliches, könnte man damit leben.
So aber ist es ein Dokument der politischen Heuchelei der hessischen Landesregierung, die vorgibt, die Anwohner vor Fluglärm zu schützen, während sie tatsächlich alle einschränkenden Auflagen für die Luftverkehrswirtschaft vermeidet. Von dieser ist aber keinerlei Zurückhaltung zu erwarten. Ohne klare ordnungsrechtliche Vorgaben wird sie versuchen, den Luftverkehr ohne Rücksicht auf Belange der Gesundheit oder des Schutzes von Umwelt und Klima weiter auszudehnen. Ein wirksamer Lärmaktionsplan kann daher nur von den Betroffenen selbst aufgestellt und umgesetzt werden, und die Aktionen werden auf der Straße, am Flughafen und überall dort stattfinden müssen, wo politischer Druck dafür erzeugt werden kann, dass am Tag weniger und in der Nacht garnicht geflogen wird.

Entfernungen und Windverhältnisse sprechen eindeutig für einen Wirbelschleppen-Schaden ...
(Für grössere Darstellung Grafik anklicken.)

... und das Ergebnis ist ebenfalls typisch: ein Loch im Dach und die Trümmer der Dacheindeckung
in der Umgebung verteilt.
12.04.2022
Während man anderswo gerade erst beginnt, Erfahrungen mit Wirbelschleppen-Schäden zu sammeln, gibt es in Raunheim einen neuen Fall an einer Stelle, wo man bereits reichlich Erfahrung damit hat. Am Werkstatt-Gebäude des Autohaus Hempel in der Karlstraße wurden am Sonntag, den 03. April, bereits zum vierten Mal Platten vom Dach gerissen.
Die Bedingungen waren passend für Wirbelschleppen-Schäden, wie man den ganzen Tag über immer wieder hören konnte. Das charakteristische Geräusch kurz nach einem Überflug ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Wirbelschleppen regelmäßig bis in Bodennähe absinken und dort im günstigsten Fall nur die Blätter zum Rauschen bringen, aber eben auch Schäden anrichten können.
Bei Windstärken etwas über 5 Knoten, einer Überflughöhe von knapp 300 Metern über Grund und 300 m seitlichem Abstand von der Anfluggrundlinie zur Südbahn können Wirbelschleppen das Firmengelände praktisch in voller Stärke erreichen. Der Wind kam zwar überwiegend aus nördlichen Richtungen, schwankte aber bereits stark, eher er zwei Stunden später endgültig auf südwestliche Richtungen drehte. Es war wohl einfach Pech, das gerade im falschen Moment die Bedingungen vorlagen, die die Wirbelschleppe zum Werkstatt-Dach trugen.
Da Zeugen, die mit Wirbelschleppen vertraut sind, den Vorfall direkt beobachten konnten und auch die genaue Uhrzeit notiert haben, ist der Fall relativ einfach zu rekonstruieren. Das verantwortliche Flugzeug war ein A320 der Lufthansa, dessen Überflug um 15:43:06 Uhr an der Lärmmeßstation Raunheim-Süd registriert wurde. Wegen der kurzen Entfernung konnten die Zeugen das Wirken der Wirbelschleppe noch in derselben Minute beobachten.
Dieser Flugzeugtyp ist nicht für besonders starke Wirbelschleppen bekannt, und die konkrete Maschine war auch mit sog. "Sharklets" ausgestattet. Das ist eine Airbus-spezifische Form der hochgeklappten Flügelspitzen, die den Luftwiderstand, der durch die Bildung der Wirbelschleppen für das Flugzeug entsteht, reduzieren sollen (sie sollen das Flugzeug auch leiser machen, aber das erkennt man im Lärmdiagramm auch nicht).
Es bestätigt sich hier die Erfahrung aus vielen anderen Fällen, wonach es keine Flugzeuge braucht, die vom Typ "Heavy" sind oder zu tief fliegen, um solche Schäden anzurichten. Bei ungünstigen Bedingungen kommt praktisch jeder normale Jet als Verursacher in Frage.
Fraport interessiert sich für solche Details allerdings überhaupt nicht. Ihr Gutachter wusste schon mit Blick auf das Loch im Dach und die herumliegenden Trümmerteile, dass
Fraport wohl nicht zahlen will, und kurz danach erhielten die Geschädigten auch
den ablehnenden Bescheid. Darin werden Ausführungen des Gutachters zum baulichen Zustand des Daches beschrieben, die dieser schon anläßlich der Fälle 2014 und 2020 gemacht habe, um daraus ohne jeden Zusammenhang zu schließen, die "gemeldeten Schäden sind aus technisch-sachverständiger Sicht nicht auf eine wirbelschleppenbedingte Windböe, verursacht durch ein im Landeanflug befindliches Luftfahrzeug auf den Flughafen Frankfurt-Rhein-Main, zurückzuführen".
Fraport vermischt hier Dinge, die nicht zusammen gehören, in der Hoffnung, dass die resultierende Argumentation für nicht mit der Materie Befasste doch noch irgendwie einleuchtend erscheint. Fakt ist aber, dass der Anspruch auf Schadensregulierung nichts mit der Qualität des geschädigten Dachs zu tun hat.
Dieser Anspruch beruht auf einer Nebenbestimmung des Planfeststellungsbeschlusses von 2007. Dort heisst es: "Die Vorhabensträgerin wird verpflichtet, nachweislich durch eine Wirbelschleppe eines auf dem Flughafen Frankfurt Main landenden oder startenden Luftfahrzeugs verursachte Schäden auf ihre Kosten zu beseitigen oder die angemessenen Kosten der Schadensbeseitigung zu erstatten." Hier ist nicht die Rede von irgendwelchen Qualitätsstandards, es geht nicht einmal nur um Dächer - Fraport muss alle Wirbelschleppen-bedingten Schäden ersetzen. Im Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshof zu den Klageverfahren gegen den PFB von 2009 heisst es weiterhin: "Diese Nebenbestimmung hat der Beklagte durch Erklärung in der mündlichen Verhandlung dahingehend abgeändert, dass nunmehr die Beigeladene nachzuweisen hat, dass bei Schadenseintritt die Voraussetzungen dieser Verpflichtung nicht erfüllt sind", oder im Klartext: der Minister verpflichtet Fraport, zu beweisen, dass aufgetretene Schäden nicht durch Wirbelschleppen verursacht worden sind, wenn sie nicht zahlen wollen. Einen solchen Beweis aber gibt es nicht und kann es im vorliegenden Fall auch nicht geben.
Qualitätsstandards für Dächer gibt es nur
in den Planergänzungen von 2013 und 2014, die die vorbeugende Dachsicherung gegen Wirbelschleppenschäden regeln. Aber darum geht es hier, zumindest im ersten Schritt, nicht.
Dieser Fall ist ein weiteres krasses Beispiel dafür, mit welcher Willkür Fraport die Schäden, die der Flugbetrieb der Bevölkerung im Umland des Flughafens auferlegt, ignoriert, leugnet oder übergeht und dabei auch geltendes Recht bricht. Eine funktionierende Rechtsaufsicht, die solches Verhalten unterbinden müsste, gibt es offensichtlich nicht.
Es wäre allerhöchste Zeit, dass das zuständige Wirtschaftsministerium durch gerichtliche Entscheidungen und öffentlichen Druck dazu gezwungen wird, seine Haltung zu korrigieren, den Geschädigten zu ihrem Recht zu verhelfen und das Verfahren zur Regelung solcher Schäden der Fraport zu entziehen und in unabhängigere Hände zu legen.
21.02.2022
Am 13.02.
meldete das 'Redaktionsnetzwerk Deutschland': "Landeanflug auf BER: Flugzeug reißt Ziegel vom Dach – Frau beinahe erschlagen".
Im Folgenden heisst es noch zweimal, das Flugzeug sei "vermutlich zu tief geflogen", obwohl am Ende des Artikel die Deutsche Flugsicherung zitiert wird mit der Aussage: "Es gab keinerlei Auffälligkeiten hinsichtlich Flugspur und -höhe, beide waren korrekt und normal. Die Maschine ist exakt denselben Anflugwinkel geflogen wie alle anderen Maschinen auch", und die DFS weiss auch, "bei Schäden dieser Art handle es sich um Wirbelschleppenschäden".
Ein Flughafensprecher, der vorher noch mit der Aussage zitiert wird, "So etwas darf nicht passieren. Für so etwas gibt es Richtlinien, und das passiert auch nicht, wenn man die Richtlinien einhält", meint dazu, dabei "handle es sich um absolute Einzelfälle".
Nun gehören Verlogenheit und Verantwortungslosigkeit anscheinend zur Grundqualifikation eines jeden Flughafenbetreibers hierzulande, aber von einem 'Netzwerk für Qualitätsjournalismus' sollte man schon ein bisschen mehr Überblick und Einordnung erwarten können.
Natürlich hat die DFS völlig recht, dass es keinen besonderen Tiefflug braucht, um in Waltersdorf oder an ähnlich gelegenen Orten einen Wirbelschleppen-Schaden zu verursachen. Die planmäßige Flughöhe entlang des Ortes beträgt um die 150 Meter, und der Großteil der ziegelgedeckten Häuser ist nur wenige hundert Meter von der Anfluggrundlinie entfernt - da ist es nur eine Frage der Zeit, bis geeignete Windbedingungen eine Wirbelschleppe so übers Ort tragen, dass sie Schaden anrichtet. Da die neuere Südbahn des BER noch nicht allzu lange in Betrieb ist (seit 04.11.2020) und der Flugverkehr auch dort bisher Pandemie-bedingt deutlich reduziert war, hat es eben bis jetzt gedauert, bis ein drastisch sichtbarer Schaden entstanden ist.

Natürlich ist jeder Schaden ein Einzelfall, aber die von Flughafenbetreibern ständig wiederholte Behauptung, dass es sich dabei um extrem seltene Ereignisse handele, ist trotzdem eine Lüge. Die grundlegenden Fakten zu diesem Risiko sind
seit Jahrzehnten bekannt, und es ist ein Skandal, dass bis heute bei Flughafen-Neubauten oder -Erweiterungen Vorsorge dagegen erst dann getroffen wird, wenn die Schäden sich häufen und die Betroffenen aufschreien.
Hier ist der Gesetzgeber gefordert, endlich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass in den Risikogebieten, die es an praktisch allen deutschen Flughäfen gibt, Vorsorgemaßnahmen ähnlich dem Dachklammerungs-Programm in Raunheim und Flörsheim auf Kosten der Flughafenbetreiber, aber
nicht in deren Regie
durchgeführt werden. Das ist zwar nur ein unzureichender erster Schritt, aber er könnte Leben retten. Schließlich ist nicht garantiert, dass auch künftig die Ziegel immer knapp daneben oder kurz vorher oder nachher dahin fallen, wo Menschen unterwegs sind - die
Liste der kritischen Fälle ist schon rund um FRA lang genug.
Dafür reicht es allerdings nicht, wenn der Besitzer des betroffenen Hauses in einem (leider schon nicht mehr verfügbaren) rbb-Video fordert, dass "gegen diesen Vorgang Maßnahmen eingeleitet werden, damit die Bürger geschützt werden". Notwendig wäre, überall rund um die Flughäfen ein Bewußtsein für die potentiellen Gefahren zu schaffen (und gerade rund um den BER gibt es noch eine ganze Reihe bewohnter Gebiete, die betroffen sein könnten). Eine bessere Vernetzung der BIs, die sich gegen die von Flughäfen verursachten Schäden wehren, könnte dazu beitragen, dass es nicht überall wie um FRA mehr als hundert Schadensfälle braucht, bis Maßnahmen dagegen getroffen werden.
Beim passiven Schallschutz konnten die BIs rund um den BER
einiges durchsetzen, worauf wir in Rhein-Main immer noch warten. Vielleicht könnte es ja auch beim Schutz vor Wirbelschleppen bessere Lösungen geben, die dann anderswo als Vorbild dienen könnten. Bedarf dafür gibt es genug.
20.02.2022
Wer sich gegen die Belastungen durch Fluglärm, Schadstoff-Emissionen von Flugzeugen und Klimaschäden wehren will, muss sich zwangsläufig auch mit den gesetzlichen Regelungen dafür auseinandersetzen - und mit denen, die sie beeinflussen können.
Nun sind einzelne, speziell neu gewählte Abgeordnete nicht verantwortlich für den Wust an unzureichenden Gesetzen, den es gibt, und sie haben auch nur begrenzte bis keine Möglichkeiten, daran etwas zu ändern. Dennoch macht es durchaus Sinn, mit denen, die bereit sind, zuzuhören, in Kontakt zu treten, die eigenen Argumente und Forderungen vorzutragen und zu hören, welche politischen Widerstände ihnen im Parlament entgegenstehen.
Wir waren deshalb hoch erfreut, dass die direkt gewählte Abgeordnete des Kreises Gross-Gerau,
Frau Melanie Wegling (SPD), auf eine Mail unserer BI, mit der wir als Mitglied des Netzwerks "Stay Grounded" die Forderungen der Kampagne
#Greenwashing stoppen - Flugverkehr jetzt reduzieren! an lokale Politiker*innen weitergeleitet hatten, (als Einzige!) geantwortet und ein Gespräch angeboten hat.
Dieses Gespräch hat am 11.02. Pandemie-bedingt in Form einer Video-Konferenz stattgefunden. Themen waren 'Klimawirkungen des Luftverkehrs', 'Fluglärm' und 'Belastung durch Ultrafeinstaub', und es gibt auch eine gemeinsam abgestimmte
Erklärung dazu, denn im Gegensatz zu den Lobbyisten der Luftfahrtindustrie und anderer Branchen halten wir nichts von Hinterzimmer-Treffen und "vertraulichen Gesprächen", in denen Deals ausgehandelt werden, die den Beteiligten nützen und anderen schaden.
Was sich daraus ergibt, wird sich zeigen. Wer diesen Kontakt ebenfalls nutzen möchte: Frau Wegling unterhält in Gross-Gerau ein
Wahlkreisbüro, wo sich Frau Eckert und Herr Schollmeier um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kümmern.
Auch in der letzten Legislaturperiode gab es schon Kontakte in den Bundestag. Da saß
Jörg Cezanne aus Mörfelden-Walldorf für DIE LINKE im Verkehrsausschuss und in eben jenem parteiübergreifenden 'Arbeitskreis Fluglärm', den Frau Wegling wiederbeleben will. Auch zu
Sabine Leidig, LINKE aus Kassel und verkehrspolitische Sprecherin, gab es vereinzelt Kontakt. Beide sind nicht mehr im Bundestag, aber
Janine Wissler hat das
Wahlkreisbüro von Jörg Cezanne in Gross-Gerau übernommen und bereits zugesichert, dass die Kontakte weitergehen sollen.
Da aber die Linke als Oppositionspartei wenig Einfluss auf das Geschehen im Parlament hatte und heute, deutlich geschrumpft, noch weniger hat, ist daraus auch weiterhin bestenfalls die eine oder andere nützliche Information zu erwarten. Auch der 'Arbeitskreis Fluglärm' war in der Form, wie er in der letzten Periode gearbeitet hat, weitestgehend bedeutungslos. Wenn sich das ändern soll, müsste er sich deutlich anders aufstellen.
Themen, die zu bearbeiten sind, gibt es mehr als genug, allen voran natürlich die bisher noch völlig unzureichenden Vorhaben der Ampel beim Klimaschutz. Aber auch beim Fluglärmschutz und beim Kampf gegen die Luftverschmutzung wären (kleine) Fortschritte denkbar, wenn die Empfehlungen der zuständigen Fachbehörden endlich, anders als bei der GroKo, ernst genommen würden.
Insbesondere beim Fluglärmschutz müssten die
dürftigen Absichtserklärungen im Koalitionsvertrag mindestens ersetzt werden durch einen Bezug auf eine
realistische Analyse des Umweltbundesamt und den
Instrumentenkoffer, den die ADF zusammengestellt hat. Und bei der Grenzwertsetzung für Luftschadstoffe und dem notwendigen Ausbau der Überwachungssysteme müssten mindestens die
Empfehlungen der WHO zugrunde gelegt werden, die bisher noch nirgendwo (ausser natürlich bei Fachbehörden wie
dem UBA)
erwähnt sind.
Aber auch hier gilt natürlich: Politiker*innen die Forderungen zu erläutern ist das eine. "Der Politik" deutlich zu machen, dass viele diese Forderungen umgesetzt haben wollen, ist das wesentlich wichtigere, damit diejenigen, die das umsetzen wollen, überhaupt erst die Möglichkeit dafür bekommen. Anders gesagt: eine gute, öffentlichkeits-wirksame Aktion ist mehr wert als ein Dutzend Gespräche.
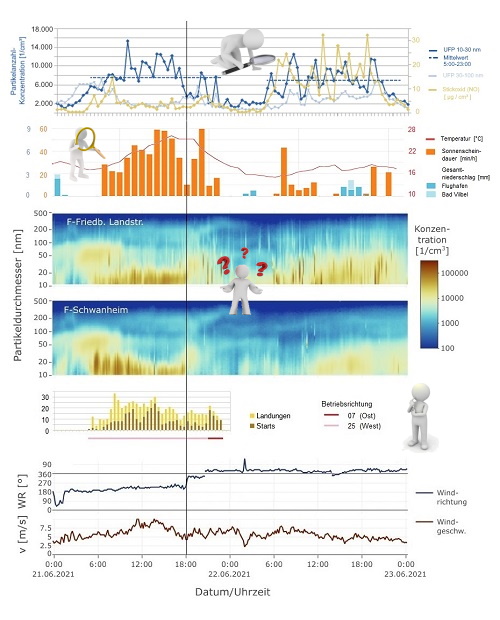
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - und wenn man die richtigen Bilder wählt, kann man auch zu vernünftigen Aussagen kommen.
06.02.2022
Am 13. Januar dieses Jahres hat das 'Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geowissenschaften' (HLNUG) den
4. Bericht "zur Untersuchung der regionalen Luftqualität auf ultrafeine Partikel im Bereich des Flughafens Frankfurt" veröffentlicht - laut
Pressemitteilung mit der Kernaussage "Bei Wind aus Richtung Frankfurter Flughafen steigt die Konzentration ultrafeiner Partikel in der Luft stark an". Es handele sich um eine " Gesamtauswertung", für die "alle bisherigen Messreihen zu ultrafeinen Partikeln (UFP) seit 2017 zusammengefasst" wurden.
Sind damit alle offenen Fragen bezüglich der Ausbreitung ultrafeiner Partikel aus dem Flugbetrieb in der Region, und im Umfeld von Flughäfen allgemein, geklärt? Leider nein. Der Bericht präsentiert weder Meßergebnisse, aus denen neue Erkenntnisse abzuleiten wären, noch halten die vorgelegten Auswertungen einiger weniger ausgewählter Daten einer wissenschaftlichen Überprüfung stand.
Tatsächlich wäre dieser Anspruch ohnehin zu hoch, denn der Bericht präsentiert nur mehr oder weniger plausible Überlegungen, aber keinerlei statistische Auswertungen, die über einfache Aufsummierung und Mittelwertbildung hinaus gingen. Etliche der vorgetragenen Aussagen bestehen aber auch eine Plausibilitätsprüfung nicht.
Kernproblem ist allerdings, dass garnicht mehr versucht wird, die Ausbreitung der ultrafeinen Partikel aus den möglichen Quellen zu diskutieren und die gewählten Annahmen zu begründen. Vielmehr wird als Ergebnis vorhergehender Berichte festgestellt: "Die Emissionen aus Triebwerken erzeugen sehr viele sehr kleine Partikel (< 30 nm). Diese führen im Umfeld des Flughafens zu Zeiten mit Flugbetrieb und bei Wind aus Richtung Flughafen zu einer deutlichen Erhöhung der UFP-Konzentration. Hierbei wurden Emissionen auf dem Flughafengelände und in unmittelbarer Umgebung des Flughafens als dominante Quelle für UFP identifiziert".
Daraus wird dann ohne weitere kritische Betrachtung: "Den Emissionen aus dem Flugbetrieb und den damit assoziierten Prozessen können an unterschiedlichen Messstellen jeweils sehr ähnliche charakteristische Merkmale zugeordnet werden. Neben der deutlichen Windrichtungsabhängigkeit, die sich ausschließlich zu Zeiten des Flugbetriebs einstellt, ist vor allem die typische Partikelanzahl-Größenverteilung mit ausgeprägtem Maximum für Partikel kleiner als 30 nm kennzeichnend. Dieser charakteristische „Fingerabdruck“ konnte bislang an allen HLNUG-Messstellen mit größenaufgelösten UFP-Messungen eindeutig nachgewiesen werden."
Kurz zusammengefasst: Die Emissionen auf dem Flughafengelände haben einen einfach nachweisbaren "Fingerabdruck", und wo der gemessen werden kann, ist auch der Einfluss des Flugbetriebs bewiesen. Und das ist sogar an einem durchgehend regnerischen Tag in 14 km Entfernung vom Flughafen kein Problem.
Die Emissionen kommen dabei nicht nur von den startenden und landenden Fliegern, sondern auch aus "mit dem Flugbetrieb assoziierten Prozessen" die dazu führen, dass die Partikel-Konzentrationen nach Ende des Flugbetriebs nur "langsam abklingen". Was das sein soll, wird nicht erläutert. Soll man wirklich davon ausgehen, dass am Tag vor Heiligabend nach 23:00 Uhr noch in großem Stil Triebwerksprobeläufe stattfinden, oder ist der Bodenverkehr da soviel emissions-intensiver als der Straßenverkehr in der Hauptverkehrszeit?
Der Bericht ist voll von derartigen unsinnigen Aussagen und anderen wilden Spekulationen. Um diesen Beitrag nicht mit technischen Details zu überfrachten, haben wir die Kritik zu den einzelnen Aussagen in einem eigenen Beitrag zusammengefasst (als Webseite oder PDF-Dokument). Daraus wird deutlich, dass dieser Bericht im Gegensatz zu den ersten beiden, die über weite Strecken überwiegend seriös argumentiert haben, ein ganz anderes Niveau hat. Hier findet sich keine einzige fundierte Auswertung, und die Qualität der Argumentation reicht von oberflächlich bis absurd.
Eine mögliche Erklärung für diese seltsame Veränderung findet sich in einem Satz im abschliessenden Kapitel "Ausblick": "Aufbauend auf den Ergebnissen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) führt das Forum Flughafen und Region (FFR) eine umfassende Untersuchung der Belastung durch UFP und deren potenziell gesundheitlicher Wirkung in der Rhein-Main-Region durch". Auch das Konzept dieser Untersuchung
wirft Fragen auf und weckt den Verdacht, dass es nicht um Erkenntnisgewinn, sondern um die Verhinderung unliebsamer Schlussfolgerungen geht. Wäre es anders, würde man aus den bisherigen, gescheiterten Projekten
entsprechende Schlussfolgerungen ziehen, aber genau das vermeidet dieser HLNUG-Bericht sehr konsequent.
Handelt es sich also um eine Auftragsarbeit, die helfen soll, das angekündigte Projekt in ungefährliche Bahnen zu lenken? Dagegen spricht, dass sich wohl niemand mit halbwegs wissenschaftlichem Anspruch auf so dünnes Eis begeben und eine Studie auf derart schwache Ergebnisse stützen würde.
Wahrscheinlicher erscheint da schon, dass es darum geht, möglichst wenig deutlich werden zu lassen, dass mit dem Meßprogramm der vergangenen zwei Jahre ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt wurde und der Nachweis, dass die UFP-Emissionen hauptsächlich vom Flughafengelände ausgehen, nicht nur wegen der Pandemie-bedingten Reduzierungen im Flugverkehr nicht erbracht werden konnte. Man behauptet einfach das Gegenteil und hofft, dass in ein paar Jahren niemand mehr darüber redet.
Wenn es so wäre, sollte das HLNUG diesen Bericht umgehend zurückziehen. Es ist keine Schande, eine Hypothese aufzustellen und dann festzustellen, dass sie falsch ist. Auch das trägt zum Erkenntnisfortschritt bei. Aber es ist extrem peinlich, unseriös und behindert weitere Erkenntnisse, zu versuchen, eine falsche Hypothese mit untauglichen Mitteln zu verteidigen, um Projektgelder nicht zu verlieren.
Hier muss dringend gegengesteuert werden, denn weitere Messungen sind unbedingt notwendig. Zwar muss man davon ausgehen, dass die im Bericht vorgestellten Meßwerte an den vom Flughafen weiter entfernten Stationen durch andere Effekte besser erklärt werden können und ein Einfluss des Flughafens, zumindest unter den Bedingungen deutlich reduzierter Flugbewegungen während der Pandemie, dort nicht nachweisbar ist. In Raunheim und Schwanheim sieht man diesen Einfluss allerdings deutlich, und, da hat der Bericht ausnahmsweise recht, es "ist zu vermuten, dass bei zunehmend steigenden Flugbewegungszahlen der Einfluss weiter steigen wird" (S.22) und dort und an vielen anderen Stellen gesundheitliche Schäden verursacht.
Hoffen lässt die Ankündigung: "Drei der UFP-Messstellen sollen darüber hinaus als permanente UFP Messstellen (Raunheim, F-Schwanheim, F-Friedberger Landstraße) eingerichtet und perspektivisch auch in das German Ultrafine Aerosol Network integriert werden. Ziel ist es, harmonisierte und kontinuierliche UFP-Messungen hoher Qualität für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung zu stellen". Es wäre ein großer Fortschritt, die hier präsentierten dilletantischen Spekulationen durch solide wissenschaftliche Analysen zu ersetzen und die bisher gesammelten Daten endlich in vernünftiger Weise zu nutzen. GUAN bietet beste Voraussetzungen dafür.
Auch der geplante Einsatz eines "Mobilitätspartikelspektrometer mit besonders hoher zeitlicher Auflösung ... zur Anwendung insbesondere im Umfeld schnell veränderlicher UFP-Konzentrationen" wäre dringend notwendig, um den Einfluss der Flugbewegungen genauer zu untersuchen.
Wichtig wäre allerdings, dass sich im HLNUG endlich wieder jemand seriös um dieses Projekt kümmert, ein realistisches Meßprogramm auflegt und dafür sorgt, dass dieses Gerät da zum Einsatz kommt, wo ein Einfluss des Flugverkehrs in grösseren Entfernungen an anderen Flughäfen tatsächlich gemessen wurde und auch hier zu erwarten ist:
unter den Anflugrouten im Osten und Westen des Flughafens. Wenn die Daten umfassend präsentiert werden, kann man sich auch wieder fachlich über die Interpretationen streiten.

Einer geht - aber im Kern ändert sich nichts.
12.01.2022
Die
Meldung kam überraschend und stiess auf große Medien-Resonanz:
"Ryanair, Europas größte Fluggesellschaft, hat heute (Freitag, 7. Januar) bestätigt, dass sie ihre Basis in Frankfurt am Main zum 31. März 2022 schließen wird und die fünf Flugzeuge auf Flughäfen umverteilt, die mit niedrigeren Flughafengebühren reagiert haben, um die Erholung des Flugverkehrs zu fördern", teilte die Ryanair-Pressestelle mit.
Auch der angebliche Grund dafür wurde deutlich genannt: "In einer Phase der Erholung von Covid müssen die Flughäfen Anreize für die Erholung des Verkehrs schaffen. Leider hat sich Frankfurt, anstatt Anreize für die Erholung des Verkehrs zu schaffen, dafür entschieden, die Preise noch weiter zu erhöhen, wodurch Frankfurt im Vergleich zu europäischen Flughäfen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Während Ryanair weiterhin in Deutschland investiert (wie die Investition von 200 Mio. USD in eine neue Basis in Nürnberg mit zwei Flugzeugen beweist), schützt die deutsche Regierung weiterhin etablierte Fluggesellschaften wie die Lufthansa, die 9 Mrd. EUR an staatlichen Beihilfen erhalten hat, anstatt diskriminierungsfreie Verkehrsrückgewinnungsprogramme einzuführen, die allen Fluggesellschaften offenstehen".
Damit haben alle, die nicht nach Ryanairs Pfeife tanzen, ihr Fett weg, und die meisten Medien
berichten wie gewünscht. Manche machen sich hauptsächlich
um Reisende und Angestellte Sorgen, aber meist gibt es auch ein paar kritische Anmerkungen, so z.B. dass Ryanair 2017
nur wegen des damaligen Incentive-Programms, das 2020 ausgelaufen ist, nach Frankfurt kam, oder dass der Ryanair-Anteil am Flugbetrieb in Frankfurt nur
im Schnitt bei rund drei Prozent gelegen hat.
Einige Wirtschaftsblätter weisen auch darauf hin, dass Ryanair
seine Wachstumspläne in der Mainmetropole niemals komplett realisieren konnte, oder benennen sogar Gründe,
warum Ryanair in Frankfurt gescheitert ist.
Auffällig ist allerdings, dass nirgendwo davon die Rede ist, dass Fraport in diesem Jahr durchaus ein
diskriminierungsfreies Verkehrsrückgewinnungsprogramm aufgelegt hat, das auch Ryanair nach anderthalb Jahren ohne Rabatte wieder Preisnachlässe gewähren würde. Natürlich sind diese Rabatte schwer kalkulierbar und von vielen externen Faktoren abhängig, aber wenn Ryanair seinen eigenen Prognosen glauben würde, müssten sie eigentlich davon ausgehen, dass es in Frankfurt im laufenden Jahr für sie nicht teurer würde als bisher. Wenn sie trotzdem weggehen, zeigt das nur, dass dafür andere Gründe maßgeblich sind.
Ohnehin hat Fraport ja den Entwurf der Entgeltordnung auch 2021 mit allen Beteiligten vorab abgestimmt, und anders als 2015, als das Ministerium
aufgrund eines Einspruchs der Airlines die Genehmigung ablehnte, hat diesmal wohl niemand offiziell protestiert.
Worum geht es also wirklich? Die oben zitierten Kernsätze aus Handelsblatt und Wirtschaftswoche deuten es an: Ryanair hat sich beim Versuch, am grössten deutschen Hub zu expandieren und hier relevante Marktanteile zu erobern, verkalkuliert. Die Basis konnte nicht auf die angekündigten hier zu stationierenden 20 Flugzeuge ausgebaut werden, sondern schrumpfte zuletzt auf nur noch fünf Maschinen. Auch der Marktanteil in Deutschland insgesamt blieb
mit 18,8% im Jahr 2019 hinter den Erwartungen zurück.
Nun korrigieren sie ihren Kurs, und das große Getöse dabei dient nur dazu, einerseits vom eigenen Scheitern abzulenken und andererseits
die immer gleichen Argumente erneut in die Öffentlichkeit zu bringen: der Luftverkehr braucht weniger Steuern, Gebühren und Auflagen, aber höhere Subventionen. Dabei zielt das Gerede von "effizienten Betriebsabläufen" und "wettbewerbsfähigen Gebühren" weniger auf Fraport - man
kennt sich schliesslich und weiss, was man voneinander zu halten hat - sondern vielmehr auf die (Provinz-)Flughäfen, die nun um die Ryanair-Gunst werben sollen.
Ähnlich seriös ist das Gerede von neuen "‘Gamechanger’-Flugzeugen", mit denen Ryanair das Wachstum in Europa ankurbeln will. Sie sind keineswegs neu im Sinn von fortschrittlich, sondern lediglich eine
schon 7 Jahre alte Modifikation eines
über 50 Jahre alten Flugzeugtyps, die unter dem alten Namen 'Boeing 737 MAX 8'
zwei Abstürze und einen Riesen-Skandal verursacht hat. Die Maschinen sind nach wie vor "inhärent instabil", aber mit einem schlechten Ruf, ein paar Sensoren mehr, einer neuen Software und vor allem mehr Sitzplätzen sind sie genau das, was Ryanair will: billig und profitabel. Die Umbennenung erfolgt nur
aus Image-Gründen.
Was bedeutet dieser Weggang nun für Fraport und die Rhein-Main-Region? Ein kleiner Rückblick hilft beim Verständnis. Fraport begann mit der
Endgeltordnung 2017, die bereits
im Jahr vorher angekündigte
strategische Orientierung auf
Billigflieger umzusetzen. Gleichzeitig wurde auch
Terminal 3 umgeplant, um dort einerseits einen Flugsteig speziell für Billigflieger einzurichten und zeitlich vorzuziehen, andererseits aber auch neue Luxus-Lounges für das Hochpreis-Segment zu integrieren. Inzwischen ist der Billig-Flugsteig
fast fertig, soll aber zunächst im "Ruhebetrieb" bleiben, bis etwa 2026 das gesamte Terminal fertig ist. Die Fraport-Strategie hatte von Anfang an
breite politische Unterstützung, auch wenn die etablierten Fluggesellschaften
Nachteile befürchteten und insbesondere Lufthansa
öffentlich auf Konfliktkurs ging. Dieser Konflikt wurde allerdings
relativ schnell beigelegt, weil Lufthansa zeitgleich Billigflieger-Geschäftsmodelle in ihren Konzern
integrierte und ausbaute, die bald auch auf FRA aktiv wurden.
Ryanair allerdings stand von Anfang an in der Öffentlichkeit
massiv in der Kritik, insbesondere wegen des extrem unsozialen Umgangs mit den Belegschaften und der häufigen Verletzung der Nachtflug-Beschränkungen, und hatte auch bald mit
diversen Krisenerscheinungen zu kämpfen. Nach
einigem Auf und Ab und zeitweisen Zugeständnissen an Belegschaften und Bevölkerung war der Krisenzustand mit der Corona-Pandemie wieder erreicht, und aktuell wird Ryanair von ihren Piloten nach wie vor als
Social Misfit (sozialer Aussenseiter) eingeschätzt, 75% der geplanten Flüge im Januar fallen aus, und am 31.03. ist in Frankfurt komplett Schluss.
Viel ändern wird sich dadurch nicht. Schon vor der Pandemie war klar, dass Ryanair zwar der auffälligste, aber bei weitem nicht
der lauteste Krachmacher war. Im Rekordjahr 2019 war die Zahl der Flüge nach 23:00 Uhr sogar
wieder zurückgegangen, und Ryanairs Anteil daran fiel nicht zuletzt deshalb, weil die Ferienflieger-Töchter des Platzhirschs Lufthansa inzwischen ebenfalls hier aktiv geworden waren. Die sollen, wenn die Pandemie es zulässt, in diesem Jahr
weiter expandieren. Mit Eurowings, Eurowings Discover, Wizz Air und den kleineren Aer Lingus, Blue Air und und Nouvelair sind nach wie vor einige explizite Billigflieger in Frankfurt aktiv, dazu kommen die Billig-Sektoren anderer "Premium-Airlines" und Charter-Flieger mit ähnlichen Geschäftsmodellen - genug, um Fraport hoffen zu lassen, den Billig-Teil ihres Terminal 3 auslasten zu können.
FRA wird
Tourismus-Hub bleiben wollen, und die Punkt- zu Punkt-Verkehre im Mittelstreckenbereich, die den Kern der Geschäftsmodelle der Billig- und Charter-Flieger bilden, werden, wenn die Planungen wahr werden, hier eine immer grössere Rolle spielen. Zwar haben die Billigflieger 2019
nur knapp 5% ihrer Flüge von deutschen Flughäfen über FRA abgewickelt, aber da Lufthansa-Töchter in Deutschland einen stabilen Marktanteil von rund 50% haben und auf FRA expandieren wollen, gibt es da noch viel Potential.
Der Weggang von Ryanair ist sicher kein Grund zur Trauer, aber auch kein Anlass für unbändige Freude. Ob sie nun
Auf Nimmerwiedersehen verschwinden oder irgendwann wieder hier auftauchen, wird im Wesentlichen davon abhängen, ob die Absicht der Fraport, immer mehr Verkehr auf FRA zu bündeln und die Bedingungen dafür so günstig wie möglich zu gestalten, umgesetzt werden kann.
Langfristig ist das unmöglich, denn wenn die Wachstumspläne der Luftverkehrswirtschaft umgesetzt würden, würde nicht nur die Region unbewohnbar, es gäbe auch keine Tourismus-Ziele mehr, die von der Klimakatastrophe verschont bleiben würden. Auf dem Weg dahin würde es allerdings schon bald so ungemütlich werden, dass es sich lohnt, jetzt schon dagegen vorzugehen. Und kurzfristig wird es, falls die Ferienflüge im Sommer tatsächlich wieder boomen, sowieso nachts wieder lauter - auch ohne Ryanair. Was die Region braucht, ist nicht der Austausch eines Billigfliegers gegen andere, sondern ein Nachtflugverbot von 22 - 6 Uhr und eine Deckelung der Zahl der Flugbewegungen auf ein Maß, das mit Gesundheits- und Klima-Schutz verträglich ist. Und dafür muss das Geschäftsmodell "Billig fliegen" insgesamt beerdigt werden.
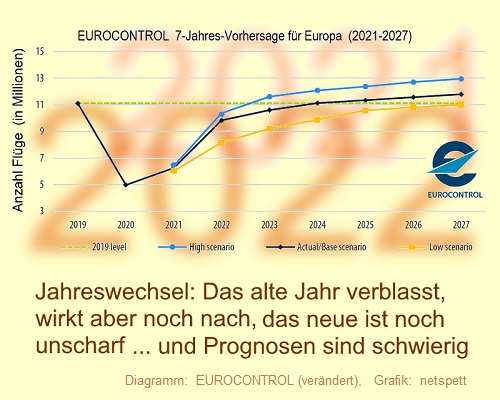
04.01.2022
Jahreswechsel sind üblicherweise Anlass, Bilanz zu ziehen: was hat das vergangene Jahr gebracht, was ist im neuen zu erwarten? Für Flughafen-Anwohner sind dabei besonders zwei Themenbereiche interessant: wie haben sich der Flugverkehr und seine diversen, meist negativen Wirkungen entwickelt, und was passiert in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion darüber?
Zum ersten Themenkomplex liefert ein aktuelles
Denkpapier von
Eurocontrol eine Menge statistischer Daten darüber, wie sich der Flugverkehr während der Pandemie entwickelt hat und welche Sektoren wie stark betroffen waren.
Demnach war 2021 "nicht substantiell besser" als 2020, obwohl alle Kennzahlen sich verbessert haben - aber eben nicht genug. Der Verkehr war europaweit 44% niedriger als 2019, im Norden mehr (-55% bis -62%), im Süden weniger (-8% bis -27%). Die finanziellen Verluste der Fluggesellschaften lagen immer noch bei knapp unter 20 Milliarden Euro, weil knapp 1,5 Milliarden weniger Passagiere befördert wurden.
Im Staatenvergleich hat Deutschland einen überdurchschnittlichen Rückgang in der Zahl der Flüge (-50%), aber absolut immer noch die höchste Gesamtzahl (knapp über 1 Million). Lufthansa fiel in den Top Ten der durchschnittlichen täglichen Flüge von Platz 3 auf Platz 4 und wurde von Turkish Airlines und Air France überholt, während easyJet von Platz 2 auf Platz 5 fiel. Auf Platz 1 blieb unangefochten Ryanair, trotz eines Rückgangs von 43%.
Von den 'Marktsegmenten' ist bemerkenswert, dass der Frachtflug um fast 10% zugelegt und seinen Marktanteil von 3% auf 6% verdoppelt hat. Auch der
Geschäftsflugverkehr ("Business Aviation") hat um 3,5% zugelegt und damit seinen Marktanteil ebenfalls fast verdoppelt (von 6,4% auf 12%). Die Geschäfts-Elite nimmt eben oft nicht die Videokonferenz, sondern den
wesentlich schmutzigeren Privat-Jet, wenn ein passender First-Class-Linienflug nicht zur Verfügung steht. Auch sog. "non-scheduled flights", also alles, was nicht nach Fahrplan fliegt, sondern individuell ausgehandelt wird, haben nur um knapp 8% abgenommen.
Entsprechend sind die drei Betreiber, deren Flüge 2021 gegenüber 2019 zugelegt haben, alle Frachtflieger. An der Spitze steht DHL mit einer Zunahme der Anzahl Flüge von 15%.
Auch ein paar Aussagen zur 'Nachhaltigkeit' gibt es. So wird stolz berichtet, dass der CO2-Ausstoss stärker zurückgegangen ist als die Zahl der Flüge (50% gegenüber 45,3%), u.a. deshalb, weil der Luftraum über Europa weniger überlastet war, weniger Verspätungen vorkamen und direktere Routen geflogen werden konnten. Rund 75% der Emissionen gingen auf das Konto von Langstreckenflügen (>1.500 km), die nur einen Anteil von 28,5% an der Gesamtzahl der Flüge hatten, während Kurzstreckenflüge unter 500 km mit etwa dem gleichen Anteil nur gut 4% zu den Emissionen beitrugen.
Auch kleine Fortschritte in der Flottenerneuerung werden berichtet, aber nicht quantifiziert. Die Schlussfolgerung aus alldem versuchen wir hier mal wörtlich zu übersetzen: "Während alle Luftfahrt-Akteure die Notwendigkeit verinnerlicht haben, nachhaltiger wieder aufzubauen, hat das Tempo der Veränderung - besonders bei der Bereitstellung nachhaltiger Treibstoffe - noch nicht begonnen zu beschleunigen". Das ist eine freundliche Umschreibung dafür, das alles so weitergehen soll wie vorher.
Entsprechend befassen sich die Prognosen damit auch garnicht, sondern konzentrieren sich darauf, welche Wachstumsraten bei der Zahl der Flüge erreicht werden könnten. Dafür werden drei Szenarien präsentiert, und sowohl das 'hohe' als auch das 'wahrscheinlichste' sagen in etwa das voraus, was Fraport durch finanzielle Anreize erreichen möchte: 2022 sollen bereits fast 90% der Zahl der Flugbewegungen von 2019 wieder erreicht werden, und spätestens ab 2024 soll der Verkehr wieder darüber hinaus wachsen. Im 'niedrigen' Szenario dauert es auch nur bis 2027, bis dieser Punkt wieder erreicht ist. Von notwendigen Beschränkungen für den Schutz das Klimas also keine Spur.
In Politik und Gesellschaft sieht es nicht besser aus. Zwar geniesst die Klimaschutz-Bewegung nach wie vor breite Unterstützung in der Bevölkerung, die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich durch das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein gutes Stück verbessert, und es gab auch durchaus interessante Initiativen gegen die
Exzesse der Luftverkehrswirtschaft, aber politisch wirksam geworden ist davon wenig. Noch hat die Haltung der Parteien zur drohenden Klimakatastrophe wenig Einfluss auf die Entscheidungen des Wahlvolks, das sich diesbezüglich mit billigen Versprechungen, die die propagierten Ziele
nicht erreichen können, beruhigen lässt. Und für die praktische Politik hierzulande spielt insbesondere der Klimaschutz im Luftverkehr
für die neue Regierung so wenig eine Rolle wie
für die alte.
Bei den Themen
Schutz vor Fluglärm und
Schadstoff-Vermeidung hat man es ebenfalls häufig mit staatlichen Institutionen zu tun, die wenig zur
Lösung vorhandener Probleme beitragen oder sogar selbst noch
neue produzieren. Diese Probleme werden uns auch in diesem Jahr weiter begleiten.
Und auch auf europäischer Ebene geht es weiter wie gehabt. Die EU-Kommission hat die internationale Glaubwürdigkeit ihres viel beschworenen 'Green Deal' gerade massiv infrage gestellt mit einem
Hinterhof-Deal, der Investitionen in Nuklearenergie und fossiles Gas als "nachhaltig" einstufen will. Der Entwurf muss noch von Parlament und Rat abgesegnet werden, aber die Mehrheiten dürften sicher sein, zumal auch die Bundesregierung
keinen konsequenten Widerstand leisten will. Zwar spricht Vizekanzler Habeck in Bezug auf die Kernenergie von
Etikettenschwindel, aber Kanzler Scholz hat den Deal schon
gerechtfertigt, und 'Schattenkanzler' Lindner ist
zufrieden, weil "Technologie-Offenheit" ja generell das Zauberwort ist, mit dem die FDP die Wirtschaft vor allzu belastenden Klimaauflagen schützen will.
Dieser Vorschlag war auch deshalb zu erwarten, weil zwar niemand darüber redet, aber allen Beteiligten klar ist, dass Frankreich als einzig verbliebene offizielle Nuklearmacht in der EU ein ziviles Kernenergieprogramm
zur Absicherung des militärischen Programms braucht. Die neue Bundesregierung will zwar am Ausstieg aus der nuklearen Stromerzeugung in diesem Jahr festhalten, aber nicht vollständig aus der
zivilen Nutzung der Kernenergie aussteigen, und auch die Haltung zur militärischen Nutzung lässt
viele Fragen offen.
In der Luftverkehrspolitik dominiert ebenfalls das "Weiter so". Die EU-Kommission hat 2019 die
Evaluierung einer
Verordnung eingeleitet, die sie als "den grundlegenden Rechtsakt zur Organisation des EU-internen Luftverkehrs-Marktes" betrachtet. Sie "regelt die Genehmigung von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft, das Recht von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft, innergemeinschaftliche Flugdienste durchzuführen, und die Preisfestsetzung für innergemeinschaftliche Flugdienste". Da die Evaluierung Veränderungsbedarf ergeben hat, wurde gemäß dem üblichen Verfahren die
Überarbeitung eingeleitet.
Die in der Evaluation entwickelten Änderungsvorschläge sind noch, wie die gesamte Verordnung, eindeutig geprägt von der bisherigen ausschließlich
neoliberalen Orientierung der Luftverkehrspolitik der EU, die nur auf Wachstum, Privatisierung und Wettbewerb setzt. Umweltprobleme werden zwar, u.a. mit einem Verweis auf einen
Bericht der Europäischen Umwelt-Agentur, erwähnt, aber mit Hinweis auf
Maßnahmen wie den europäischen Emissionshandel und CORSIA abgetan.
Mit der Verabschiedung der
Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität Ende 2020 hat sich zumindest der Ton etwas geändert. Gemäß dem dort verankerten Grundsatz "Verkehrswachstum darf es künftig nur bei grüner Mobilität geben" enthalten alle Vorschläge der EU-Kommission zum Verkehrssektor nun zumindest einen Passus zur Vereinbarkeit mit dem 'Green Deal'. Infolge dessen enthält das erste für die Überarbeitung der Verordnung vorgelegte Dokument als mögliche Ziele auch Dinge wie "Nachhaltigkeitskriterien", "Luftverkehr auf einigen Strecken beschränken", "Fußabdruck von Flügen" transparent machen, "Messung der Emissionen aus Verkehr und Logistik" und ähnliches. Damit ist zumindest angedeutet, dass diese Verordnung der Ort sein könnte, an dem die Umsetzungen wichtiger Forderungen der Umwelt- und Klimabewegung, wie das Verbot von Kurzstreckenflügen, rechtlich verankert werden könnten.
Dass sich damit real etwas verändert, bleibt allerdings höchst zweifelhaft. Selbst wenn die Kommission hier vorpreschen und solche Ziele in die Verordnung hineinschreiben wollte, könnten das keine verbindlichen Vorgaben sein. In der derzeitigen Struktur könnte sie bestenfalls den Mitgliedsstaaten Möglichkeiten einräumen, Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele zu beschliessen.
Aber selbst dafür gibt es bisher kaum Unterstützung. Unter den
Rückmeldungen zu dem Sondierungs-Papier findet sich nur eine von
Greenpeace, die versucht, konkrete Vorschläge dafür zu machen, indem sie eine (eher bescheidene) Umformulierung des "Umwelt-Artikels" 20 der Verordnung vorschlägt. Damit sollen (zeitlich befristete) Betriebsbeschränkungen aus Umweltschutzgründen nicht mehr wie bisher erschwert, sondern erleichtert werden. Eine weitere
Stellungnahme von Bill Hemmings, früher in der NGO 'Transport & Environment' für den Bereich Luftfahrt tätig und heute unabhängiger Consultant, listet noch eine ganze Reihe umweltpolitischer Schwachstellen der Evaluation auf, formuliert aber kaum Alternativen.
Auf der anderen Seite bringt sich ein Heer von Luftfahrt-Lobbyisten,
allen voran der BDL, bereits in Stellung, um solche Ansätze von vorneherein abzuwürgen. Die Stellungnahme des 'Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur' (datiert vom 06.12., also möglicherweise noch von der alten Bundesregierung veranlasst) kümmert sich garnicht um Umweltfragen, sondern behandelt nur wirtschaftliche und finanzielle Aspekte.
Inwieweit sich daran in der nun anstehenden zweiten Phase der Überarbeitung, der Öffentlichen Konsultation, viel ändern wird, ist noch offen. Um den rechtlichen Rahmen für
Degrowth-Konzepte, wie sie schon seit einigen Jahren
für den Flugverkehr diskutiert werden, bilden zu können, müsste diese Verordnung komplett umgeschrieben werden. Die Aussichten, das in dieser Phase durchzusetzen, sind gleich Null.
Ob sich wenigstens die eine oder andere Änderung erreichen lässt, die weitere Verschlechterungen verhindern und Türen zu jetzt schon möglichen, punktuellen Maßnahmen öffnen könnte, wäre schnellstmöglich zu diskutieren. Natürlich wird auch z.B. ein Verbot von Ultrakurzstreckenflügen nicht im Gerangel um juristische Texte durchgesetzt. Wenn aber politische Mehrheiten dafür organisiert werden können, muss auch der juristische Rahmen angepasst werden, um solche Maßnahmen langfristig stabil zu verankern.
Auch 2022 wird es tausendmal wichtiger sein, mit der Klimabewegung auf die Strasse zu gehen, die Öffentlichkeit über die Folgen der Klimakatastrophe und die notwendigen Maßnahmen dagegen aufzuklären und politischen Druck für entsprechende Forderungen zu entwickeln. Das heisst aber nicht, dass es keinen Sinn machen würde, auch innerhalb institutioneller Strukturen Argumente und Forderungen vorzubringen und Druck zu machen. Es kann begleitend wirksam werden, Rahmenbedingungen verbessern - und es ist ein Betätigungsfeld für alle, die etwas gegen den Wachstumswahn der Luftverkehrswirtschaft tun wollen, die aber mit
Aktionen zivilen Ungehorsams,
direkten Aktionen u.ä. ihre Probleme haben.
Wer also bisher angesichts des Bergs an Problemen und der ausbleibenden greifbaren Erfolge nach dem alten Sponti-Motto gehandelt hat, "es gibt viel zu tun - nichts wie weg", sollte überlegen, diese Haltung zu ändern. Es ist sicher nicht zu früh - und vielleicht auch noch nicht zu spät.
Ältere Nachrichten befinden sich im Archiv.