

Hier sind alle Beiträge zu aktuellen Themen aus dem Jahr 2023 gesammelt.
An diesen Beiträgen werden keine Veränderungen mehr vorgenommen, auch Links werden nicht mehr aktualisiert.
Beiträge aus vorangegangenen Jahren befinden sich im Archiv.
20.12.2023
Was schon bei Vorlage des sog. "Eckpunkte-Papiers"
absehbar war,
hat sich bestätigt mit der Veröffentlichung des
Entwurfs des Koalitions-Vertrags,
der am 16.12.
von beiden Parteien abgesegnet
und am 18.12. als
"Hessenvertrag der DCS-Koalition"
in Wiesbaden
unterzeichnet wurde
(DCS: demokratisch-christlich-sozial, zwecks formaler Abgrenzung von christsozial, wie derartige Politik etwas weiter südöstlich genannt wird).
Den Ort der Unterzeichnung haben die Parteivorsitzenden nach eigener Aussage
bewusst gewählt,
er
"stehe für etwas Neues, Modernes",
für
"Modernität und Transparenz".
Und es hat wohl tatsächlich etwas Symbolisches, wenn ihnen das ausgerechnet zu einem privaten Museum für abstrakte Kunst, finanziert durch die Steuerspar-Stiftung eines reichen Unternehmers und im Volksmund
als Zuckerwürfel
verspottet, einfällt. Tatsächlich geht es ja auch bei den meisten "Innovationen" dieses Koalitionsvertrages darum, mit neuen Methoden Altes, Elitäres und Überlebtes zu erhalten.
Die autoritären, rückwärtsgewandten Tendenzen sind im vollen Umfang erhalten und in vielen Details noch verschärft, während die wenigen eher progressiven Ansätze allesamt im Unverbindlichen verbleiben und natürlich unter einem generellen (und hier ernstzunehmendem) Finanzierungs-Vorbehalt stehen. Daher müssen auch Medien wie die 'Frankfurter Rundschau' in
ihrer Analyse feststellen:
"Hessen rückt unter der schwarz-roten Regierung nach rechts".
Beim Blick auf
andere Reaktionen
stellen sie fest:
"Begeistert aber ist kaum jemand. Es überwiegen Skepsis und Kritik".
Dabei gilt allerdings für die Unternehmerverbände, dass sie ohnehin nie genug kriegen können, während andere im Hinblick auf kommende Auseinandersetzungen auch nach noch so schwachen Ansätzen suchen, die Grundlage für Forderungen sein können. Im Hinblick auf die Klima- und Umwelt-Politik stellt aber der BUND, wohl auch stellvertetend für andere,
lapidar fest:
"Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND Hessen) bewertet den Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen CDU und SPD als ein Dokument des umweltpolitischen Rückschritts."
Nun sind Koalitionsverträge generell keine Gesetzestexte, die man mit einiger Bestimmtheit auf mögliche Auswirkungen hin analysieren könnte, sondern bessere Wunschzettel, die lediglich etwas darüber aussagen, was die Verfasser den Regierten als ihre Absicht verkaufen wollen.
Wir beschränken uns daher bei der genaueren Betrachtung dieses Machwerks auf die für uns relevanten Punkte "Klimaschutz" und "Luftverkehr", um zu sehen, ob sich aus den längeren Texten noch etwas mehr über die zu erwartende Politik lernen lässt.
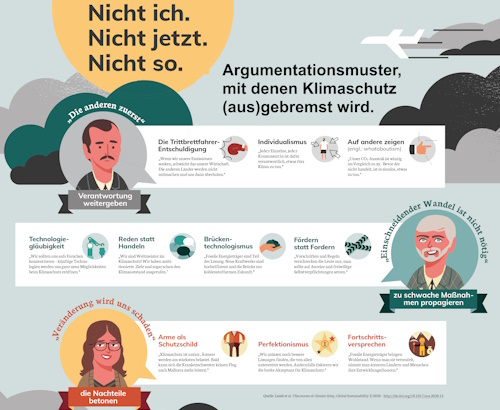
Die
Originalveröffentlichung,
aus der diese Grafik geklaut ist, listet Argumente auf, mit denen Klimaschutz ausgebremst wird.
(Für eine vergrösserte und mit passenden Zitaten aus dem KoaV ergänzte Grafik
auf die Grafik oben oder
hier
klicken.)
Aussagen zum Klima finden sich fast ausschliesslich in Kapitel 9 (S. 138) unter der Überschrift "Aus Nachhaltigkeit für Klima, Umwelt und stabile und erneuerbare Energie". Schon diese Formulierung, und erst recht der nachfolgende Text, lieferen Anlass zu Betrachtungen, inwieweit die Verfasser*innen dieses Vertrages die " Bildungssprache Deutsch", die ihnen im ersten Kapitel so wichtig ist, selbst beherrschen, aber sowohl Erkenntnisgewinn als auch Spaßfaktor sind zu gering, um den Aufwand zu lohnen.
Inhaltliche Aussagen sind ebenfalls extrem dürftig. Wo es halbwegs konkret wird, geht es im Wesentlichen darum, dass Vorgaben von Bundes- und EU-Ebene gesetzeskonfrom umgesetzt werden sollen (was anscheinend nicht selbstverständlich ist) oder dass vorhandene Projekte und Instrumente zumindest nicht völlig abgewürgt, manchmal sogar "konsequent weitergeführt", "gestärkt", "gefördert" oder "unterstützt" werden. Verbindlicher wird es nirgends.
Da sind die allgemeinen Aussagen zur Klimapolitik, mit denen das Kapitel eingeleitet wird, noch aussagekräftiger. Sie wirken wie abgeschrieben aus den Handreichungen der Fossilwirtschaft, mit denen die allzu primitive Leugnung des Klimawandels, wie sie die AfD noch vertritt, ersetzt werden soll durch eine Argumentation, die wirksame Klimaschutz-Politik ausbremsen und die Interessen der Fossil-Konzerne und der hinter ihnen stehenden Finanzwirtschaft sichern soll.
Von den vier
von der Sozialforschung identifizierten Strategien
kommen insbesondere zwei zur Anwendung.
"Nicht jetzt":
man behauptet, der Klimawandel sei auch ohne grundlegende, tiefgreifende Veränderungen und ohne sofort wirkende Maßnahmen abwendbar,
"Nicht so":
Klimaschutz sei sozial ungerecht oder bedrohe den Wohlstand, bessere technologische Lösungen würden in der Zukunft auch verträglichere Maßnahmen ermöglichen. Einige Beispiele dazu haben wir in der ausführlichen Version der nebenstehenden Grafik angeführt.
Dass diese Strategien immer noch hochaktuell sind, hat selbst die Tagesschau im Zusammenhang mit der gerade zu Ende gegangenen
Weltklimakonferenz COP28
festgestellt.
Man kann daher festhalten, dass die Klimapolitik dieser Koalition hauptsächlich die Interessen der Fossilwirtschaft, also der Öl- und Gas-Konzerne und all derer, deren Geschäftsmodelle von deren Produkten abhängen, sichern soll. Sie ist daher nicht nur nicht fortschrittlich, sie ist auch nicht konservativ, also auch nicht auf den Erhalt bestehender, zukunftstauglicher Bedingungen ausgerichtet. Sie ist reaktionär, also ein Versuch, überkommene, nicht zukunftsfähige Geschäftsmodelle aus ideologischen Gründen so lange wie möglich am Leben zu erhalten.
Mit den Aussagen zum Luftverkehr sieht es nicht besser aus. Sie verstecken sich in einem eigenen Unterkapitel des Kapitels 10,
"Aus Liebe für unsere Demokratie, unsere Heimat und Regionen, für Tradition und Kultur".
Wie man unter dieser Überschrift vom Vermächtnis der Frankfurter Nationalversammlung über technische Aspekte der Mobilität wieder zu "Heimat", "Demokratie", "Kultur", "Medien" und "Sport" kommen kann, ist eine weitere Merkwürdigkeit dieses Textes, deren Interpretation wir uns hier verkneifen müssen.
Beim Durchlesen der rund eineinhalb Seiten (S.157-158) fallen besonders die vielen Doppelungen auf. So endet der erste Absatz mit dem Satz
"Wir werden uns gegenüber der Fraport AG für gute Arbeitsbedingungen einsetzen",
der zweite mit
"Im Rahmen der Möglichkeiten wollen wir außerdem für gute Arbeitsbedingungen sorgen".
Das korrespondiert mit den Mehrfachaussagen im
SPD-Wahlprogramm,
wo es in einem Absatz heisst:
"Unter SPD-Führung wird sich die Flughafenpolitik stärker an Tarifbindung, Mitbestimmung, Anwohner- und Umweltschutz orientieren. ... Auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene werden wir uns dafür einsetzen, dass der Flughafen ein Garant für gute Arbeitsplätze ist. Auch um Fachkräfte an den Standort zu binden, wird sich die Flughafenpolitik unter SPD-Führung stärker an Tarifbindung, Mitbestimmung und Arbeitsbedingungen ausrichten.".
"Tarifbindung" und "Mitbestimmung" sind dem Kompromiss mit der CDU zum Opfer gefallen, der es nur um die Zahl der Arbeitsplätze geht, und
überfällige Verbesserungen
z.B. im Arbeitsschutz durch Reduzierung der Ultrafeinstaub-Belastung, oder die Forderung nach Einhaltung aller Normen und Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation ILO bei allen internationalen Beteiligungen der Fraport hat ohnehin keine der beiden Parteien auf dem Schirm.
Die nächste interessante Doppelung steht im 3. Absatz dieses Unterkapitels.
"Wir bekennen uns zur Stärkung des Flughafens Frankfurt/Rhein-Main auf der Basis des Planfeststellungsbeschlusses. Wir werden die darin festgelegten Auflagen zum Nachtflugverbot, den Betriebskonzepten und Eckwerten beachten und nutzen. Wir wollen den Flughafen in seiner Drehscheibenfunktion als Weltflughafen stärken, um Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen und sehen keine Eingriffe in den Planfeststellungsbeschluss vor."
Den Planfeststellungsbeschluss von 2007 für unantastbar zu erklären, ist schon lange ein Kernanliegen der CDU, die dazu in ihrem
Wahlprogramm geschrieben hat:
"Wir bekennen uns zur Stärkung des Flughafens Frankfurt/Rhein-Main auf der Basis des Planfeststellungsbeschlusses."
Hier dient die doppelte Betonung wohl dazu, der SPD klarzumachen, dass sie selbst solche diffusen Aussagen aus ihrem Wahlprogramm künftig vergessen kann:
"Wir werden alle Möglichkeiten nutzen um ein Maximum an Lärmschutz für die Region zu erreichen, ohne den Standort einseitig zu benachteiligen. Dazu gehören rechtssichere Lärmobergrenzen und ein Nachtflugverbot Plus am Frankfurter Flughafen. Im Rahmen des rechtlich Möglichen soll geprüft werden, welche Flugverbindungen in den Tagzeitraum verlagert werden können, um in den Randzeiten der Lärmpausen zu entlasten. Systematische Verstöße gegen das Nachtflugverbot wollen wir stärker ahnden". Sie dürfen höchstens
"die Bemühungen von Fraport, Flugbewegungen in den Nachtrandstunden durch eine Entgeltspreizung zu reduzieren",
begrüssen - wenn es sowas mal geben sollte.
Ansonsten wird nur noch versprochen, auch die sonstigen Aufträge der Unternehmerverbände und Wünsche der Luftverkehrswirtschaft soweit als möglich umzusetzen. Dazu sollen u.a. "der Anschluss des Flughafens an das Wasserstoff-Fernleitungsnetz" erfolgen, der "Flughafen Frankfurt bundesweit zum Vorreiter für die E-Fuel-Technologie" gemacht werden, "die Versorgung der Airlines mit SAF gemäß der EU-Quoten" möglichst billig sichergestellt und der "Ausbau der Cargo-Funktionen am Frankfurter Flughafen und der Airport City West" weitergeführt werden. Als zusätzliches Highlight setzen sich die Koalitionäre auch noch für "den Einsatz von Urban Air Mobility Systemen" ein, also die Irrsinnspläne der Fraport, den Flughafen per extrem lauten Flugtaxis mit der Innenstadt (oder den Innenstädten?) zu verbinden.
Zum Fluglärm gibt es klare Ansagen.
"Anstrengungen zur Reduzierung des Fluglärms der vergangenen Jahre zur Entlastung der Region sind fortzuführen und bleiben Daueraufgabe. Im Forum Flughafen und Region sowie im Rahmen der „Allianz für Lärmschutz“ werden wir diesen Weg fortsetzen und die Interessen der Anrainer sowie die Wettbewerbsfähigkeit und die Kapazität des Flughafens berücksichtigen."
Es soll also alles so weitergehen wie bisher, oder anders gesagt, es soll nichts passieren. Dem
Forum Flughafen und Region
ist seit dem lächerlichen
Maßnahmeprogramm Aktiver Schallschutz
von 2018 nichts Neues zum Lärmschutz mehr eingefallen, und zur
Allianz für Lärmschutz
finden Suchmaschinen nur Texte von 2012.
Dass es nicht möglich ist,
"den Flughafen in seiner Drehscheibenfunktion als Weltflughafen [zu] stärken",
"die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens zu sichern"
und
"die Entwicklung des interkontinentalen Passagierverkehrs"
zu stärken, ohne die Bevölkerung des Rhein-Main-Gebiets
massiven gesundheitlichen Risiken
durch Lärm und Schadstoffe auszusetzen, interessiert die Koalitionäre nicht.
Wenn die SPD also ab nächstem Jahr vertragsgemäß mit dem
"Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum"
auch die politische Verantwortung für den Bereich 'Luftverkehr' übernimmt, geht sie damit sehr konkrete Verpflichtungen ein, was alles nicht passieren darf. Aber immerhin eines ihrer Versprechen aus diesem Bereich kann sie umsetzen.
"Die Politik von CDU und Grünen wie etwa die PR Flops zum Lärmschutz"
muss sie nicht fortsetzen - Lärmschutz kann ganz einfach nicht mehr stattfinden.
Wer aber weiterhin für Gesundheits-, Umwelt- und Klima-Schutz im Allgemeinen und gegen die Belastungen durch Fluglärm und Schadstoffe im Speziellen eintreten will, hat damit eine klare Aufgabe: dieser Regierungspolitik von Anfang an Widerstand entgegenzusetzen. "Von Anfang an" kann man dabei ganz wörtlich nehmen. Am 18.01.2024 soll die neue Regierung in der konstituierenden Sitzung des Landtags ab 11:00 Uhr in Wiesbaden gewählt werden. Es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die wollen, dass das nicht ohne öffentlich sichtbaren Protest über die Bühne geht.
Dabei sollten den Aussagen dieses Vertrages ganz klare Forderungen entgegengesetzt werden. Statt im Planfeststellungsbeschluss "festgelegten Auflagen zum Nachtflugverbot ... und Eckwerten" (eine Stunde Beschränkungen und fünf Stunden Flugverbot mit Ausnahmen sowie 701.000 Flugbewegungen pro Jahr) brauchen wir
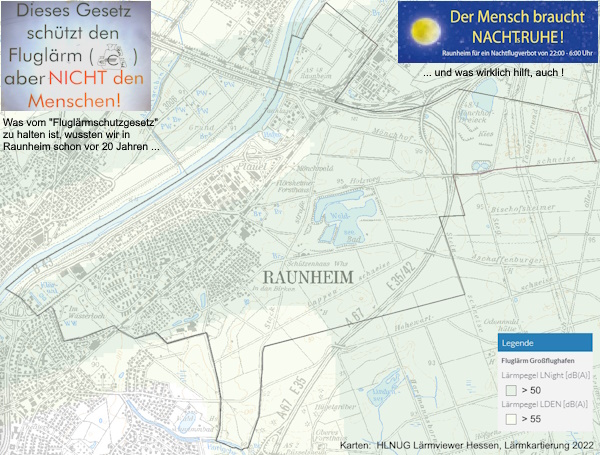
Nach der jüngsten Lärmkatierung 2022 liegt die gesamte Gemarkung Raunheim in einer Zone, in der tagsüber im Durchschnitt Fluglärm von mehr als 55 dB(A) herrscht. In der Nacht werden fast im gesamten bewohnten Gebiet im Durchschnitt Werte von über 50 dB(A) erreicht. Die Schwelle von 44 dB(A) wird mit Sicherheit überall überschritten.
11.12.2023
Auch die Frankfurter Fluglärmkommission hat sich in der letzten Sitzung ihrer aktuellen Amtsperiode mit der Zusammenfassung des "Gutachten - Aktualisierung der Evaluierung der Forschungsergebnisse zur Wirkung von Fluglärm auf den Menschen" und einer Präsentation zu dessen Zielen und den dafür verwendeten Methoden befasst.
Aus der Zusammenfassung kann man lernen, dass beim Überschreiten der kritischen Werte für den "äquivalenten Dauerschallpegel" von 51 dB(A) am Tag (06-22 Uhr) bzw. 44 dB(A) in der Nacht (22-06 Uhr) das Risiko, an Herzinfarkt, ischämischer Herzkrankheit oder Herz-Kreislauferkrankungen zu sterben, um mehr als 5% erhöht ist, das Risiko, an Bluthochdruck oder Depression zu erkranken, um mehr als 10%, und für hochgradige Belästigung tags bzw. hochgradige Schlafgestörtheit nachts um mehr als 25 bzw 15 % erhöht ist.
Einen Beschluss hat die FLK dazu nicht gefasst. In der
Pressemitteilung
zur Sitzung lässt sich der Vorsitzende Weiss zitieren mit
"„Der Bundesgesetzgeber muss die gesetzlichen Grundlagen für den Gesundheitsschutz der
Bevölkerung vor Fluglärm dringend verbessern! Die Erkenntnisgrundlage ist eindeutig – jetzt
ist die Politik in der Pflicht!"
Was genau sie tun sollte, wird hier nicht gesagt.
Zu den Ergebnissen des Gutachtens wird lediglich mitgeteilt,
"dass es keine Schlechterstellung des Schutzniveaus von Bestandsflughäfen, Bestandsgebäuden und Gebäuden, die zu einem früheren Zeitpunkt mit passivem Schallschutz ausgestattet wurden, geben darf. Bei gleicher Belastung entstehen auch gleiche gesundheitliche Auswirkungen. Maßgeblich müssen die Schutzwerte für Erweiterungsflughäfen sein, die nach den aktuellen Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung jedoch zu gering angesetzt sind. Gerade noch akzeptierbare Werte liegen am Tag um 4 dB und in der Nacht um 6 dB unter den derzeit geltenden Dezibelwerten."
Der letzte Satz lässt darauf schliessen, dass auch hier als Konsequenz hauptsächlich eine Verschärfung der Grenzwerte im Fluglärmschutzgesetz
ins Auge gefasst wird. Für die Fluglärmkommission des grössten deutschen Flughafens, die eine Region vertritt, in der Hunderttausende Menschen von Mainz bis Hanau und von Frankfurt bis Darmstadt in Bereichen leben, in denen die identifizierten kritischen Lärmwerte überschritten werden, ist das eindeutig zu wenig.
Welche Konsequenzen eine solche Verschärfung hätte, haben wir bereits in einem
Beitrag zur PM der ADF
zu diesem Gutachten erläutert. Für Raunheim würde sich dadurch praktisch nichts ändern. Die Stadt unterliegt ohnehin komplett den
Siedlungsbeschränkungen, alle müssen bei Neu- und Ausbauten höheren Aufwand für Schallschutz treiben und hatten Anspruch auf die völlig unzureichenden Maßnahmen aus dem Fraport-Schallschutzprogramm für Schlafzimmer. Lediglich im äussersten Norden der Stadt könnten einige Haushalte noch Förderung für zusätzliche Maßnahmen erhalten.
Von der Begrenztheit dieser Maßnahme und den darüber hinaus notwendigen Verbesserungen findet sich in den aktuellen Mitteilungen von ADF und FLK kein Wort. Als das Umweltbundesamt seinen Fluglärmbericht 2017 vorbereitete, hat sich die FLK Frankfurt mit einem 14seitigen Positionspapier daran beteiligt. Nach Veröffentlichung des (von den beteiligten Ministerien verwässerten) Berichts erschien eine 27seitige Stellungnahme der ADF mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen. Auf diese und weitere Papiere wurde in der folgenden Diskussion regelmäßig Bezug genommen und die darin enthaltenen Forderungen in die Öffentlichkeit gebracht.
Herr Weiss muss sich in seiner Rolle als FLK-Vorsitzender, der die Positionen und Forderungen des Gremiums nach aussen vertreten soll, an seinem Vorgänger messen lassen. Derzeit sieht es so aus, als müsse er noch kräftig wachsen, um auch nur annähernd dessen Statur zu erreichen.
Mit dürftigen Pressemitteilungen und dem Verzicht auf Beschlüsse zu Kernthemen schöpft er nicht einmal die begrenzten Möglichkeiten aus, die einem Beratungsgremium des Verkehrsministers gegeben sind.
Die weitergehenden politischen Forderungen zu formulieren, die deutlich machen, wie der Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren wirklich verbessert werden kann, ist daher umso mehr die Aufgabe der politischen Repräsentanten in kommunalen, Kreis- und Landes-Gremien, der Interessenverbände KAG und ZRM und der Bürger-, Umwelt- und Gesundheits-Initiativen, die sich mit den Belastungen durch den Flugverkehr und den dadurch begünstigten Krankheiten befassen.
Im Grunde sind die Forderungen bekannt: Die politische Konsequenz aus den Erkenntnissen des Gutachtens kann nur sein, umgehend ein Programm zur Wiederherstellung lebenswerter und gesundheitsfördernder Verhältnisse in der Region zu entwerfen und umzusetzen.
Notwendige Schritte dazu wären
Dass ein solches Programm letztendlich abzielen muss auf eine Transformation des Flughafens von einem profit-getriebenen, ständig weiter wuchernden, die ganze Region mit Lärm und Schadstoffen überziehenden Krebsgeschwür hin zu einem Element der öffentlichen Daseinsvorsorge, das notwendige Mobilitäts-Dienstleistungen im Einklang mit den Erfordernissen des globalen Klimaschutzes und der regionalen Lebens- und Umwelt-Qualität sicherstellt, ist dabei keine radikale Phantasie, sondern logische Konsequenz der Tatsache, dass künftig die Einhaltung der planetaren Belastbarkeitsgrenzen und der Schutz der Gesundheit von Mensch und Umwelt zu den Kernaufgaben des Wirtschaftens gehören müssen, wenn die Menschheit überleben will.

Die
Originalveröffentlichung,
von deren Titelblatt diese Grafik geklaut ist,
listet die Geschichte des Verfehlens klimapolitischer Ziele in der Luftfahrt auf.
02.12.2023
Unmittelbar vor der laufenden '28. Weltklimakonferenz' COP28 hat die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO, eine UN-Organisation mit dem Ziel, "ein nachhaltiges Wachstum des globalen Zivilluftverkehrssystems zu fördern", in einer speziellen Konferenz ihr langfristig anzustrebendes Ziel (long-term aspirational goal, LTAG) von "Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050" (womit sie 2/3 der Klimawirkungen des Luftverkehrs ignoriert) bestätigt und ein neues Zwischenziel für 2030 formuliert.
Um zu verstehen, was damit gemeint ist, muss man den Text sehr genau lesen. Im englischen Original steht:
"To support the achievement of the LTAG, ICAO and its Member States strive to achieve a collective global aspirational Vision to reduce CO2 emissions in international aviation by 5 per cent by 2030 through the use of SAF, LCAF and other aviation cleaner energies (compared to zero cleaner energy use)."
Das übersetzen wir mit
"Um das Erreichen des LTAG zu unterstützen, streben ICAO und ihre Mitgliedsstaaten danach, eine kollektiv global anzustrebende Vision zur Reduzierung der CO2-Emissionen der internationalen Luftfahrt um 5 Prozent bis 2030 durch die Nutzung von [nachhaltiger Flugzeug-Treibstoffen] SAF, [Kohlenstoff-reduzierten Flugzeug-Treibstoffen] LCAF oder anderer sauberer Flugzeug-Antriebsenergien (im Vergleich zur Nichtnutzung sauberer Energien)".
Der Nachsatz in Klammern ist entscheidend. Entgegen
ersten Berichten,
die den Eindruck erwecken konnten, es sei eine Reduzierung im Vergleich zu einem bereits erreichten, absoluten Wert (etwa der Verbrauch 2019 oder 2023) geplant, wird hier deutlich gemacht, dass es nur um eine relative Reduzierung geht. Durch die "sauberen Energien" soll erreicht werden, dass 5% weniger emittiert wird, als wenn nur fossiles Kerosin eingesetzt würde. Da ICAO an ihren
Wachstums-Szenarien
festhält, bedeutet das eine geplante
weitere Zunahme der Emissionen,
eben nur in einem etwas geringeren Ausmaß.
Eine völlig unverbindliche "Vision" einer etwas verringerten Steigerung der Emissionen steht in einem krassen Gegensatz zum
Aufruf
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 42% zu senken, um wenigstens eine Chance von 2:1 zu haben, das 1,5°C-Ziel zu erreichen. Die Regulierung des Luftverkehrs findet offensichtlich in einer anderen Welt statt.
Fachplattformen
analysieren genauer,
dass
"eine 5%ige Reduktion der Kohlenstoffintensität der Luftfahrt-Kraftstoffe"
angestrebt werden soll, zusammen mit einem
"Globalen Rahmen",
der die Staaten mit
"Assistenz beim Aufbau von Kapazitäten, Finanzierung und ... Entwicklung der notwendigen Infrastruktur"
unterstützen soll. Insgesamt sollen damit
"unterstützende Regierungs-Politiken"
erreicht und
"ein starkes Signal an Investoren und den traditionellen Energiesektor"
gesendet werden.
Der klimapolitische Nebelwerfer der globalen Luftfahrtindustrie, die sog. 'Air Transport Action Group',
erklärt noch deutlicher,
wie das Ganze gemeint ist. Die Luftfahrtindustrie habe ihre Ziele formuliert, nun sei es an der Finanzwirtschaft und dem Energiesektor, die notwendige Infrastruktur zu unterstützen und SAF in ständig steigenden Mengen zu liefern. Insbesondere der Energiesektor müsse
"jetzt bedeutende Flüsse ihrer riesigen Profite und Investitionsausgaben in die Energie-Transformation leiten".
Dazu brauche es
"unterstützende Regierungs-Politiken und unterstützende Investitionen aus dem Finanzsektor".
Im
Klartext:
Regierungen sollen Subventionen fliessen lassen und ein "günstiges Investitionsklima" schaffen, der Finanzsektor soll investieren, und die fossilen Energiekonzerne sollen sich neue, "zukunftsfähige" Geschäftsfelder erschliessen, damit die Airlines auch weiterhin billigen Sprit tanken können.
Die verpflichten sich nicht wirklich zu etwas, versprechen aber, SAF auch tatsächlich zu benutzen, wenn sie denn in den anvisierten Mengen und zu "angemessenen Konditionen" bereitgestellt werden. Für die Airlines, die am
ICAO-Ablasshandel CORSIA
beteiligt sind, wird das Ganze ohnehin fast zum Nullsummenspiel, denn diese SAF-Einkäufe können sie auf ihre Verpflichtungen zum Zertifikate-Kauf (soweit solche
überhaupt schon bestehen)
anrechnen.
Kein Wunder, dass die
Luftfahrt-Lobbyverbände jubeln
und begeistert Beifall klatschen.
Kaum erwähnt wird in der Berichterstattung, dass diese Konferenz sich auch dadurch auszeichnet, dass eigentlich bereits erreichte Kompromisse
weiter verwässert
wurden. 5% Reduzierung der Kohlenstoff-Intensität der Treibstoffe ist im Grunde nicht einmal vereinbar mit den ICAO-eigenen Szenarien zur Erreichung des LTAG-2050, daher waren in der Konferenz-Vorlage noch "5-8%" vorgesehen. Das bevorzugte 'Drehbuch' der Luftfahrtindustrie für die Erreichung von LTAG-2050, die ATAG-Studie
Waypoint 2050,
enthält Szenarien, die für 2030 SAF-Anteile zwischen 2,5 und 14% erwarten, also Intensitäts-Reduzierungen von rund 2-10%, wobei selbst unter den dort formulierten sehr optimistischen Annahmen nur Reduzierungen von mindestens 5% zur Zielerreichung führen können.
Ausserdem tagte zu Beginn der Konferenz noch die vor zwei Jahren in Glasgow gegründete sog. 'International Aviation Climate Ambition Coalition', zu der auch Deutschland gehört, wohl hauptsächlich mit dem Ziel, die damals beschlossene
Deklaration
zu ersetzen durch ein
Update,
in dem die Verpflichtung
"to reduce aviation CO2 emissions at a rate consistent with efforts to limit the global average temperature increase to 1.5°C"
ersetzt wird durch
"to reduce aviation CO2 emissions in line with the goal for international aviation of net-zero carbon emissions by 2050, in support of the Paris Agreement's temperature goal".
Das bedeutet, das die Verpflichtung ('commitment'), die Luftfahrt-Emissionen zu reduzieren im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel, ersetzt wird durch eine Verpflichtung zu Reduzierungen im Einklang mit dem Netto-Null-Ziel für 2050, um damit das Ziel der Pariser Vereinbarung "zu unterstützen". Angesichts der Tatsache, dass über die Möglichkeit der Einhaltung des 1,5°C-Ziels in diesem Jahrzehnt entschieden wird, ist das eine drastische Reduzierung der 'Ambition' und eine
Aufgabe des ursprünglichen Ziels.
Um solche Rückschritte zu überspielen, werden auch einige
Werbegags
lanciert, die wohl beweisen sollen, dass SAF funktioniert. So flog gerade werbewirksam eine Boeing 737 von Virgin Atlantic erstmals mit SAF hauptsächlich
aus altem Speisefett
von London nach New York.
Einige technische Details dazu lassen sich der von der 'Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt'
ins Deutsche übertragenen
Pressemitteilung
des Triebwerk-Herstellers Rolls Royce entnehmen.
Über den eingesetzten Treibstoff teilt Rolls Royce mit:
"Bei dem ... verwendeten SAF handelt es sich um eine einzigartige Mischung aus 88 % HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) von AirBP und 12 % SAK (Synthetic Aromatic Kerosene) von Virent, ... . HEFA wird aus Abfallfetten hergestellt, während SAK aus pflanzlichem Zucker gewonnen wird, wobei die übrigen pflanzlichen Proteine, Öle und Fasern der Rohstoffe weiter in der Nahrungskette genutzt werden. SAK wird in 100%igen SAF-Mischungen benötigt, da sogenannte Aromaten im Kraftstoff für die Triebwerksfunktion unerlässlich sind."
Das heisst, immerhin 12% des eingesetzten Treibstoffs werden aus Lebens- oder Futtermitteln gewonnen, die dafür der Nahrungsproduktion entzogen werden.
Die ganze Aktion ist damit weder neu noch zukunftsorientiert. Testflüge mit verschiedenen "100%-SAF"-Mischungen
finden seit Jahren statt,
wenn auch in der Regel nicht als Transatlantik-Flüge. "100% SAF" bedeutet dabei eine CO2-Reduzierung
von 70 bis maximal 85%,
und in einigen Fällen vielleicht sogar eine gewisse Reduzierung der Kondensstreifen-Bildung, die ebenfalls klimawirksam ist.
HEFA-Kraftstoffe können auch nicht in grossen Mengen hergestellt werden. Selbst die optimistischen 'Waypoint 2050'-Szenarien gehen nur von einem Anteil von 6-8% am Gesamtbedarf von SAF aus. Anders gesagt: Selbst unsere konsum-orientierte Wohlstandsgesellschaft produziert bei Weitem nicht genug Abfälle, um daraus genügend Treibstoff für unsere Luxus-Fliegerei zu machen.
Berücksichtigt man darüber hinaus, dass gemäß ICAO-Beschluss alles als SAF zählt, was in Triebwerken verbrannt werden kann, gewissen
Nachhaltigkeits-Kriterien
genügt und über den gesamten Lebens- (oder besser Verbrauchs-) Zyklus mindestens 10% weniger CO2 emittiert als fossiles Kerosin, und die "Lower carbon aviation fuels" LCAF normale fossile Brennstoffe sind, bei denen diese 10%-Reduktion im Produktionsprozess erreicht wird (indem z.B. die Förderpumpen mit Windenergie betrieben, die Raffinerien mit Solarstrom beleuchtet werden und/oder der Transport mit Elektrofahrzeugen erfolgt), wird klar: die Luftfahrt möchte
noch jahrzehntelang fossile Brennstoffe nutzen.
Dass es dabei auch mit den "Nachhaltigkeitskriterien" nicht weit her ist, zeigt z.B. die Tatsache, dass US-Fluggesellschaften ganz offen
Mais als Rohstoff
für "nachhaltige Treibstoffe" nutzen und dafür auch massiv die Grundwasservorräte im amerikanischen Corn Belt plündern wollen.
Damit passt die ICAO-Botschaft zu einer Klimakonferenz, die die wesentliche Aufgabe hätte, den
Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen
endlich verbindlich in die Wege zu leiten, deren Veranstalter aber von Anfang an
im Verdacht stehen,
das Gegenteil anzustreben. Aber auch wenn in Dubai noch das eine oder andere
positive Ergebnis
erreicht werden sollte - die notwendigen grundlegenden Veränderungen werden ohne den anhaltenden Widerstand von unten nicht durchsetzbar sein.
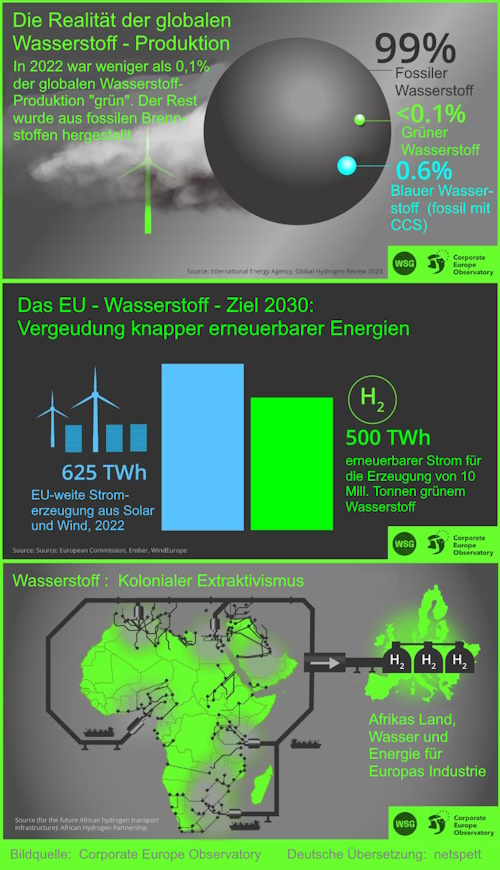
"Grüner" Wasserstoff steht aktuell nicht zur Verfügung. Die von der EU geplanten Mengen in Europa herzustellen, würde einen grossen Teil der hier verfügbaren erneuerbaren Energien erfordern. Die geplanten Importe aus Afrika hemmen dort die Entwicklung und die Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit erneuerbaren Energien.
28.11.2023
Wasserstoff
ist das Kernelement fast aller neuen
Antriebe und Treibstoffe,
mit denen die Luftverkehrswirtschaft ihre Klimawirkungen reduzieren und
Emissionsfreies Fliegen
möglich machen will.
Die Einsatzmöglichkeiten in
Wasserstoffflugzeugen
reichen von der direkten Verbrennung in Gasturbinen über die Nutzung in
Brennstoffzellen
für Elektroantriebe bis hin zu sog.
PtL-Kraftstoffen
("Power-to-Liquid", neuerdings auch "eSAF", electrically generated Sustainable Aviation Fuels, genannt), die anstelle von fossilem Kerosin getankt werden können.
Die einzigen Alternativen dazu wären batterie-elektrische Antriebe oder Treibstoffe, die aus Biomasse oder kohlenstoff-haltigen Abfällen gewonnen werden. Erstere sind wegen des Gewichts der Batterien nur für kleine Kurzstreckenflugzeuge einsetzbar, über Letztere werden viele falsche Aussagen verbreitet, aber sie sind nachweislich nicht klimaneutral, ihre Herstellung ist häufig nicht sozialverträglich und ökologisch bedenklich, der Handel damit ist anfällig für Betrug und sie stehen auch unter optimistischen Annahmen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung.
Technisch betrachtet ist Wasserstoff ein farbloses Gas, aber politisch kann er viele Farben bekommen, je nachdem, wie und woraus er hergestellt wird. Eine Erläuterung der Bundesregierung listet (versteckt in den "häufigen Fragen") insgesamt neun Farben auf. Wirklich klimaneutral kann dabei einzig der sog. "grüne" Wasserstoff sein, der unter Einsatz erneuerbarer Energien (hauptsächlich Strom) durch die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt wird.
Deutschland
und
die EU
planen den Übergang zu einer
Wasserstoffwirtschaft,
die Wasserstoff als Universal-Energieträger für viele Bereiche von der Schwerindustrie bis zum PKW-Verkehr und der Raumheizung nutzen soll.
Dabei soll natürlich "prinzipiell" grüner Wasserstoff genutzt werden, aber die EU spricht ganz offen von
"renewable and low-carbon gases",
also Gas, das "erneuerbar" ist (was auch schon
viele problematische Definitionen
beinhaltet) oder irgendwie weniger CO2 freisetzt als fossiles Gas.
Und auch die Bundesregierung gesteht (in den versteckten Fragen):
"Bis ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht, können auch andere kohlenstoffarme Farben genutzt werden ... . Unter bestimmten Voraussetzungen und mit strengem Blick auf Treibhausgasemissionen, können auch kohlenstoffarmer blauer Wasserstoff aus Erdgas mit CCS, also CO2-Speicherung, türkiser Wasserstoff aus Verbrennung von Methan oder orangener Wasserstoff aus Abfall und Reststoffen gefördert werden."
Mit anderen Worten: "(nearly) everything goes" - übergangsweise, bis eines Tages die schöne neue, klimaneutrale Welt erreicht sein wird.
Warum das so sein soll, erklärt der deutsche Wirtschaftsklima-Minister, wie meist in einem Video. Dabei übergeht er dezent einige Kleinigkeiten: "blauer" Wasserstoff aus Erdgas, bei dem das abgespaltene CO2 aufgefangen und irgendwo eingelagert (CCS, carbon capture and storage) oder anderweitig genutzt (CCU, carbon capture and usage) wird, hat einen miserablen Wirkungsgrad, da für die Abspaltung und Einlagerung oder Aufbereitung für die Nutzung ebenfalls Energie verbraucht wird. Auch ob die geplanten oder derzeit schon durchgeführten Einlagerungen das CO2 wirklich langfristig binden, ist keineswegs sicher. Im schlimmsten Fall ist "blauer" Wasserstoff klimaschädlicher als die direkte Verbrennung des fossilen Gases.
Dass 'grüner' Wasserstoff so etwas wie der
Champagner der Energiewende
ist (selten und teuer) und auf absehbare Zeit
nur in geringen Mengen
zur Verfügung stehen wird, wird nirgendwo bestritten. Auch das der
Transport
über längere Strecken auf Probleme stösst und die Gesamt-Energiebilanz wasserstoff-betriebener Prozesse massiv verschlechtern kann, wird hin und wieder erwähnt. Und manchmal wird auch in einzelnen Fällen öffentlich, wie
politisch und sozial problematisch
Wasserstoff-Projekte sein können.
Die deutsche Wasserstoff-Strategie sah sich deshalb schon bei ihrer Vorstellung
mit deutlicher Kritik
konfrontiert. Das Urteil war vernichtend:
"Sie ist ein riesiges Wirtschaftsförderprogramm, das ganz wenig mit der Energiewende bzw. Klimaschutz zu tun hat, und ganz viel mit den Interessen der alten Energiekonzerne und ihrem zentralistischen Energiesystem (allmächtige Konzerne, abhängige "Verbraucher"). Grüner Wasserstoff dient da nur als "Mäntelchen" für den Einsatz der anderen Farben ... ."
Daran hat sich bis heute
nichts geändert. Im Kampf um Marktanteile zwischen Strom- und Brennstoff-Versorgern dient die Wasserstoff-Strategie der Gaswirtschaft dazu, die weitere Auslastung ihres Gas-Versorgungsnetzes zu sichern und die weitere Nutzung von fossilen Gasen, 'buntem' Wasserstoff oder Mischungen von beidem weiter zu ermöglichen.
Auch die Strategie massenhaften Imports von 'grünem' Wasserstoff wurde frühzeitig
kritisiert.
Die aktuelle Fortschreibung zeigt noch deutlicher Elemente von
Energie-Kolonialismus,
der auf die Bedürfnisse der Bevölkerung der Exportstaaten, insbesondere auf die in den afrikanischen Staaten zunehmend schwieriger werdende
Versorgung mit Trinkwasser,
wenig Rücksicht nimmt.
Dass das mindestens im selben Ausmaß für das EU-Wasserstoffprogramm gilt, belegt ein
aktueller Bericht
des 'Corporate Europe Observatory', einer
unabhängigen Forschungs- und Kampagnen-Gruppe. Er beschreibt als "schmutzige Wahrheit":
"Eine Wasserstoff-Wirtschaft riskiert tatsächlich die verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe und vertieft neokoloniale extraktivistische Praktiken, insbesondere die umfassende Aneignung von Land, Wasser und Energie in den produzierenden Ländern" (eigene Übersetzung).
Dass die Öl- und Gas-Wirtschaft die
Klimakrise verschärft
und unabhängig von allen Versprechungen von Klimazielen nur ihre
Rendite optimiert,
berichtet inzwischen ja schon die Tagesschau. Und auch die Spitzen der deutschen Wirtschaft
reden da mittlerweile Klartext:
"grüne Projekte der Ampel ... passen nicht mehr in die Zeit und schwächen den Wirtschaftsstandort",
meint der Präsident des Arbeitgeberverbandes. Um nicht sofort als menschenverachtendes Monster erkannt zu werden, schiebt er ein ideologisches Glaubensbekenntnis hinterher, das längst
von Fakten widerlegt
ist:
"Mit mehr marktwirtschaftlichen Instrumenten ließen sich schneller und kostengünstiger ehrgeizige Klimaziele erreichen".
Auf internationaler Ebene belegt sogar ein
Bericht
der 'Internationalen Energie-Agentur' IEA im Detail, dass Welten liegen zwischen dem, was die Öl- und Gas-Industrie aktuell tut, und was nötig wäre, damit sie ihre Klimaziel-Versprechungen erfüllen könnte. Wie eine
andere Studie
belegt, waren ihre
Profite 1,5mal so hoch
wie die volkswirtschaftlichen Schäden, die ihre Emissionen angerichtet haben - aber das reguliert natürlich kein Markt.
Die Luftverkehrs-Wirtschaft ist da
keinen Deut besser.
Jede neue Untersuchung weist ihr in immer weiteren Details nach, dass selbst die optimistischsten Annahmen für einen Pfad zu
Netto-Null-Emissionen bis 2050
nicht um eine Deckelung des Wachstum der Flugbewegungen insgesamt und um ein Schrumpfen in den Vielflieger-Regionen Nordamerika und Europa herumkommen und dennoch
Milliarden Tonnen
an "negativen Emissionen" (
Carbon Dioxide Removal,
CDR) bis zur Klimaneutralität benötigen. Selbst wirtschaftsfreundlichste Think Tanks entwerfen Szenarien für ein
Nachfrage-Management,
mit dem zumindest vorübergehend die Emissionen reduziert werden sollen, bis die erhofften "technologischen Durchbrüche" endlich gelingen.
Die
Internationale Zivilluftfahrtorganisation
ICAO, die eigentlich eine UN-Organisation mit Staaten als Mitgliedern ist, aber agiert wie eine Wirtschaftslobby mit dem Ziel,
"ein nachhaltiges Wachstum des globalen Zivilluftverkehrssystems zu fördern",
hält allerdings trotzdem unverdrossen an ihren
Wachstums-Szenarien
fest. Für ihr
langfristig anzustrebendes Ziel
von "Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050" (womit sie auch noch
2/3 der Klimawirkungen
des Luftverkehrs ignoriert) setzt sie auf eben solche technologischen Fortschritte und, wie gerade nochmal in einer
speziellen Konferenz
bestätigt, auf
"nachhaltige Flugzeug-Treibstoffe (SAF), Kohlenstoff-reduzierte Flugzeug-Treibstoffe (LCAF) oder andere saubere Flugzeug-Antriebsenergien",
also auf alles, was irgendwie (tatsächlich oder vermeintlich)
weniger CO2 emittiert als der aktuelle Standard für fossiles Kerosin.
Zu den "anderen Energien" zählt auch der Wasserstoff, der aber nirgendwo näher betrachtet wird und offensichtlich keine entscheidende Rolle spielen soll. Auch
technologie-gläubige NGOs
gehen davon aus, dass das EU-Programm, das
Beimischungsquoten von Wasserstoff-basierten SAFs
zu konventionellem Kerosin vorsieht, das Maximum dessen ist, was realistisch zur Verfügung stehen könnte.
Auch die benötigte
Infrastruktur
stellt die Einführung von Wasserstoff als Treibstoff vor gewaltige Probleme. Anders als Kerosin muss Wasserstoff unter hohem Druck oder bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden, aber er muss trotzdem an einer ausreichenden Zahl von Flugplätzen zur Verfügung stehen und getankt werden können, wofür es noch keinerlei Normen gibt. Die
notwendige Ausstattung
dafür werden sich nicht alle Flughäfen leisten wollen.
Das hindert Flughäfen wie
Hamburg
nicht daran, sich in Zusammenarbeit mit
Airbus
schon heute als Vorreiter darzustellen und sogar schon eine erste Verbindung
Hamburg-Rotterdam
anzukündigen. Bei genauem Hinsehen zeigt sich aber, dass der Aufwand zunächst nicht allzu gross ausfallen soll:
"Bis etwa 2040 gehen die Airportmanager von einer Anlieferung des Wasserstoffs in geringen Mengen mittels spezieller Tankfahrzeuge aus",
und erst in 20 Jahren oder später wird eine
"ergänzende Versorgung über einen Pipelineanschluss erforderlich werden".
Andere Experten äussern sich z.B. gegenüber
der BBC
noch skeptischer:
"Wasserstoff-getriebene Flugzeuge - es mag einige Demo-Flüge geben im nächsten Jahrzehnt, aber die Einführung von Wasserstoff im großen Stil scheint definitiv weiter entfernt zu sein. Und vielleicht nicht einmal sicher."
(eigene Übersetzung)
Der Frankfurter Flughafen hatte schon 1935 eine
Wasserstoff-Direktleitung
zu den damaligen Farbwerken Höchst, hat das damit verbundene Geschäftsmodell aber nach ein paar Jahren wieder aufgegeben. Die
aktuellen Planungen
wirken demgegenüber sehr, sehr bescheiden. Die hessische Landesregierung ist allerdings
mächtig stolz
darauf, dass im Industriepark Hoechst künftig eine geringe Menge an eFuel, 2.500 Tonnen/Jahr, zum Beimischen zu normalem Kerosin produziert werden soll. Gemessen an der Menge fossilen Kerosins, die jährlich auf FRA vertankt wird, lässt sich das nicht einmal mit Promille-Angaben sinnvoll ausdrücken. Die Inbetriebnahme der Anlage ist allerdings zunächst
auf 2024 verschoben.
Als Fazit lässt sich festhalten: der aktuelle Wasserstoff-Hype hat wenig bis nichts mit Klimaschutz zu tun und trägt insbesondere absolut nichts dazu bei, die schnellen Emissions-Reduzierungen zu realisieren, die notwendig wären, um die Pariser Klimaziele in Reichweite zu halten.
Die aktuellen Aktivitäten dienen in erster Linie dazu, die Investitionen und Geschäftsmodelle der Gaswirtschaft zu sichern und als Türöffner für "kohlenstoff-reduzierte" Gase aller Art zu dienen, die weit davon entfernt sind, klimaneutral zu sein und im Extremfall noch mehr Treibhausgase emittieren als fossiles Gas. Das wird besonders deutlich in der Luftverkehrswirtschaft, wo mit "nachhaltigen Treibstoffen" aus "grünem Wasserstoff" geworben wird, de facto aber angeblich "nachhaltige" und "kohlenstoff-reduzierte" Treibstoffe aus Biomasse und "buntem" Wasserstoff zum Einsatz kommen sollen.
Wer also Wasserstoff als Mittel gegen die aktuelle Eskalation der Klimakatastrophe anpreist, hat entweder von den Fakten keine Ahnung, oder - und das dürfte für die grosse Mehrheit der Politiker*innen und Lobbyist*innen gelten - er/sie lügt.
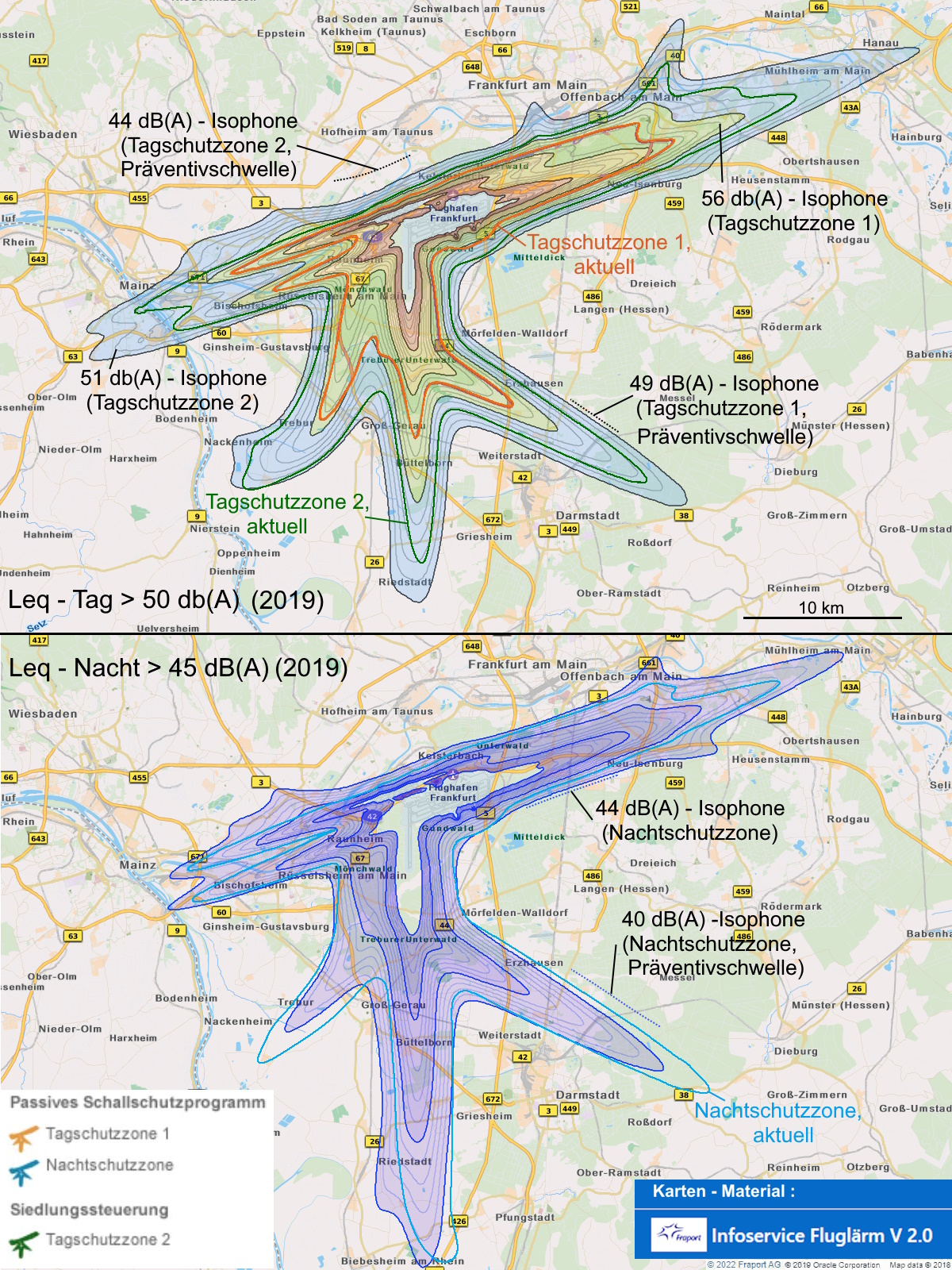
Die Grafiken zeigen die
Lärmkartierungen 2019
für den Tag (oben) und die Nacht (unten) sowie die aktuell existierenden Schutzzonen. Markiert sind darüber hinaus die Isophonen (Linien gleicher Lärmbelastung), die den vorgeschlagenen Grenzwerten entsprechen. Soweit diese Vorschläge niedriger sind als die dargestellten Isophonen, deuten kurze punktierte Linien deren ungefähre Lage an.
Die aus den Grenzwerten abzuleitenden Schutzzonen müssten grösser sein als die gekennzeichneten Isophonen-Bereiche, da sie künftige Entwicklungen berücksichtigen sollen und Fraport offiziell weiteres Wachstum anstrebt.
22.11.2023
Vergangene Woche hat der Vorsitzende der 'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen', Paul-Gerhard Weiss, im Anschluss an deren Tagung eine
neue Studie zu gesundheitlichen Wirkungen von Fluglärm
vorgestellt.
Am Montag wurde dann auf der Webseite der FLK Frankfurt, angehängt an eine
Pressemitteilung,
auch eine 14-seitige Zusammenfassung der Studie veröffentlicht.
Obwohl die Gesamtstudie sicher noch viele wichtige Details enthält, genügt das, um die wesentliche Inhalte der Studie zu verstehen und die Schlussfolgerungen beurteilen zu können.
Da es sich um eine Literaturstudie handelt, sind darin keine neuen Forschungsergebnisse veröffentlicht. Vielmehr
"war ein wesentliches Ziel dieses Gutachtens, den Forschungsstand seit der NORAH-Studie zur
Wirkung von Fluglärm auf den Menschen
auf Basis einer systematischen Literaturanalyse aufzuzeigen ... und auf dessen Grundlage Empfehlungen für eine mögliche
Novellierung des FluLärmG
herauszuarbeiten".
Kurz: es sollte all das berücksichtigt werden, was in den letzten acht Jahren an Erkenntnissen über
NORAH
hinaus gewonnen wurde, um daraus Forderungen für die
schon lange überfällige
und bisher
völlig unzureichend geplante
Novellierung des
Fluglärmschutzgesetzes
zu entwickeln.
Als wichtigstes Ergebnis der Studie hebt die ADF-PM
"ein zweistufiges Schutzkonzept ..., um die Bevölkerung vor den drohenden Gesundheitsrisiken hinreichend zu schützen" hervor.
Der ADF-Vorsitzende schlussfolgert daraus:
"Der Bundesgesetzgeber ist jetzt gefordert, die bundesgesetzlichen Regelungen zu überarbeiten und für hinreichenden Schutz der Bevölkerung zu sorgen. Es geht darum, die Menschen durch aktiven und passiven Schallschutz
vor dem Lärm zu schützen und nicht den Lärm vor den Menschen! Auch die Schlechterstellung des Schutzniveaus von Bestandsflughäfen, Bestandsgebäuden und Gebäuden, die zu einem früheren Zeitpunkt mit passivem Schallschutz ausgestattet wurden, sind ein unhaltbarer Zustand zu Lasten der Bevölkerung, der beendet werden muss. Die Gesundheit der Betroffenen muss an allen Standorten gleichermaßen geschützt werden, und zwar auf dem von den WissenschaftlerInnen abgeleiteten Schutzniveau!"
Die beiden Schwellen des Schutzkonzeptes (jeweils für Tag und Nacht) bestehen aus einer
"zwingenden Auslöseschwelle",
bei deren Überschreiten das Risiko für das Auftreten von Erkrankungen als nicht mehr tolerabel eingeschätzt wird und daher Schutzmaßnahmen eingeführt werden müssen, und einer "präventiven Auslöseschwelle", die als langfristig anzustrebender Richtwert gelten soll und im Wesentlichen den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation entspricht.
Nicht deutlich hervorgehoben, aber wichtig ist, dass sich die medizinisch begründeten Auslöseschwellen
"für den Tag auf die Tag-Schutzzone 2 und für die Nacht auf die Nachtschutzzone beziehen"
(mit 51 bzw. 44 dB(A), jeweils "außen am Immissionsort"). Die Differenzierung zwischen Tag-Schutzzone 1 und 2 ist nicht medizinisch, sondern "organisatorisch" begründet (u.a. dadurch, dass nur in Zone 1 der Verursacher des Lärms für die Schutzmaßnahmen zahlt), daher wird dafür die pauschale Differenz von 5 dB(A) übernommen. Warum dann trotzdem die Werte für die Tag-Schutzzone 1 als 'Empfehlungen' auftauchen, erschliesst sich nicht wirklich.
Weiterhin wird betont,
"dass die unterschiedlichen Schwellenwerte für Lärmschutzbereiche an Änderungs- und Bestandsflughäfen im FluLärmG nach aktuellem Forschungsstand aus Sicht der Lärmwirkungsforschung nicht begründbar sind und die Unterscheidung daher aufgehoben werden sollte".
Auch frühere bauliche Schallschutzmaßnahmen sollen für den Anspruch auf Förderung aktuell notwendiger Maßnahmen keinen Einfluss haben.
Würden die empfohlenen Grenzwerte in das Fluglärmschutzgesetz (§ 3 Abs. 1) übernommen, würde das bedeuten, dass
die Schutzzonen vergrössert werden
müssten und einerseits mehr Menschen Anspruch auf die Finanzierung von Maßnahmen des passiven Schallschutz durch Fraport hätten. Herr Weiss schätzt, dass in der Tag-Schutzzone 1 bzw. der Nachtschutzzone
"in Offenbach ... die Zahl der Anspruchsberechtigten um rund 30 Prozent steigen"
würde. Andererseits müssten auch Neubauten im weiteren Umfeld (der Tag-Schutzzone 2) mit aufwändigeren Schallschutz-Maßnahmen ausgestattet werden (§6 FluLärmG), und auch die Siedlungsbeschränkungs-Bereiche würden ausgeweitet (§5 FluLärmG).
Wie groß die neuen Schutzzonen genau ausfallen würden, ist schwer abzuschätzen, da die betroffenen Gebiete nach Fluglärmschutzgesetz
"unter Berücksichtigung von Art und Umfang des voraussehbaren Flugbetriebs"
ermittelt werden sollen. Da aber, wie die Grafik zeigt, die Gebiete, in denen der Lärm über den empfohlenen Grenzwerten liegt, schon 2019 grösser waren als die entsprechenden Schutzzonen, wäre mit einer deutlichen Ausdehnung zu rechnen.
Dazu kommt, dass eine anstehende
Anpassung der Berechnungsmethode
für die Lärmwerte in der Umgebung von Flughäfen ohnehin zu höheren Werten führen wird und auch dadurch die Schutzzonen grösser werden müssen.
Die Zusammenfassung des Gutachtens macht keine Aussage über die
Qualität der baulichen Schallschutzmaßnahmen,
die durch Überschreiten der Schwellen ausgelöst werden sollen. Empfohlen wird lediglich, dass
"die gewählten Bauschalldämm-Maße zu den stets gleichen korrespondierenden Innengeräuschpegel führen und hierbei nicht zwischen Gebäudearten (Bestands- vs. Neubau) oder Gebäuden mit oder ohne zu früheren Zeitpunkten erhaltenen Schallschutz unterschieden wird".
Welche Innengeräuschpegel erreicht werden sollten, wird nicht gesagt.
Die Frage ist von Bedeutung, weil die geförderten Schallschutz-Maßnahmen von Flughafen zu Flughafen variieren und insbesondere der Aufwand, den Fraport zu finanzieren verpflichtet wurde, sich auf
unterstem Niveau
und an der Grenze zur Lächerlichkeit bewegt. Insbesondere im Altbau-Bestand in den lautesten Lärmzonen sind die erreichten Bau-Schalldämmmaße weit vom Notwendigen entfernt, und die Lüfter, die Fraport finanziert hat, sind heute schon aus energetischen Gründen nicht mehr vertretbar.
Dennoch wären die Auswirkungen der im Gutachten gegebenen Empfehlungen weitreichend, aber
die Forderungen und Begründungen sind keinesfalls neu.
Schon der
Fluglärmbericht 2017
des Umweltbundesamtes enthält Empfehlungen für teils noch strengere Grenzwerte, die Aufhebung der Unterscheidungen zwischen Bestands- und Ausbau-Flughäfen sowie zwischen zivilen und militärischen Flughäfen und eine Reihe von weiteren Maßnahmen. Vorbehaltlich einer genaueren Analyse der Gesamtstudie muss man wohl davon ausgehen, dass das Verdienst des aktuellen Gutachtens wohl in erster Linie darin liegt, gezeigt zu haben, dass auch die aktuellen Forschungsergebnisse die Forderungen weiter untermauern.
Auch die ADF hat sich, u.a. bei der
gemeinsamen Aktion
mit den Bürgerinitiativen 2018 vor dem Berliner Reichstag und im
Forderungspapier
zum Bundestagswahlkampf 2021, schon wesentlich deutlicher und umfassender positioniert, als es in der aktuellen Pressemitteilung zum Ausdruck kommt. Daher ist es einerseits verdienstvoll, wenn sie das Gutachten dazu nutzt, die Forderungen nach der längst überfälligen Novellierung der Fluglärmschutz-Gesetzgebung insgesamt wieder auf die Tagesordnung zu bringen und die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene zum Handeln zu drängen. Andererseits sollte darauf geachtet werden, dass sie dabei nicht hinter bereits erreichte Positionen zurückfällt, die immer noch begrenzt und verbesserungswürdig sind.
Die eigentliche Aussage der vorliegenden Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung ist ohnehin eine andere. Wenn gesundheitlich gerade noch vertretbare Lärmpegel am Tag und in der Nacht über viele Quadratkilometer dichtbesiedelten Gebiets nicht erreicht werden und nur mit erheblichem wirtschaftlichem Aufwand und unter Inkaufnahme anderer Einschränkungen innerhalb von Gebäuden hergestellt werden können, kann es daraus nur eine vernünftige Schlussfolgerung geben:
Ein Mega-Hub dieser Grösse ist in der dicht besiedelten Rhein-Main-Region nicht vertretbar.
FRA darf nicht weiter wachsen, sondern muss auf ein raumverträgliches Maß schrumpfen.
Der Fluglärm in der gesetzlichen Nacht von 22 - 6 Uhr muss durch ein vollständiges Nachtflugverbot
auf wenige Notfall-Ausnahmen reduziert werden.
Ein Politikwechsel, der eine solche rationale, am Gesundheits- und Klimaschutz orientierte Position durchsetzen könnte, ist derzeit nicht in Sicht. Daher macht es durchaus Sinn, auch für kleinere, unzureichende Verbesserungen einzutreten, die die Gesundheitsrisiken zumindest zu einem gewissen Grad reduzieren - ohne das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren.
Das heisst nicht, dass erreichter Konsens zugunsten von Minimalforderungen aufgegeben werden sollte. Zum Lärmschutz gehören neben niedrigeren Grenzwerten der Verzicht auf vermeidbaren Fluglärm durch
Verbot von Kurzstrecken-
und
Luxus-Flügen,
Ausweitung der Nachtflug-Beschränkungen
bis zu einem vollständigen Nachtflugverbot, Ausnutzung aller
Möglichkeiten des aktiven Schallschutzes,
auch auf Kosten der Kapazität, und
wirksamer passiver Schallschutz
in ausreichendem Umfang, finanziert durch den Verursacher des Lärms, schon heute unverzichtbar dazu - auch wenn einige politische und Gremien-Vertreter hin und wieder daran erinnert werden müssen.

Der Knüppellöwe tauchte, soweit bekannt, erstmals nach den Prügelorgien an der Baustelle der Startbahn West in der hessischen Politik auf. Die Farbgebung ist hier den aktuellen Entwicklungen angepasst: der 'Koalitionsmantel' ist kaltgrau/ blass-altrosa gefärbt, alles andere erscheint als unterschiedliche Abstufungen von Grau(en).
17.11.2023
War schon
im Wahlkampf deutlich geworden,
dass von der Hessen-Wahl keinerlei positive Entwicklung in der Flughafen-Politik zu erwarten ist, zeichnet sich inzwischen ab, dass es tatsächlich noch schlimmer werden könnte.
Vor 10 Jahren, als zuletzt ein
Koalitionswechsel
in Hessen stattfand (von schwarz-gelb zu schwarz-grün),
spielte der Flughafen-Ausbau noch
eine grössere Rolle,
aber einen Politikwechsel
gab es nicht.
Nun tauscht Bouffier-Nachfolger Rhein die Grünen gegen die SPD aus, und das
Eckpunkte-Papier,
das Grundlage für die gerade begonnenen Koalitionsverhandlungen sein soll, lässt das Schlimmste befürchten. Die 'Hessenschau' gibt einen
Überblick
über das Papier, befindet:
"Ziel ist ein anti-grüner Politikwechsel"
und zitiert als Fazit der FAZ:
"Gendern war gestern, jetzt wird abgeschoben".
Als "anti-grün" kann man sicherlich die Tatsache bezeichnen, dass unter den "Herausforderungen", die laut den Eckpunkten die Zeit bestimmen
("Ukraine-Krieg und Hamas-Terror, Preis-, Wirtschafts- und Migrationskrise"),
die Klimakatastrophe nicht einmal mehr erwähnt wird.
Die angestrebte "breite Hessenkoalition", die sich auf das Votum von
knapp einem Drittel
der hessischen Wähler*innen stützen kann (und auf knapp die Hälfte der tatsächlich abgegebenen Stimmen und 56% der Sitze im Landtag), soll
"eine Koalition für Freiheit und Vernunft, für Stabilität, soziale Sicherheit und sanfte Erneuerung",
eine
"christlich-soziale Koalition für Hessen"
werden, die die
"zentralen Herausforderungen",
die
"großen Probleme unserer Zeit"
"bei der
Begrenzung der irregulären Migration, der Stärkung unseres Rechtsstaates, dem Abbau von Belastungen für Bürger und Betriebe, dem sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt und gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land"
erfolgreich angehen wird.
Das Papier listet dann 10 "Schwerpunkte" auf, unter denen die Punkte 3. SICHERHEIT und 4. MIGRATION UND INTEGRATION schon auf einen
deutlichen Rechtsruck
hinweisen.
Im Punkt 7. LÄNDLICHER RAUM (?!?) finden sich dann die Sätze:
"Wir bekennen uns zur Verstetigung der Investitionen in den Straßenbau, lehnen ein generelles Tempolimit sowie Fahrverbote für Autos ab und werden die Ausbauprojekte bei Autobahnen und am Frankfurter Flughafen fortsetzen. Gleichzeitig bekennen wir uns zum Flughafen Kassel-Calden als wichtiges nordhessisches Infrastrukturprojekt ... ."
Fast am Ende taucht noch ein Punkt 9. ENERGIE, KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ auf, in dem (immerhin?) die längst beschlossenen Klimaziele bestätigt werden, beschleunigte Genehmigungsverfahren für alle Energie-Projekte und Forschung für Dinge wie "laserbasierte Kernfusion" angekündigt werden.
Alles in allem ist dieses Papier ein Sammelsurium aus schwülstigen Leerformeln, populistischen Parolen ("kein Tempolimit", "Wölfe ins Jagdrecht", "Verzicht auf Gendern") und rückwärtsgewandten Heilsversprechungen und enthält keinerlei Antworten auf die tatsächlichen Herausforderungen der Gegenwart. Und während SPD-Vertreter noch hoffnungsvoll ankündigen, im fertigen Koalitionsvertrag könne mehr und Besseres stehen, macht die CDU auf ihrer Webseite und in Interviews deutlich, dass sie genau das will, was aus den Eckpunkten herauszulesen ist. Nicht umsonst macht sie mit dem ständig verwendeten Begriff der "christlich-sozialen Hessenkoalition" deutlich, wo sie ihr Vorbild sieht. Der sozialdemokratische Juniorpartner soll nun anstelle des grünen Mäntelchens eben ein soziales liefern und ansonsten "ohne Konflikte" für Mehrheiten sorgen.
Wie sicher sich die künftigen Koalitionäre sind, dass das alles schnell über die Bühne geht, zeigt ihr
Zeitplan:
"fast 200" Vertreter*innen beider Parteien sollen in knapp vier Wochen den Koalitionsvertrag ausverhandeln, am 16.12. sollen die zuständigen Gremien ihn beschliessen. Am Donnerstag, den 18. Januar nächsten Jahres, soll dann der neue Landtag in seiner
konstituierenden Sitzung
die Regierung wählen.
Auf diese Entscheidungsprozesse noch von aussen Einfluss nehmen zu wollen, dürfte weitgehend illusorisch sein. Die CDU sieht sich aufgrund ihrer jüngsten Erfolge ohnehin als praktisch unbesiegbar, und die SPD muss schlucken, was ihr vorgesetzt wird, und darf froh sein, wenn sie bei ihren "Kernthemen" (zu denen Umwelt und Klima nicht gehören) das eine oder andere Pünktchen als Erfolg verkaufen kann.
Ein "Zurück in die achtziger Jahre" des vorigen Jahrhunderts kann es allerdings nicht geben, auch wenn die Politik-Konzepte der regierenden Parteien aus dieser Zeit zu stammen scheinen. "Innere Sicherheit" und "gesellschaftlicher Zusammenhalt" sind auch heute nicht durch einen Ausbau des Polizei- und Überwachungsstaats zu erzwingen, und die beginnende Klimakatastrophe, die globale Gefährdung überlebenswichtiger Ökosysteme und die wachsende Kriegsgefahr bei gleichzeitiger Aufrüstung und massiven Kürzungen im Sozialbereich lassen sich mit einer "sanften Erneuerung" im wirtschaftlichen Bereich nicht bekämpfen. Die überlebens-notwendigen grundlegenden Transformationen lassen sich nur "mit und nicht gegen die Bürger" umsetzen, wenn zugleich eine massive Umverteilung von oben nach unten ihren sozialen Status sichert und den gegenwärtigen Trend zur Verelendung umkehrt.
Diese Erkenntnisse sind allerdings bisher nicht mehrheitsfähig. Für die Bewegungen für mehr Klimaschutz und gegen die wachsenden Belastungen durch den Flugverkehr bleibt daher zunächst nur, ihren Protest deutlich zu machen und möglichst nachdrücklich und öffentlich darauf hinzuweisen, was eine hessische Landesregierung eigentlich leisten müsste. Der 18.01.2024 wäre ein guter Tag, dafür vor dem Landtag in Wiesbaden in guter Tradition zu demonstrieren. In den Umwelt- und Naturschutz-Verbänden und Bewegungen dürfte genug Frust und Ärger vorhanden sein - und wer weiss, vielleicht erinnern sich ja einige an der grünen Basis auch noch nach 10 Jahren daran, wofür ihre Partei eigentlich mal gegründet wurde, und machen mit.

31.10.2023 (Update 06.11.2023)
Vor ein paar Tagen haben sowohl Fraport als auch Lufthansa etwas an die Öffentlichkeit gegeben, was sie wohl als Erfolgsmeldung verstanden wissen wollten. Fraport hat in einer Pressemitteilung die Kerndaten ihres Winterflugplans vorgestellt, und Lufthansa hat für kommenden Sommer den Betriebsbeginn einer neuen Tochtergesellschaft angekündigt.
Fraport verkauft es als Erfolg, dass im kommenden Winter
"82 Fluggesellschaften Passagierflüge zu weltweit 242 Reisezielen in 94 Ländern"
anbieten und
"mit durchschnittlich 3.759 Passagierflügen pro Woche ... das Flugangebot im Winterflugplan wieder annähernd bei dem Vergleichswert vom Winter 2019/2020 angekommen"
sei.
Damit möchten sie wohl Stärke demonstrieren und auf eine erfolgreiche Position im
Wettbewerb
hinweisen, um Anleger zu beeindrucken und die nach wie vor dringend nötige Personalgewinnung erleichtern. Die meisten Medien, allen voran die
Hessenschau,
unterstützen das mit Überschriften wie
"Frankfurter Flughafen stockt Winterflugplan massiv auf"
Wie immer bei Fraport, darf man solche Aussagen aber nicht als bare Münze nehmen. Zwar ist an den Zahlen wohl nichts falsch, aber einige Relativierungen sind angebracht. Anders als früher sind solche Flugpläne nicht mehr in Stein gemeiselt, sondern können auch in der laufenden Periode "angepasst" werden, wenn sich die Notwendigkeit ergibt. Das war z.B. auch im vergangenen Sommer der Fall, wo die Zahl der Flugstreichungen wieder Höhepunkte erreicht hat, obwohl Fraport schon vorab die Kapazitäten reduziert hatte.
Auch ein Vergleich mit früheren Jahren trübt das schöne Bild etwas. So zeigt eine
Grafik
der FAZ aus dem Jahre 2011 die Überschrift:
"Passagierflüge vom Flughafen Frankfurt: 114 Airlines starten wöchentlich zu 298 Zielen in 110 Ländern der Welt".
Und die Zahl der wöchentlichen Flüge lag in den Vor-Corona-Wintern in der Regel immer deutlich über 4.000, bis sie ab Februar 2020 drastisch einbrach und damit den Durchschnitt im Winterflugplan 2019/2020 spürbar nach unten zog.
Allerdings war FRA auch mit den reduzierten Zahlen zumindest im Sommer nach
Angaben des ACI Europe
immer noch der Flughafen mit der höchsten "Konnektivität" weltweit, wenn auch nur noch auf Platz 4 bei der Zahl der Direktverbindungen in Europa. Das liegt aber auch an der Auswerte-Methode, denn
nach anderen Daten
landet FRA nur auf Platz 6.
Was Fraport im Portfolio noch besonders fehlt, sind die europäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehre, wie sie insbesondere von
Billigfliegern
angeboten werden. Auch der 'Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft' BDL, bejammert in seiner
Pressemitteilung
zum Winterhalbjahr, dass diese Verkehre in Deutschland
"nur noch 63 Prozent des Vor-Corona-Niveaus"
erreichen, sieht darin allerdings die grössten Probleme für
"Flughäfen wie Berlin-Brandenburg, Düsseldorf und Stuttgart".
Gesellschaften wie
Ryanair
und
Easyjet
führen gerne die angeblich zu hohen Kosten dafür an, dass sie in Deutschland nicht wieder wachsen können, haben aber eigene Probleme, egal ob mit
Boeing-
oder
Airbus-Flotten.
Auch sehen sie hier durchaus Potential für
spezielle Geschäftsmodelle
oder bei
bestimmten Rahmenbedingungen.
Es könnte also durchaus sein, dass Ryanair oder andere zur Eröffnung des "Billigfingers" G von Terminal 3 wieder
in Frankfurt auftauchen,
falls Fraport bis dahin wieder genügend Personal findet.
Kernproblem dürfte aber eher sein, dass auch Anleger den positiven Prognosen der Luftverkehrswirtschaft nicht trauen und zahlreiche Risiken aufzeigen, wobei gerade das Klientel der Billigairlines aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten eher zum Sparen gezwungen ist als die 'Premium-Kundschaft', auf die Lufthansa setzt.
Trotzdem versucht natürlich auch Lufthansa, Kosten zu sparen. Neben
allgemeinem Druck
auf die Belegschaften dürfte die neue Tochtergesellschaft Lufthansa City Airlines ein wichtiges Instrument dafür sein. Auf ihrer
Webseite
stellt sie sich als "europäische Airline" vor, aber ihre Aufgabe wird von Lufthansa
klar beschrieben:
sie soll
"Flüge aus den Drehkreuzen München und Frankfurt anbieten und damit auch Zu- und Abbringerdienste für Lufthansa fliegen"
und
"Drehkreuze und Lufthansa Langstrecke"
stärken.
Kommentare in Fachblättern wie
airliners.de
und Wirtschaftsblättern wie
FAZ
und
Capital
kritisieren die chaotischen Strukturen innerhalb der Lufthansa Group, die durch eine weitere Tochter, die Aufgaben bestehender Gesellschaften übernehmen soll, nur noch komplexer werden, sehen aber letztendlich das Ziel,
"dass vor allem die Personalkosten sinken sollen".
Diese Annahme ist naheliegend, da die Zubringerdienste zu den Drehkreuzen Frankfurt und München bisher überwiegend unter der Dachmarke
Lufthansa Regional
von den beiden Tochtergesellschaften
Lufthansa Cityline
und
Air Dolomiti
durchgeführt werden. Beide sind ursprünglich selbstständige Airlines, die von Lufthansa übernommen wurden und noch 'Altlasten' wie teures Personal, Tarifverträge etc. mit sich herumschleppen.
Die 'Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) e.V.', die sich als 'Gewerkschaft des Kabinenpersonals' versteht, hat daher die angekündigte Betriebsaufnahme in einer
Pressemitteilung
umgehend kritisiert.
"Eine neue, bislang untarifierte Plattform führt zur Schließung eines gut tarifierten Flugbetriebs und setzt zeitgleich auch alle anderen Konzernairlines, insbesondere die Kabinenbeschäftigten der Lufthansa, unter Druck. ... Den Cockpit- und Kabinenbeschäftigten der Lufthansa CityLine droht nun der Verlust ihres Arbeitsplatzes. ... Entgegen anderslautender Lippenbekenntnisse, ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Gespräche allerdings absehbar, dass die Konzernführung den langjährig bei Lufthansa CityLine beschäftigten Mitarbeitenden der Kabine bei einem Wechsel zu City Airlines erhebliche Zugeständnisse hinsichtlich Vergütung, Arbeitszeiten, Einsatzbedingungen, Freizeitanspruch, Dienstplangestaltung und -stabilität abverlangen will. ... Das können und werden wir so nicht akzeptieren.".
Die Interessenvertretung der Pilot*innen, die 'Vereinigung Cockpit', hatte bereits früher die Gründung einer
einheitlichen Group-Tarifkommission
für die Lufthansa Group angekündigt, die verhindern soll, dass Beschäftigte verschiedener Konzern-Gesellschaften gegeneinander ausgespielt werden können. Da Lufthansa in den nächsten Jahren
mehr als 2000 neue Piloten
und auch anderes Personal braucht, liegt hier ein wesentlicher Konfliktpunkt für die Zukunft.
Unabhängig davon bleibt als Fakt, dass Lufthansa versuchen wird, im kommenden Sommer auch die Zahl der Kurzstreckenflüge wieder in die Höhe zu treiben und damit auch diesen, durch die Pandemie massiv eingebrochenen Sektor des Luftverkehrs wieder in alte Grössenordnungen zurück zu bringen. Mit der Billigstrategie, die sie dabei fahren wollen, wird natürlich nicht nur die fliegende Konkurrenz, sondern auch die Bahn, die einen Großteil dieser Aufgaben wesentlich klimafreundlicher erledigen könnte, massiv unter Druck gesetzt.
Fraport ist nur allzu bereit, die notwendigen Abfertigungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, solange lukrativere Nachfragen noch ausbleiben.
Es zeigt sich einmal mehr: bei der Luftverkehrswirtschaft auf Einsicht in gesamtgesellschaftliche Notwendigkeiten oder ernsthafte Klimaschutz-Absichten zu setzen, ist pure Illusion. Solange ihnen nicht Grenzen von aussen gesetzt werden, sei es durch politische, wirtschaftliche oder ökologische Entwicklungen, werden sie versuchen, weiterzumachen wie bisher. Den dringend notwendigen
gerechten Übergang
zu einer Reduzierung des Flugverkehrs und zu einer klimafreundlichen Mobilität wird es nur gegen ihren erbitterten Widerstand geben.
Kurz nach der Ankündigung der Inbetriebnahme der neuen Airline legt die LH-Spitze nochmal nach und konkretisiert ihren geplanten Wahnsinn. Mit Lufthansa City Airlines sollen
1-2 Millionen Euro
an Personalkosten pro Flugzeug und Jahr eingespart werden. Es soll auch nicht bei den zunächst bereitgestellten fünf altersschwachen Airbus A319-Maschinen bleiben. Geplant ist die Anschaffung von
40 neuen Kurzstrecken-Flugzeugen
(natürlich auch mit "bewährter" konventioneller Technik).
Bisher ist das natürlich nur Planung und Wunsch(traum) und dient einerseits zur Vorbereitung der anstehenden Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal von City Airlines, andererseits der Vorbereitung der Verhandlungen mit den potentiellen Lieferanten über Preise und Lieferkonditionen für die Maschinen. Man kann daher annehmen, dass auch die Konzernspitze nicht erwartet, dass sie alles schnell und vollständig umsetzen können. Da die Ziele aber nicht nur den Medien, sondern auch Analysten und Investoren vorgetragen wurden, sind sie wohl nicht nur reine Stimmungsmache.
Daher ist die Zahl von 40 Neuanschaffungen unter Berücksichtigung von Beschaffungs- und Lebensdauer von Flugzeugen ein starkes Indiz dafür, dass Lufthansa tatsächlich davon ausgeht, noch mindestens bis 2045, wahrscheinlich aber noch weit darüber hinaus, mit konventioneller Technik Kurzstrecke fliegen zu können.
Das zeigt auch, dass der Hype um alternative Antriebe für die Kurzstrecke, der in den Szenarien, nach denen der Flugverkehr bis 2050 "klimaneutral" werden soll, eine grosse Rolle spielt, von Lufthansa nicht ernst genommen wird. Sie dürfte damit keine Ausnahme unter den grossen Fluglinien sein.
23.10.2023
Aus Anlass des 12. Jahrestages der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest am 21.10.2011 hat das Bündnis der Bürgerinitiativen BBI für den 20.10.2023 unter dem Titel
"16 Jahre Flughafenausbau, 12 Jahre Landebahn Nordwest: Profit für Fraport – Lärm und Dreck für die Region, Klimakatastrophe für die Welt!"
zu einer Protestkundgebung im Terminal 1 des Flughafens
aufgérufen.
Es wurde erwartungsgemäß kein Massenprotest, aber rund 60 TeilnehmerInnen aus mindestens 10 Kommunen rund um den Flughafen machten deutlich, dass der Widerstand gegen Lärm, Schadstoff-Belastung und Klimazerstörung durch den Flugverkehr nicht tot ist.
Bemerkenswert ist auch, dass die Delegiertenversammlung des BBI beschlossen hatte, den wesentlichen inhaltlichen Beitrag zu dieser Kundgebung nicht jemandem aus den am meisten von der Nordwestbahn betroffenen Kommunen zu überlassen, sondern dem Sprecher der BI gegen Fluglärm Raunheim.
Das kann man als Signal dafür sehen, dass die Trennung in Alt- und Neu-Betroffene, die unmittelbar nach Eröffnung der Bahn noch eine grosse Rolle gespielt hat und im ein oder anderen Fall auch zu Streit im Bündnis führte, nun endgültig der Vergangenheit angehören soll und künftig die gemeinsamen Interessen und ein gemeinsames Vorgehen wieder die Hauptrolle spielen.

Steve Collins hat die Kundgebung mit vier selbst kreierten bzw. adaptierten Liedern wesentlich mitgestaltet.

Die Aufzeichnung der Rede ist aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt und editiert, gibt aber den Vortrag im Wesentlichen authentisch wider.
Entsprechend war die Rede auch darauf ausgelegt, deutlich zu machen, dass jeder Ausbauschritt am Flughafen nur der Fraport und der Luftverkehrswirtschaft Vorteile bringt und die ganze Region unter Waldverlust, zunehmenden Schadstoff-Emissionen und mehr Lärm leidet, auch wenn die Lärmzunahme je nach Ausbaumaßnahme unterschiedlich ausfällt. Langfristige Vorteile von einem Ausbau gibt es für niemanden in der Region.
Natürlich gab es aus diesem Anlass noch etliches mehr zu sagen, weshalb die Rede auch fast eine halbe Stunde dauerte, aber das kann jede/r nach Geschmack nachlesen oder nachhören.
Aufgelockert wurde das Ganze durch Songs von Steve Collins, der das Thema auch seit zwölf Jahren mit eigenen Liedern oder textlich angepassten Versionen von bekannten Songs, diesmal von
Creedence Clearwater Revival
und
Bob Dylan,
künstlerisch bearbeitet und viele Aktionen mit begleitet hat.
Weitere Eindrücke von der Kundgebung gibt es auf der
Webseite
des Bündnisses.
In der Rede wird ein Dokument erwähnt, das wir hier noch nicht diskutiert haben und das daher zumindest noch kurz angesprochen werden soll: der Abschlussbericht des sog. „Hessischen Zukunftsrates Wirtschaft“, der beim Hessischen Wirtschaftsgipfel am 18.10.2023 in Wiesbaden vorgestellt wurde.
In diesem Dokument befasst sich im Kapitel "Strategische Positionierung Hessens" das Unterkapitel "Verkehrsinfrastruktur und Mobilität" mit der "Handlungsempfehlung: Luftverkehrsstandort Hessen weiter stärken" damit, was die Politik alles tun sollte, um den Wachstumswahn von Fraport und Lufthansa zu unterstützen. Im Grundsatz ist es alles das, was auch auf der Nationalen Luftfahrtkonferenz vorgetragen wurde, aber speziell wird auch gefordert, "am Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Frankfurter Flughafens und den darin vorgegebenen Betriebszeiten und maximal zulässigen Flugbewegungen" (> 700.000 Starts und Landungen pro Jahr) festzuhalten und dafür zu sorgen, dass die "Wachstumspotenziale" des Flughafens "nicht durch eine Senkung der Höchstgrenzen verringert werden".
Im Unterkapitel "Planungs- und Genehmigungsverfahren" wird in der "Handlungsempfehlung: Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturen, gewerbliche Tätigkeiten und Flächenentwicklung harmonisieren und vereinfachen" ausführlich erläutert, was passieren sollte, um Auseinandersetzungen, wie sie die Geschichte des Flughafenausbaus bisher geprägt haben, künftig zu vermeiden und jede Art von Widerstand frühzeitig mundtot zu machen, um "Kosten und Unsicherheiten bei der Planung von Investitionen" zu vermeiden.
Dem Kapitel "Dekarbonisierung der Wirtschaft" stellt der Bericht das Glaubensbekenntnis voraus, dass "Wirtschaftswachstum und Dekarbonisierung ... noch stärker ... Hand-in-Hand gehen" müssen, wobei die Frage, welche Wirtschaftssektoren wachsen sollen und welche ggf. nicht, alleine durch den Markt geregelt werden soll. Auch Umfang und Tempo der "Dekarbonisierung" sollen alleine durch marktkonforme Elemente und umfassende Subventionierung neuer Technologien bestimmt werden, wobei durch "Abbau von Bürokratie ... die Innovations- und Wirtschaftskraft der Unternehmen zu steigern" ist.
Dieser Bericht ist damit ein weiterer Beweis für den völligen Bankrott der Eliten des herrschenden Systems, denen selbst angesichts immer schneller eskalierender Krisen nichts anders einfällt, als "Weiter wie bisher, nur schneller" zu fordern.
Dass das nicht funktionieren kann, wird immer mehr Menschen klar, was sich auch daran gezeigt hat, dass die Aussage in der Rede,
"System change, not climate change"
müsse die Kernforderung jeder Klimaschutzbewegung und daher auch der Bewegung gegen den Flughafenausbau sein, mit den meisten Beifall bekommen hat.
01.10.2023
Vergangene Woche war so etwas wie ein neuer Höhepunkt der Lobby-Offensive der Luftverkehrswirtschaft. Bei der sog.
3. Nationalen Luftfahrtkonferenz
am Montag, 25.09., in Hamburg trafen sich, anders als
vor zwei Jahren,
die Spitzen von Politik und Wirtschaft in Person mit zahlreichen anderen "Luftfahrt-Fans" (Zitat C. Spohr), um die jeweiligen Botschaften werbewirksam an die Öffentlichkeit zu bringen.
Auch diesmal kann man sich den Livestream der ganzen Veranstaltung im Nachhinein knapp 6 Stunden lang
auf YouTube ansehen.
Lufthansa-Chef Spohr, der die Reihe der Werbe-Beiträge eröffnete, setzte diesmal allerdings einen etwas anderen Ton. Wie auch in
anderen Bereichen
der Öffentlichkeitsarbeit verzichtet er inzwischen auf den janusgesichtigen Auftritt
früherer Jahre,
in dem gegenüber Politik und Öffentlichkeit drohende Pleiten an die Wand gemalt wurden, während gegenüber Investoren die Gewinnerwartungen in den schönsten Farben dargestellt wurde, und erklärte unverblümt
"Uns geht's prima".
Er machte dann auch gleich selbst deutlich, warum er das so sagt: bei der derzeitigen Lage am Arbeitsmarkt muss ein Konzern auch öffentlich stark und attraktiv wirken, wenn er das dringend benötigte Personal für sich gewinnen will. Damit hofft Spohr, Leute fast genauso schnell wieder einstellen zu können, wie er sie während der Pandemie gefeuert hat.
Die Forderungen an die Politik verpackte er auch etwas freundlicher, aber dadurch nicht weniger anspruchsvoll. Damit die erfolgreiche Entwicklung der deutschen Luftverkehrswirtschaft und ihre positive Rolle für Gesellschaft und Volkswirtschaft nicht durch die internationale Konkurrenz gefährdet werden, müssen die Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene richtig gesetzt werden. Was dafür im Detail nötig ist, durften andere im Laufe des Treffens noch ausführlich erläutern.
Er selbst hatte seine
Kritik
an den von der EU beschlossenen Beimischungsquoten für sog. "nachhaltige Treibstoffe" (SAF), die mit den bisherigen Ansätzen
nicht erreicht werden
können, schon vorab veröffentlicht. Welche Rolle der Klimaschutz in seiner Firmenstrategie künftig spielen soll, ist auch schon vorher
deutlich geworden.
Der Bundeskanzler, der als nächster dran war, kannte die Forderungen natürlich und sagte auch brav seine volle politische Unterstützung zu (wer nicht im Video danach suchen will, kann seine
Rede
auf der Webseite der Bundesregierung nachlesen).
Die beiden Minister, die als Veranstalter natürlich auch noch drankamen, liefern diesen Service nicht. Beim Verkehrsministerium findet man eine
eigene Unterseite
zur Konferenz mit ein paar grundsätzlichen Statements zu deren Hintergrund und "Updates" genannte Kombinationen von einzelnen Sätzen und Bildchen, die wohl die Aktivität des Herrn Ministers während der Konferenz verdeutlichen sollen. Auch er hatte seine wichtigste Botschaft zur Subventionierung der deutschen Luftverkehrswirtschaft
schon vorher lanciert.
Fraport-Chef Schulte greift das gerne auf und
jammert ein bisschen,
dass es ohne solche Subventionen schwer werden könnte,
genügend Billigflieger
zur Auslastung von Terminal 3 anzuwerben. Dass Fraport aber hinter die
Konkurrenz zurückfällt,
noch ehe die "schärferen Klimaauflagen" überhaupt greifen, liegt wohl eher an den
miserablen Leistungen,
die sie aktuell abliefern.
Auf der Seite des Wirtschaftsministeriums gibt es noch ein spezielles
Video,
in dem der Herr Minister seinen Fans in einfacher Sprache erklärt, warum das alles gut und richtig ist und wir damit alle Probleme in den Griff kriegen. Ausserdem findet sich dort auch die
Gemeinsame Presseerklärung
der Politik, die das enthält, was sie besonders der Öffentlichkeit einhämmern wollen: die Notwendigkeit, Forschung und Entwicklung klimaschützender Maßnahmen im Luftverkehr aus Steuergeldern zu bezahlen.
Nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit bekommt der
Statusbericht,
der anlässlich der Konferenz von Regierung, Verbänden der Luftverkehrswirtschaft und den Gewerkschaften IG Metall und ver.di vorgelegt wurde. Das mag einerseits daran liegen, dass darin nur vieles aus einem
Papier der Bundesregierung
wiederholt wird, das diese anlässlich der
Gründung
eines
Arbeitskreises klimaneutrale Luftfahrt
vorgelegt hat, aber vielleicht auch daran, dass an dem darin enthaltenen "Zwischenbericht" dieses Arbeitskreises deutlich wird, wie erbärmlich wenig die Luftverkehrswirtschaft bisher an echten Klimaschutz-Maßnahmen zu bieten hat.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass einige von den dort vereinbarten Maßnahmen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Dazu gehören neben der weiteren Verwässerung des
Europäischen Emissionshandels
insbesondere die Aufnahme nahezu aller normalen Investitionen der Luftverkehrswirtschaft
("Herstellung von Luftfahrzeugen, das Leasing und der Kauf von Flugzeugen, die Beförderung von Personen und Fracht sowie die Bodenabfertigungsdienste")
in die sog.
EU-Taxonomie,
womit sie generell als "nachhaltig" gelten würden und daher leichter zu finanzieren sind. Eine grössere Perversion dieses Instruments ist kaum noch denkbar.
Zu dem "breiten Stakeholder-Kreis" dieses AK gehören nur zwei Umweltverbände (Germanwatch und Transport & Environment), während diejenigen, die
wirksame Maßnahmen fordern,
in Hamburg
draussen protestierten.
Aber auch die, die sich einbinden lassen, üben Kritik. Germanwatch kritisiert die AK-Ergebnisse als
Trippelschritte,
und Transport & Environment legt eine
Studie
vor, die das Argument der Luftverkehrswirtschaft zurückweist, wonach die von der EU beschlossenen SAF-Beimischungsquoten zu schweren Konkurrenznachteilen für europäische Fluggesellschaften führen würden.
An diesen Differenzen wird wohl auch der Versuch der
weiteren Vereinnahmung
durch Minister Habeck nichts ändern. Für die, die draussen demonstrierten, hatte er nur eine
knallharte Ansage:
"Die Idee, dass wir das Klima schützen und keine Luftfahrt haben, ist weltfremd. Dies wird nicht passieren".
Das hatte zwar niemand gefordert, aber es ist ja auch nur die typisch populistische Reaktion eines Politikers, dem die Argumente fehlen.
Auch von gewerkschaftlicher Seite kommt Kritik. ver.di
kritisiert
die
"Schwerpunktsetzung der Nationalen Luftfahrtkonferenz: Alleinige Orientierung auf alternative Treibstoffe und Antriebstechnologien greift zu kurz".
Sie ignoriere
"die Interessen der Beschäftigten im Luftverkehr, ihre Arbeitsbedingungen und den Druck, der auf ihnen lastet".
"Elementare Bedeutung für diesen Transformationsprozess"
zu einem klimaneutralen Luftverkehr
"haben dabei motivierte und qualifizierte Beschäftigte".
Neben Vorschlägen für Maßnahmen an den Flughäfen und bei den Bodenverkehrsdiensten wird auch ein
"Verbot von Privatfliegern, sofern nicht klimaneutral möglich,"
gefordert.
Die Forderungen zum Personal stehen zwar auch im oben zitierten
Statusbericht,
aber ver.di fürchtet wohl zu Recht, dass dieser Teil der Vereinbarung nicht so ernst gemeint ist wie die Aussagen zu den Subventionen. Grund dafür gibt es reichlich: die
aktuelle Situation
ist schlecht und scheint sich
weiter zuzuspitzen.
Die FAZ
verweist
noch auf die
Kritik aus der Luftfahrtindustrie,
wonach die Aussagen der Regierung zur Förderung alternativer Treibstoffe und neuer Technologien noch zu unkonkret sind, macht aber ansonsten deutlich, dass von dieser Seite keine wesentlichen Einwände kommen.
Auch Fachplattformen wie
airliners
und
aero
beschränken sich auf mehr oder weniger umfangreiche Inhaltsangaben, wobei überall die Verhinderung von "Wettbewerbsverzerrungen durch Klimaauflagen" im Vordergrund steht.
Damit kann man die Botschaft dieser Konferenz wohl so zusammenfassen: trotz aller Sparmaßnahmen aufgrund der "Zeitenwende" hin zu Aufrüstung und Machtpolitik müssen die Subventionen für den Luftverkehr weiter steigen, und Klimaschutz gibt es nur, soweit er wirtschaftlich vertretbar und wettbewerbsfähig ist.
Um im Bild des UN-Generalsekretärs zu bleiben: auf der
Schnellstrasse in die Klimahölle
tritt die Bundesregierung das Gaspedal gerade noch etwas weiter durch. Der Luftverkehr möchte ohnehin auch auf diesem Weg das schnellste Transportmittel sein.

Heimspiel für Fraport, Lufthansa & Co. Dieses Forum diente ausschliesslich dazu, ihre Aufträge an die Landespolitik zu formulieren.
14.09.2023 (Update 02.10..2023)
Am Montag, den 11.09., lud die "Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände" (VhU) zu einem zweistündigen
Verkehrsforum: Luftverkehrsstandort Hessen
im "Lufthansa Aviation Center" am Flughafen Frankfurt. Drei Vertreter der Luftverkehrswirtschaft, Herr Niggemann von Lufthansa, Herr Schulte von Fraport und Herr Teckendrup von Condor, erläuterten, was in der hessischen Politik in der nächsten Wahlperiode zu geschehen hat, und Vertreter:innen von vier im Landtag vertretenen Parteien durften erklären, wie sie das umzusetzen gedenken.
Vertreten waren die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grünen, SPD und FDP. Die AfD durfte vermutlich (noch?) nicht mitmachen, ob die Linke nicht durfte oder nicht wollte, wissen wir nicht.
In einer anschliessenden
Pressemitteilung
legte die VhU nochmal nach und erklärte:
"Vor der Landtagswahl ruft Hessens Wirtschaft die heimischen Politiker dazu auf, mit Nachdruck hessische Interessen in der Luftverkehrspolitik zu vertreten. „Mit großer Sorge um den Wirtschaftsstandort nehmen wir wahr, dass Politiker den Status-quo beispielsweise bei den Betriebszeiten des Flughafens in Frage stellen. Damit wird die Drehkreuzfunktion, die internationale Bedeutung des Flughafens und letztlich der Wohlstand in der Region in Frage gestellt. Solche Degrowth-Fantasien gehören in den wirtschaftspolitischen Giftschrank“".
Anschliessend wurden noch die Aussagen der drei Wirtschaftsvertreter kurz zusammengefasst; was die Politiker:innen zu sagen hatten, war wohl nicht mitteilenswert.
Eine
dpa-Meldung,
die in der FR und einigen anderen Medien abgedruckt wurde, differenziert nochmal die Forderungen der Wirtschaftsvertreter. Lufthansa möchte die EU-Vorgaben für die Beimischung von sog. "Sustainable Aviation Fuels" abgeschafft haben, Condor möchte weniger Gebühren u.a. für die Flugsicherung, und Fraport wehrt sich gegen eine Erweiterung der Nachtflugbeschränkungen und möchte Billig-Arbeitskräfte auf der ganzen Welt anwerben dürfen.
In einem
eigenen Artikel
geht die FR kurz auf Reaktionen der anwesenden Politiker:innen ein und nennt noch ein paar andere Themen, die angesprochen wurden. Das
"Kratzen am Nachtflugverbot" ist für sie "der Klassiker" dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung, in der es immer
"darum geht, die Bedeutung des Flughafens herauszuheben"
und
"die Politik zu mahnen, der Branche nicht noch mehr Fesseln anzulegen".
Das konnte man, mit etwas anders verteilten Rollen, auch
vor vier Jahren
schon nachlesen.
Zitiert wird von der FR auch die energische Verteidigung
"der Grünen-Position [zum Nachtflugverbot] - eine Ausweitung auf acht Stunden - "
an der
"sich nichts geändert"
habe:
"Warum sollte es auch, fragt Fraktionschef Mathias Wagner".
Weiter unten wird er dann noch zitiert mit
"Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz, Fachkräftesicherung gehören für die Grünen zusammen".
"Dass sich immer gute Lösungen fänden, zeige die Umsetzung des Nachtflugverbots. Entgegen aller Unkenrufe habe es dem Erfolg des Frankfurter Flughafens keinen Schaden zugefügt."
Das darf man wohl so lesen, dass das Nachtflugverbot in den acht Jahren Regierungsverantwortung der Grünen für dieses Thema "gut", nämlich in seiner auf 5-6 Stunden reduzierten Form, "umgesetzt" sei und dass sich daran auch nichts ändern soll - unabhängig davon, dass im Wahlprogramm seit acht Jahren etwas anderes steht.
Auch die Anstrengungen der SPD in diesem Bereich werden gewürdigt:
"Die SPD will „prüfen“, ob manche Flüge von den sogenannten Randzeiten auf den Tag verlegt werden könnten; gemeint ist jeweils die Stunde vor oder nach der offiziellen Nachtruhe."
Solche Prüfungen können erfahrungsgemäß dauern, und wahrscheinlich müssen sie für jede Flugplanperiode neu beginnen - der Erfolg ist absehbar.
Klare Ansagen gab es aber auch:
"CDU und FDP hingegen wollen beim im Planfeststellungsbeschluss festgeschriebenen Nachtflugverbot zwischen 23 und 5 Uhr bleiben."
Von den geladenen Parteien hielt es nur die FDP für nötig, mit einer eigenen
Pressemitteilung
zu versichern, dass sie alle Aufträge pflichtbewusst umsetzen würde, wenn sie denn in der Regierung mitmachen dürfte.
Was die Parteien sonst so zum Thema Flughafen versprechen, muss man sich in ihren Wahlprogrammen und sonstigen Materialien zusammensuchen. Die CDU hat in ihrem Online-Programm im Kapitel
Mobilität
ein Unterkapitel "Luftverkehr", dass (fast) alles enthält, was die Luftverkehrswirtschaft sich so wünscht. Der Text in der "detaillierten Version" ihres
Hessenprogramms
ist identisch.
Die Grünen Hessen haben die Aussagen zum Flugverkehr im
Kapitel 1
ihres Online-Wahlprogramms untergebracht. Da ist er zwar nur Unterpunkt 12, aber immerhin so wichtig, dass er gleich doppelt abgedruckt wird (das erste Mal ohne Überschrift an den vorherigen Punkt angehängt). Das Motto ist eindeutig "Weiter wie bisher", jede kritische Reflektion der bisherigen Politik fehlt komplett. Auch hier gibt es in der (besser redigierten)
PDF-Version
nichts anderes.
Die SPD hat ihre Aussagen zum Flughafen im Kapitel
Zukunft der Wirtschaft, Arbeit und Ausbildung
ihres Online-Wahlprogramms geradezu versteckt. In einem ewig langen Text ohne jede Zwischenüberschrift findet man irgendwo in der Mitte zwischen Aussagen zum
"Zugang zum Kapitalmarkt"
und zur
"Kultur- und Kreativwirtschaft"
zwei Absätze zum Flughafen Frankfurt als
"zentraler Wirtschaftsmotor"
und dem Flugplatz Kassel-Calden als
"wichtige Infrastruktureinrichtung".
Auch hier zeugen wirre Formulierungen, doppelte Aussagen etc. von der Sorgfalt, mit der dieser bedeutende Programm-Passus formuliert wurde. In den Kapiteln
"Klimaschutz für ein zukunftsfähiges Hessen"
und
"Umwelt, Land-, Forst- und Waldwirtschaft, Naturschutz, Verbraucherschutz, Nachhaltigkeit"
kommt der Luftverkehr nicht vor. (In der
PDF-Version
des Programms gibt es Zwischenüberschriften, der Text ist derselbe.)
Die FDP hat in ihrem Online-Programm Aussagen zum Flughafen im Kapitel "Umwelt und Klimaschutz" in den Unterkapiteln
Umweltschutz mit wirtschaftlicher Vernunft
(zu Luftqualität und Lärmschutz) und
Liberale Klimapolitik für Hessen
(zu Klimaschutz an Flughäfen) verteilt. In der
PDF-Version
des Programms finden sich sechs Seiten zu
"Mobilität durch Innovation und Digitalisierung beschleunigen und nicht bremsen",
die sich mehrfach mit dem Luftverkehr befassen. Ob sie die dort verkündete primitive Technik-Gläubigkeit selbst teilen oder nur ihren Wähler:innen unterstellen, lässt sich nicht sagen.
Die Linke hat ihr Wahlprogramm nur als
PDF-Version
veröffentlicht. Im Punkt
"Unsere Zukunft klimagerechter"
gibt es einen Unterpunkt
"Unsere Gesundheit vor Profite - Luftverkehr sinnvoll planen",
in dem einige Alternativen zum bisherigen Betrieb des Frankfurter Flughafens und vor allem die entscheidenden Forderungen
"soziale und ökologische Neuordnung des Luftverkehrssektors befördern"
und
"gesundheits- und klimaschädlichen Flugverkehr vermindern"
genannt sind. Im Detail gibt es an den Ausführungen vieles zu kritisieren, aber es ist der einzige Ansatz bei den bisher im Landtag vertretenen Parteien, der zumindest in die richtige Richtung geht.
Ansonsten gibt es (soweit wir wissen) nur noch im
Programm
der neuen "Klimaliste Hessen" vergleichbare Aussagen zu
"Reduzierung der Flugbewegungen", allerdings ebenfalls verknüpft mit im Detail diskusionsbedürftigen Formulierungen.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass keine Partei besonders grossen Aufwand getrieben hat, um zu diesem Themenbereich fundierte und überzeugende Argumente und Forderungen zu entwickeln. Sie schätzen wohl alle zu Recht ein, dass die Wahlentscheidung der meisten, die wählen gehen, kaum davon beeinflusst wird. Wenn sie überhaupt kritisch wahrgenommen wird, dann wird die Luftverkehrspolitik als ein Bestandteil der jeweiligen Klimapolitik gesehen, und auch da stehen andere Fragen im Vordergrund.
Wir empfehlen aber ohnehin, die Wahlentscheidung weniger am Programm als vielmehr an der politischen Praxis der jeweiligen Partei zu orientieren. In Bezug auf die Klima- und Luftverkehrs-Politik liefert unsere Webseite viele Hinweise, wo die Unterschiede liegen. Einfach mal nach unten scrollen oder in den
Archiv-Seiten
der letzten Jahre nachlesen.
Am 21.09. überraschte die VRM-Mediengruppe mit einem über verschiedene Plattformen gestreuten
Beitrag
(neben der Main-Spitze u.a. auf Echo-online, der Allgemeinen Zeitung und sogar ihrem
Podcast)
mit der Überschrift
"Luftfracht-Verband fordert Cargo-Nachtflüge in Frankfurt"
und Unter-Überschrift
"„Die Fracht braucht die Nacht“, sagt der Luftfracht-Branchenverband und besteht auf Nachtflug-Möglichkeiten in Frankfurt als größtem Frachtflughafen Europas".
Inhaltlich passt das zwar zu den oben zitierten Aussagen von Fraport-Schulte, aber darauf wird nicht Bezug genommen. Stattdessen werden einige Aussagen einer
"aktuellen Analyse"
des Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) zitiert, die statistische Fakten bezüglich der Warenmengen und -werte und Spekulationen über deren Bedeutung liefern.
Interessant ist, dass der BDL in seiner eigenen
Pressemiteilung
das Thema Nachtflug mit keinem Wort erwähnt. Lediglich auf der letzten Seite der 'Analyse' finden sich Aussagen dazu, als "Forderung" lässt sich aber nur ein einziger Satz lesen:
"Die deutsche Wirtschaft braucht daher weiterhin flexible und international wettbewerbsfähige Betriebszeiten an deutschen Flughäfen".
Von "Cargo-Nachtflügen in Frankfurt" steht dort nichts.
Auch die Berichterstattung in den Fachmedien (z.B. bei
aero
oder
airliners)
greift das Thema Nachtflug nicht auf.
Warum der VRM-Beitrag damit aufmacht, erschliesst sich erst ganz am Schluss. Da wird eine "Anfrage des Landtagsabgeordneten Gerald Kummer" von Anfang August erwähnt, die sich mit der "zunehmenden Fluglärmbelastung in den Abendstunden vor Beginn des Nachtflugverbots um 23 Uhr in Südhessen" beschäftigt. Schon die damalige Berichterstattung befasste sich fast mehr mit den Gegenargumenten der Landesregierung als mit der Anfrage selbst, und hier wird nun eine Studie dagegen in Stellung gebracht, die sich damit garnicht beschäftigt. Ein wahres Musterbeispiel für objektive und neutrale Berichterstattung in Wahlkampfzeiten.
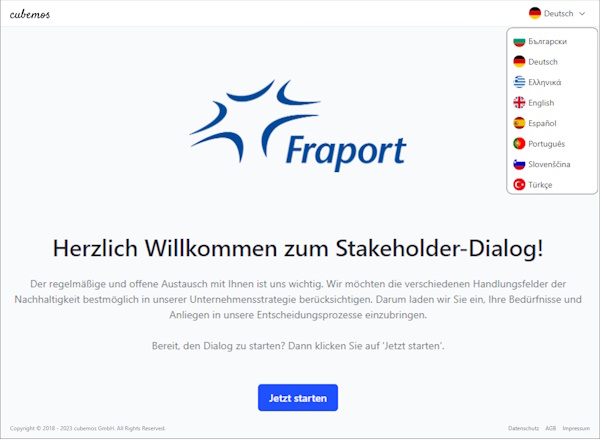
So vielversprechend und weltoffen geht es los. Danach offenbart sich sehr schnell, dass alles nur die Fraport-übliche Heuchelei ist.
12.09.2023
Vor ein paar Tagen hat Fraport per
Pressemitteilung
nach fünf Jahren mal wieder einen "Stakeholder-Dialog" angekündigt. Er soll dem
"Austausch mit Interessengruppen"
dienen und verspricht vollmundig:
"Teilnehmende können künftige Ausrichtung des Konzerns mitgestalten".
Auf der
Dialog-Webseite
klingt es ganz ähnlich:
"Ihre Meinung hilft uns dabei, unser verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln noch besser auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer vielfältigen Interessengruppen auszurichten",
denn
"Die Ergebnisse dieser Erhebung werden in die künftige Ausgestaltung unserer Nachhaltigkeitsthemen und deren Priorisierung einfließen."
Die Teilnahme ist bis zum 6. Oktober und in mehreren Sprachen möglich und dauert nur fünf Minuten.
Die Zeitangabe lässt schon vermuten, dass es hier nicht wirklich um eine tiefschürfende Auseinandersetzung mit der Rolle des Flughafens in Umwelt und Gesellschaft gehen kann, aber die genaue Ausgestaltung dieses "Dialogs" ist dann doch noch mal eine Frechheit für sich.
Zwar heisst es auf der
Einführungsseite
nochmal vielversprechend:
"Der regelmäßige und offene Austausch mit Ihnen ist uns wichtig. Wir möchten die verschiedenen Handlungsfelder der Nachhaltigkeit bestmöglich in unserer Unternehmensstrategie berücksichtigen. Darum laden wir Sie ein, Ihre Bedürfnisse und Anliegen in unsere Entscheidungsprozesse einzubringen."
Gefragt wird dann aber ausschließlich danach, als wie wichtig bestimmte Themen eingeschätzt werden. Von einer Bewertung, wie man die Fraport-Aktivitäten in diesen Themenfeldern beurteilt oder was verändert werden sollte, ist nirgends die Rede. Zwar gibt es auf der letzten Seite noch ein (bewusst klein dimensioniertes) Kommentarfeld, in das beliebiger Text, darunter wohl auch die ""eigenen Anliegen",
eingegeben werden kann, aber diese Eingabe ist "optional", was in aller Regel heisst, dass auch die Zurkenntnisnahme des dort Geschriebenen durch die Auswertenden optional ist.
Wer sich nicht mühsam durch die fünf Seiten durchklicken will, kann sich den Umfrage-Text
hier
ansehen.
Was die ganze Übung wirklich soll, wird in den Fraport-Texten nur sehr zurückhaltend angedeutet:
"Die Umfrage ist so ausgestaltet, dass sie ... der EU-Richtlinie Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) zur nichtfinanziellen Berichterstattung entspricht. Die CSRD erachtet den Stakeholder-Dialog als essenziellen Baustein für die Gewichtung nachhaltigkeitsrelevanter Themen".
Diese
Richtlinie
wurde Ende letzten Jahres neu veröffentlicht, und Ende Juli dieses Jahres hat die EU-Kommission
erste Standards
für die Inhalte der künftigen Berichterstattung festgelegt. Diese Standards wurden im Vorfeld von
Gewerkschaften
und
Umweltverbänden
wegen ihrer weitgehenden Unverbindlichkeit deutlich kritisiert, aber mit
einigen wenigen Korrekturen
in Kraft gesetzt.
Da Fraport zu den berichts-pflichtigen Unternehmen gehört, müssen sie spätestens 2025 etwas vorlegen, was halbwegs diesen Standards entspricht. Darin müssen sie
laut Umweltbundesamt
"nachhaltigkeitsbezogene Angaben machen, die aus finanzieller Perspektive oder aus ökologischer und sozialer Perspektive wesentlich sind (sog. doppelte Wesentlichkeit). Allerdings verbleibt die Wesentlichkeitsanalyse eine unternehmensindividuelle Aufgabe, ..."
aber ein paar Argumente dafür, was sie als wesentlich darstellen und worüber sie lieber nicht berichten wollen, machen sich immer ganz gut.
Genau dazu dient dieser "Dialog", der ja in Wahrheit nur eine völlig unverbindliche Umfrage darüber ist, was im Umfeld als wesentlich eingeschätzt wird.
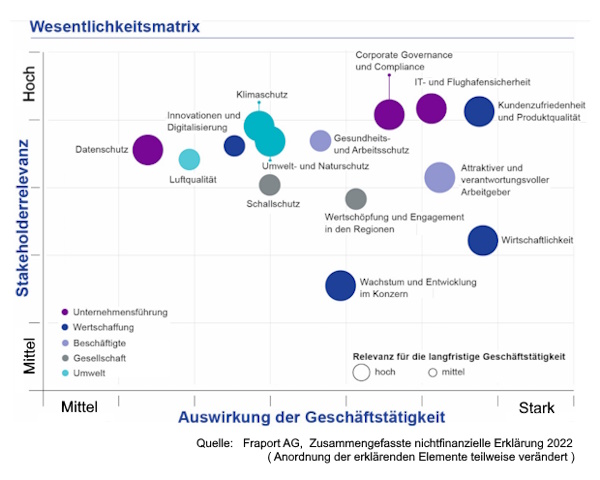
So sieht die Fraport-Beurteilung dessen, was wesentlich ist, aktuell aus.
Die wichtigen Sachen stehen rechts.
Fraport geht dabei kein Risiko ein. Ein paar Antworten mit der gewünschten Gewichtung werden sie sicherlich bekommen, und repräsentativ muss eine solche Umfrage nicht sein (kann sie auch garnicht, wenn der Kreis der "Stakeholder" wie hier nahezu ins Unendliche ausgeweitet wird).
Sollte wider Erwarten eine Vielzahl von Antworten mit unerwünschter Gewichtung eingehen, macht es auch nichts, denn die kommen dann wahrscheinlich aus nur zwei oder drei von fast zwei Dutzend "Stakeholder-Gruppen" und müssen entsprechend gewichtet werden. Ausserdem ist eine solche Umfrage natürlich grundsätzlich nicht verbindlich, Fraport kann immer eine eigene Auswahl treffen.
Und letztendlich geht es hier ja ohnehin nur um die Frage, worüber berichtet wird, und nicht darum, was berichtet werden müsste.
Was da zu erwarten ist, lässt sich erahnen, wenn man die
bisherige Berichterstattung
ansieht. In der
Zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung
von 2022 (noch nach alten Standards verfasst) findet sich eine "Wesentlichkeitsmatrix", die schon mal das abbildet, was auch aus der neuen Umfrage herauskommen wird.
Im Text werden zwar durchaus einige Probleme benannt, er enthält aber nichts, was nicht schon ausderswo ausführlicher und tiefergehender dargestellt worden wäre. Deutlich wird, dass auch eigentlich unangenehme Themen (wie z.B. die Flughafen-bedingten Belastungen mit Ultrafeinstaub) mit ein paar Floskeln abgehakt werden können. Ob sich daran mit den neuen Standards viel ändern wird, darf bezweifelt werden.
Die Berichterstattung enthält trotzdem vieles nicht, was zum Thema dazugehört und dringend einer umfassenden Diskussion und deutlicher Veränderungen bedürfte. Und was natürlich völlig fehlt, sind Perspektiven, die über das übliche "Weiter so" hinausgehen und ernsthafte Lösungsansätze wenigstens für die benannten Probleme enthalten. Die angegebenen "Leistungsindikatoren" in den Bereichen "Sozialbelange" (wo auch der Schallschutz abgehandelt wird) und "Umweltbelange" (wozu "Klimaschutz", "Umwelt- und Naturschutz" und "Luftqualität" gezählt werden) sind weitgehend absurd allgemein und gehen, wo sie konkreter werden, nicht über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus.
Es wird sehr deutlich, dass "Nachhaltigkeits-Berichterstattung" für Fraport nicht mehr als eine Pflichtübung ist, die sie mit kleinstmöglichem Aufwand erledigen.

Einen
Dialog
im klassischen Sinn, in dem Argumente ausgetauscht werden könnten, gibt es hier nicht und wird es vermutlich auch künftig nicht geben. Wäre so etwas geplant, müsste es zumindest Hinweise darauf geben, wie mit den Ergebnissen der Umfrage umgegangen wird und was die nächsten Schritte sein sollen. Stattdessen ist es wohl einfach so, dass das Fraport-Management geradezu zwanghaft heuchlerisch und verlogen ist und nicht die Wahrheit über den simplen Grund für die Umfrage sagen kann, sondern sie mit falschen Versprechungen zum "Fraport-Dialog" aufbauschen muss. Und wie fast immer, wenn man derartige Fraport-Verlautbarungen näher betrachtet, bleibt davon nur die Erkenntnis übrig: "Fraport log".
Die Schlussfolgerung daraus ist, dass man diesen "Dialog" am besten ignoriert, da eine Beteiligung, egal wie, keine positiven Effekte haben kann. Kritische Kommentare werden nicht veröffentlicht werden, und welche Themen-Gewichtungen mehrheitlich gewünscht werden, hat keinerlei Konsequenz. Dem mit einer Beteiligung noch einen Anschein von Legitimität zu verleihen, wäre kontraproduktiv.
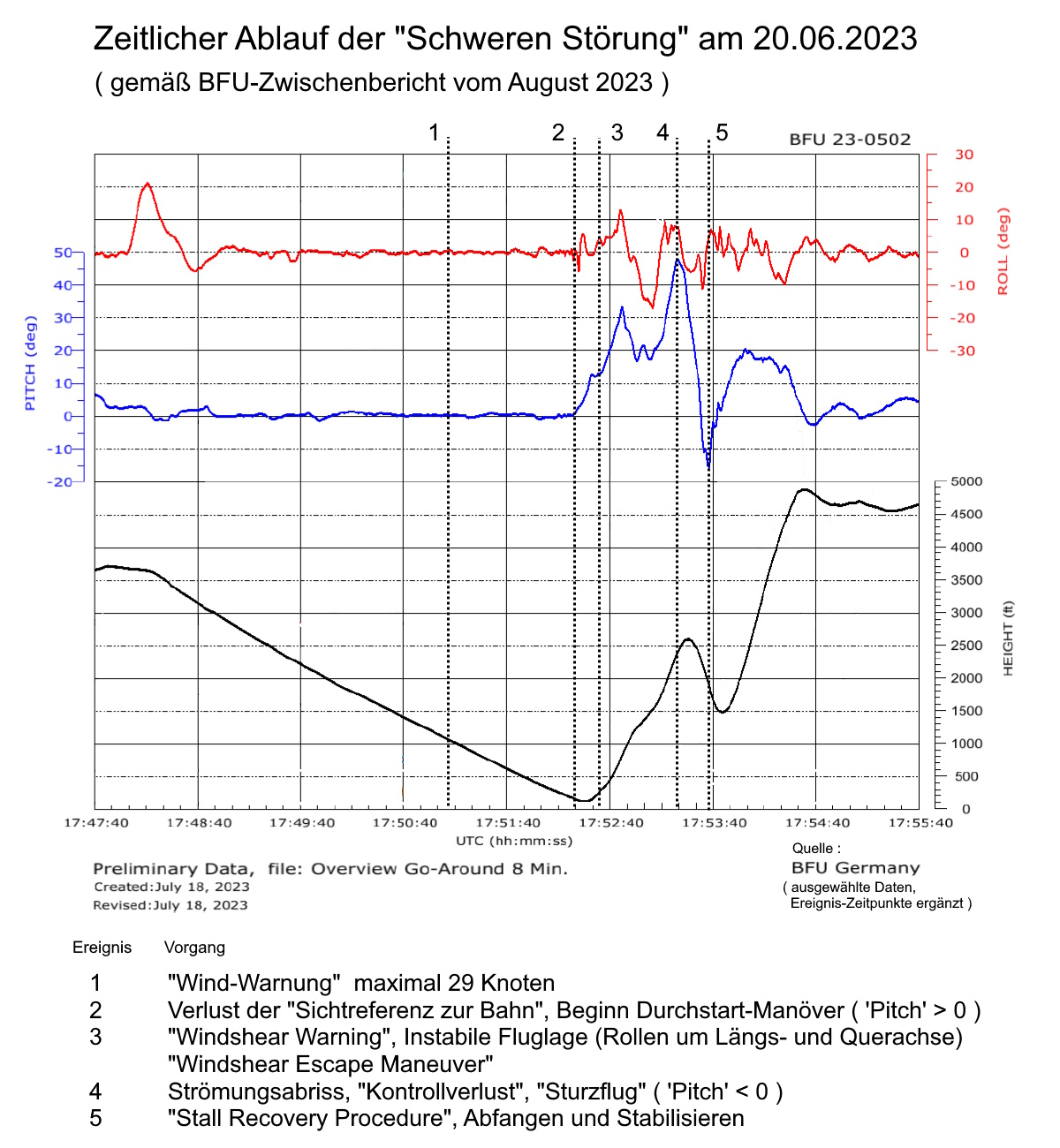
Dieses Bild zeigt die zeitliche Abfolge der wichtigsten Ereignisse (von links nach rechts),
soweit sie nach der ersten Datenauswertung bekannt sind.
Es bestätigt sich der Eindruck, dass die Situation extrem war, aber die Piloten schnell und richtig reagiert haben. Unter solchen Wetterbedingungen sollten keine Flugbewegungen stattfinden.
Wir haben auch ein
Video
zusammengestellt, dass die Flugspuren über dem Flughafen und im Umland zeigt.
05.09.2023
Unmittelbar nach Veröffentlichung des Zwischenberichts der 'Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen' (BFU) berichten Medien von der Tagesschau bis zur BILD-Zeitung über den "Beinahe-Absturz", bei dem der Flughafen "nur knapp einer Katastrophe entgangen" sei.
Im Text zitieren alle mehr oder weniger wörtlich eine dpa-Meldung, die folgendes Bild des Ablaufs vermittelt: die Piloten wollen während eines Gewitters landen, verlieren die Sicht auf die Piste, starten durch, verlieren kurzzeitig die Kontrolle über die Maschine, fangen sie in geringer Höhe wieder ab und landen beim zweiten Versuch ohne Probleme.
Man bekommt den Eindruck einer etwas schusseligen Besatzung, die dauernd irgendwas verliert, wie man einen Schlüssel oder ein Taschentuch verliert, aber es dann letztlich doch noch hinkriegt. Eigentlich nichts passiert, aber die Bürokraten von der BFU
"untersuchen den Vorfall als "schwere Störung", auch wenn niemand zu Schaden gekommen ist".
Typisch deutsch eben.
Diese Darstellung basiert auf Zitaten aus dem BFU-Bericht, liefert aber trotzdem ein schiefes Bild.
Der BFU-Text ist in keiner Weise plakativ, eher technisch trocken. Mit flugtechnischen Problemen nicht Vertraute finden dann in den Sätzen
"Kurz danach verlor die Flugbesatzung zeitweise die Kontrolle über das Luftfahrzeug und sank mit einer Sinkrate, die im Maximum einen Wert von minus 5 500 ft/min erreichte. ... Der Sinkflug wurde ... in einer Flughöhe von 1 913 ft AMSL beendet."
eher einen Ansatz für einen Problembericht als in der Aussage:
"Der verantwortliche Luftfahrzeugführer leitete das Durchstartmanöver ein. Kurz darauf erfolgte eine Windshear Warning im Cockpit. Daraufhin wurde das Windshear Escape Maneuver geflogen ...".
Tatsächlich bauen die Ereignisse aber aufeinander auf, und welche Problemlage näher an der Katastrophe war, lässt sich nur schwer abschätzen.
Wer sie hätte verhindern können (und müssen), ist allerdings eindeutig.
Denn im Detail stellt sich der
zeitliche Ablauf
so dar: um 19:48 MESZ dreht die Frachtmaschine der LATAM auf den Endanflug auf die Südbahn ein, wird für den vom Instrumentenlandesystem (ILS) gesteuerten Anflug stabilisiert und erhält die Landefreigabe vom Tower mit dem Hinweis "Wind aus 240°, 13 Knoten". Drei Minuten später gibt es einen weiteren Hinweis "Wind 250°, 18 Knoten, maximal 29".
Das deutet erstmals auf schwierigere Windverhältnisse hin, klingt aber nicht wirklich problematisch, da der Wind nun praktisch exakt in Richtung der Bahn weht und mit Seitenwind-Problemen nicht zu rechnen ist. Ob die Piloten an dieser Stelle bereits optisch erkennen konnten (oder hätten erkennen müssen), worauf sie zusteuern, bleibt offen.
Die Lotsen jedenfalls müssen wissen, dass es ein Problem gibt, denn zu diesem Zeitpunkt tobt das Gewitter bereits über dem Flughafen-Gelände, und sie können es direkt vor den Tower-Fenstern bewundern. Die Starts waren auch bereits um 19:40 Uhr eingestellt worden, und unmittelbar vor dem Landeversuch der B767 auf der Südbahn hatte auch eine andere Maschine die Landung auf der Nordwestbahn abgebrochen und war durchgestartet (warum genau, ist nicht bekannt).
Die Sicht der Piloten der B767 verschlechtert sich erst kurz nach der Windwarnung rapide, bis sie die Landebahn nicht mehr sehen können und das Durchstartmanöver einleiten. Danach geht es Schlag auf Schlag. Nur 15 Sekunden später wird die Maschine von Scherwinden getroffen und kippt nach rechts ab. In einem Flugzeug mit knapp 50 Meter Spannweite in etwa 50 Meter Höhe über dem Boden plötzlich um die Längsachse zu rotieren, ist sicher kein besonderes Vergnügen.
Die Maschine ist zwar im Steigflug, kommt aber vom Kurs ab und fliegt auf den Gebäuderiegel am nördlichen Rand des Flughafens zu. Für die Tower-Lotsen muss es so ausgesehen haben, als würden sie für ihre Nachlässigkeit umgehend bestraft.
Die Piloten versuchen gemäß Anweisung (dem zitierten "Windshear Escape Maneuver") mit Vollschub aus der Situation herauszukommen, und es gelingt ihnen, binnen 20 Sekunden auf den alten Kurs zurückzudrehen und weiter zu steigen. Allerdings verlieren sie bei diesem Manöver so viel Geschwindigkeit, dass es zu einem Strömungsabriss ("Stall") kommt und die Maschine mit der Nase nach unten auf den Boden zusteuert. Mit dem für solche Fälle vorgesehenen Manöver ("Stall Recovery Procedure") können sie die Maschine abfangen, wieder steigen und den Flug stabilisieren.
Damit ist die kritische Situation bereinigt. Die Flugsicherung reagiert nun endlich, lässt alle weiteren Landeanflüge abbrechen und schickt ankommende Maschinen in Warteräume, wo sie für rund eine halbe Stunde kreisen müssen (wenn sie nicht auf andere Flughäfen ausgewichen sind).
Danach stabilisiert sich der Betrieb langsam wieder. Die Gewitter ziehen ab, der Tower wird wieder arbeitsfähig, Starts und Landungen können stattfinden. Allerdings ist der Betrieb soweit durcheinander gebracht, dass am Abend noch 63 verspätete Starts genehmigt werden müssen (wenn auch mit fadenscheinigen Begründungen,
denn der Vorfall soll wohl nicht publik werden. Dummerweise gibt es viele Zeugen und den
Aviation Herald).
Wie es weitergehen wird, ist absehbar. Irgendwann im nächsten Jahr (oder noch später) wird die BFU ihren Abschlussbericht vorlegen. Er wird, wiederum in technisch trockenen Sätzen, genau analysieren, ob die Piloten in beiden Fällen schnell und angemessen reagiert und die Manöver korrekt ausgeführt haben oder ob sie beim "Windshear Recovery Maneuver" überzogen haben und der Strömungsabriss hätte vermieden werden können.
Er wird aber sehr wahrscheinlich auch feststellen, dass die Situation vor allem deshalb kritisch wurde, weil
die Bedingungen für eine sichere Landung nicht gegeben waren,
da die Windbedingungen extrem waren. Gegebenenfalls wird auch die Empfehlung ausgesprochen werden, unter solchen Bedingungen nicht nur den Start-, sondern auch den Lande-Betrieb einzustellen.
Kein Schuldiger wird angeprangert werden, wahrscheinlich wird die BFU sogar darauf verweisen können, dass die DFS ihre Kriterien für die Erteilung von Landefreigaben bei extremen Wetterbedingungen bereits überarbeitet hat und solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr vorkommen werden. Das Ganze wird so langweilig klingen, dass die Medien keinerlei Interesse mehr daran zeigen werden.
Es gibt ein aktuelles Vorbild dafür. Als zu Neujahr 2020 ein A350 der Thai Airways beinahe
über Rüsselsheim abstürzte,
war zunächst ebenfalls die Aufregung gross. Als die BFU zweieinhalb Jahre später
ihren Abschlussbericht vorlegte
und das Versagen der DFS genau (und beinahe süffisant) beschrieb, interessierte es niemanden mehr.
Auch diesmal kann man darauf hoffen, dass die DFS aus einer Beinahe-Katastrophe ihre Schlüsse ziehen wird und ähnliche Vorfälle künftig unwahrscheinlicher werden. Was fehlt, ist,
die DFS von vorneherein dazu zu zwingen, in ihren Verfahrensregeln
(wieder)
Sicherheit an erste Stelle zu setzen,
auch ohne dass sie auf Fälle verweisen kann, in denen es beinahe schief gegangen wäre. Das Risiko, dass sie irgendwann mal aus einer echten Katastrophe lernen müssen, bleibt damit erhalten.
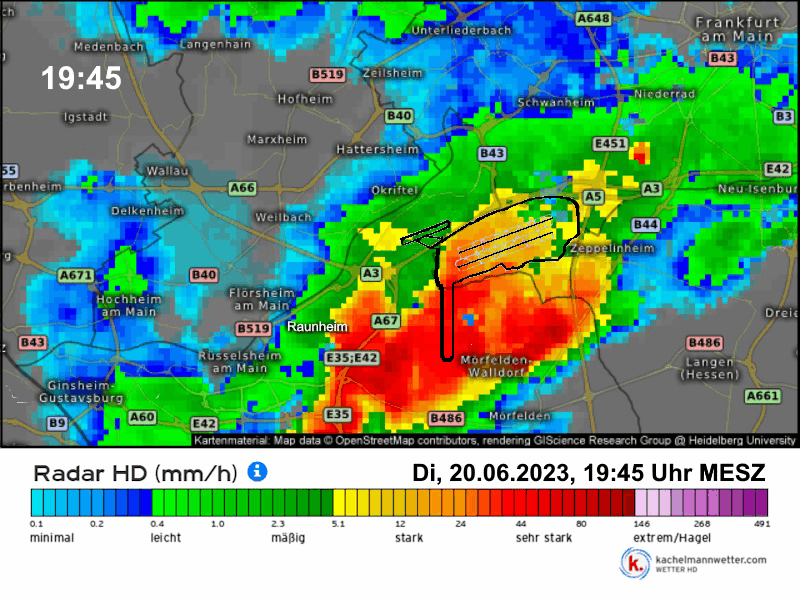
Diese Bildabfolge zeigt, dass die Gewitterfront relativ schnell über den Flughafen hinweggezogen ist.
Eine halbe Stunde Einstellung des Flugbetriebs hätte gereicht, schwere Risiken zu vermeiden.
01.09.2023
Schneller als erwartet hat die 'Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen' (BFU) ihren ersten Zwischenbericht zu dem als "Schwere Störung" eingestuften Beinahe-Absturz einer Frachtmaschine auf FRA am 20.06. dieses Jahres vorgelegt.
Darin sind alle Daten zusammengestellt, die bisher zu den Vorgängen gesammelt werden konnten, insbesondere
" Daten des Quick Access Recorders (QAR), Funkumschriften der Flugsicherungsorganisation und Aussagen der Flugbesatzung".
Ausserdem gibt es ein paar technische Daten über das Flugzeug und Beschreibungen der Vorgaben der Airline, was in kritischen Situationen wie denen, in die das Flugzeug geraten ist, zu tun ist.
Weitere Datenquellen müssen noch ausgewertet werden, und Beurteilungen und Empfehlungen wird es erst im Abschlussbericht geben.
Aus diesen Daten lässt sich einiges ablesen. Zum einen waren die
Angaben des Aviation Herald
unmittelbar nach dem Vorfall weitgehend korrekt. Das Flugzeug setzte zur Landung an, als der Kern der Gewitterfront gerade über das Parallelbahnsystem zog und geriet in einen Scherwind, aus dem es sich nur mit einem Manöver befreien konnte, das anschliessend beinahe zu einem Strömungsabriss führte.
Nachdem die Piloten mit den dafür vorgeschriebenen Maßnahmen auch aus dieser Situation wieder herauskamen, verlief das Durchstartmanöver im Weiteren problemlos, und die Maschine konnte nach einem Go-around normal landen, da die Gewitter inzwischen abgezogen waren.
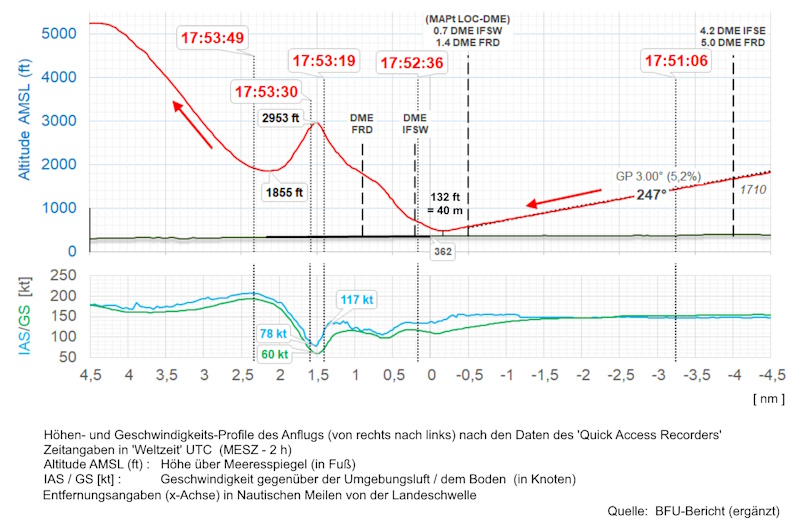
Diese Grafik zeigt die zeitliche Entwicklung einiger kritischer Parameter (Höhe, Geschwindigkeit) und die Zeitpunkte entscheidender Manöver. Wie kritisch die Situationen waren, erschliesst sich allerdings daraus nicht direkt.
Der Bericht enthält keinerlei Bewertung der Aktionen der beteiligten Akteure, also insbesondere der Piloten und der Fluglotsen. Versucht man, die beschriebenen Abläufe mit den Vorgaben für kritische Situationen zu vergleichen, erscheint es so, als ob die Piloten genau das getan hätten, was für diese Situationen empfohlen wurde. Das würde bedeuten, dass kein Fehler ihrerseits vorlag, sondern die Situation deshalb extrem kritisch wurde, weil die Bedingungen beim Landeversuch extrem waren.
Dann aber wäre die Schlussfolgerung, dass die Situation nur hätte vermieden werden können, wenn für die Zeit, in der die Gewitter über den Flughafen zogen, der Betrieb eingestellt worden wäre.
Natürlich muss man für eine endgültige Bewertung den Abschlussbericht der BFU abwarten, der noch viele andere Daten auswerten muss und vermutlich noch viele Monate auf sich warten lässt.
Aber es wäre angesichts der
jüngeren Entwicklungen
nicht überraschend, wenn auch hier letztlich wieder herauskäme, dass Sicherheitsaspekte gegenüber dem Wunsch eines 'ungestörten Betriebs', sprich der ungestörten Profitmacherei, hätten zurücktreten müssen.
Der BFU-Bericht hält noch fest:
"Der BFU liegen Informationen vor, dass zum Ereignisszeitpunkt andere anfliegende Luftfahrzeuge den Anflug ebenfalls abbrachen und ein Durchstartmanöver, aufgrund von Windshear Warnungen, einleiteten."
Wäre der Flugbetrieb auf FRA angesichts der Wetterverhältnisse nur für eine halbe Stunde eingestellt und die ankommenden Flugzeuge in eine Warteschleife geschickt worden (was nach dem Vorfall dann auch passiert ist), hätten alle diese Risiken vermieden werden können.
Dann müsste insbesondere die DFS sich fragen lassen, ob ihre Kriterien für solche Fälle die Sicherheit noch angemessen berücksichtigen, oder ob auch hier inzwischen Profit vor Sicherheit geht. Der BFU-Abschlussbericht wird diese Frage nicht deutlich beantworten. Es bleibt allen Beteiligten, auch den Flughafen-Anwohnern, überlassen, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen wollen und welche politischen Forderungen angemessen wären.
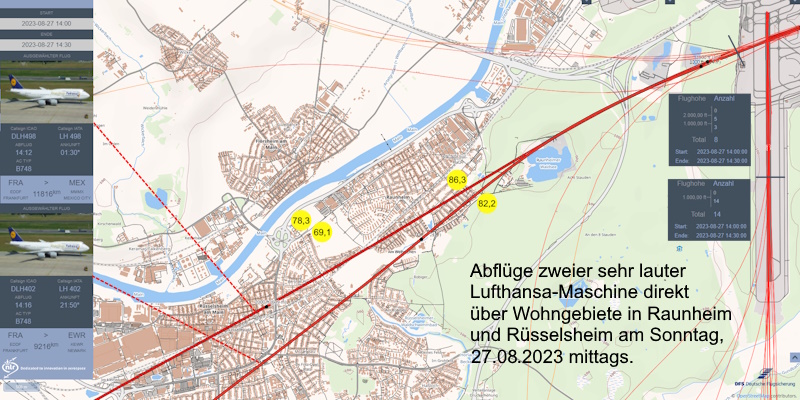
Die Wohnbevölkerung völlig unnötig mit Lärmwerten über 80 dB(A) zu quälen, kann man nur als Rowdytum bezeichnen.
Diese Piloten hätten wirklich ein saftiges Bußgeld verdient.
30.08.2023
Auch am Sonntag, den 27.08., dröhnten wieder, wie
häufig in den letzten Wochen,
startende Maschinen im direkten Abflug nach Westen über Raunheim.
Diesmal waren es zwei Boeing 747-800 der Lufthansa, die mit Maximalwerten von 86 und 82 dB(A) an der Fraport-Meßstation in Raunheim einen "nachhaltigen" Eindruck hinterliessen.
Insgesamt starteten in der halben Stunde von 14:00 bis 14:30 Uhr 22 Maschinen, also deutlich weniger als die 32, die das Bahnsystem angeblich leisten kann. Acht, darunter die beiden Rowdys, starteten von der Centerbahn, der Rest von der Startbahn West. Vier Maschinen auf den Nordwestabflügen und zwei auf der Südumfliegung stellen für diese Routen auch keine Überlastung dar.
Was also könnte die "Abweichung" von der ursprünglich geplanten Route veranlasst haben? Beliebter Kandidat für diesbezügliche Ausreden ist natürlich zu allererst das Wetter. Und das liefert hier tatsächlich auch einen Ansatz.
Wie das kurze Video zeigt, zog ein Niederschlagsgebiet mit Gewittern im Vortaunus von Westen nach Osten und hat möglicherweise für eine gewisse Zeit die Nordwestabflüge unbequem bis unmöglich gemacht. Nun sollen die ja eigentlich ohnehin nur noch in Ausnahmefällen und auch nur von zweistrahligen "Heavies", nicht von Vierstrahlern wie der B747 genutzt werden, aber diese Einschränkung wurde ja offenbar ohnehin schon wieder
stillschweigend einkassiert.
Video: So entwickelten sich die Unwetter am Sonntag Mittag in Südhessen.
Nehmen wir also an, die beiden B747 sollten eigentlich den Nordwestabflug nehmen und stellen fest, dass sich dort ein Gewitter in den Weg schiebt. Wäre das ein ausreichender Grund gewesen, das Gewitter per Geradeaus-Start zu umfliegen?
Natürlich nicht. Als Alternative bot sich die Südumfliegung an, die frei war, sowohl von anderen Flugzeugen als auch von schlechtem Wetter. Dafür hätte allerdings der Bordcomputer neu programmiert und der neue Kurs eingegeben werden müssen. Könnte das ein Problem gewesen sein?
Wahrscheinlich war es das. Eine solche Neuprogrammierung kostet eine gewisse Zeit, je nachdem, wie gut die Vorbereitungen sind und wie komplex der neue Kurs ist. Natürlich sollte man davon ausgehen, dass Lufthansa-Maschinen die Abflugrouten ihrer Homebase parat haben und schnell umschalten können, aber wer weiß? Die Bordcomputer der B747 müssen zwar nicht mehr mit Lochstreifen gefüttert werden, sind aber alles andere als benutzer-feundlich und hatten mit dem von der DFS für die Südumfliegung handgestrickten Code schon früher Probleme. Und der Zeitdruck war offenbar erheblich.
Wie die nächste Grafik zeigt, waren die Maschinen, als sie zum Start rollten, bereits 37 bzw. 51 Minuten verspätet. Jede weitere Verzögerung sollte da natürlich unbedingt vermieden werden, so dass man Nebensächlichkeiten wie Lärmschutz vernachlässigen musste. Statt einen neuen Kurs zu programmieren, kann man ja auch von dem alten "auf Sicht" abweichen, um das Gewitter zu umfliegen - wenn die Flugsicherung zustimmt. Offensichtlich hat sie das getan.
Warum aber waren die Maschinen verspätet? Vermutlich deshalb, weil praktisch alle Maschinen, die auf FRA starten wollten, verspätet waren. Entgegen aller
schönen Versprechungen
hat Fraport den Betrieb auch in diesem Sommer nicht im Griff.
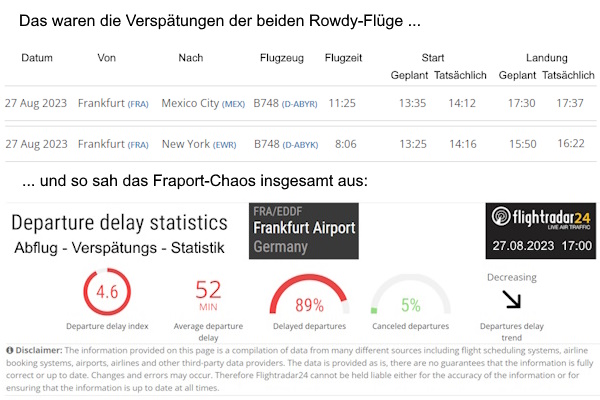
Alle angegebenen Daten stammen von Flightradar24.com.
Wie die Daten von Flightradar24 zeigen, waren am 27.08. neun von zehn startenden Maschinen verspätet, und die durchschnittliche Verspätung betrug fast eine Stunde.
Das hat natürlich nur sehr bedingt mit dem Wetter zu tun. Die Gewitterfront hat ja keineswegs den gesamten Betrieb lahmgelegt, und vergleichbare Verspätungen gab es auch in den Tagen und Wochen vorher.
Es gab sie z.B. auch am 12.08, als ebenfalls
zwei Überflüge
übers Dorf gingen, die angeblich "wetterbedingt" gewesen sein sollen. Es handelte sich um zwei völlig überflüssige Kurzstreckenflüge (nach Bremen bzw. Amsterdam), und sie waren 61 bzw. 44 Minuten verspätet.
Auch sie wollten wohl ursprünglich über den Nordwestablug starten und haben dann ein Regengebiet nördlich des Flughafens über Raunheim/Flörsheim/Wicker bzw. Raunheim/Rüsselsheim/Hochheim "umflogen".
Und das erklärt dann wohl auch die Vorgehensweise von Fraport, den Airlines und der DFS: Sobald eine Maschine startfertig ist, muss sie raus, egal, ob die geplante Route gerade Probleme macht und was ein Ausweichen für die Bevölkerung an Lärmbelastung bedeutet. Noch länger herumzustehen, um etwa einen alternativen Kurs vorzubereiten, würde den Gesamtbetrieb weiter stören und die hausgemachten Probleme weiter verschärfen.
Die Verspätungen sind aber nicht "wetterbedingt", sie sind die Folge des nach wie vor bestehenden gravierenden Personalmangels bei Fraport, ihren Tochtergesellschaften, bei Lufthansa und den meisten anderen Airlines. Und dieser Personalmangel wiederum ist Folge des katastrophal kurzsichtigen und asozialen Handelns der jeweiligen Geschäftsführungen in der Coronapandemie, die aus purer Profitgier die Belegschaften radikal reduzierten und insbesondere die teuren, tarifgebundenen Arbeitsplätze abbauten, wodurch ein Großteil der qualifizierten, erfahrenen Arbeitskräfte verloren ging. Dieser Aderlass prägt den Betrieb auch heute noch.
Wo genau es überall hängt und klemmt, kann man von aussen natürlich nicht genau wissen. Klar ist aber, dass die Personaldecke überall zu knapp ist und nicht nur alle Abfertigungsprozesse länger dauern als vorgesehen, sondern auch in anderen Bereichen Probleme auftreten.
Die 'Europäische Agentur für die Sicherheit im Luftverkehr', eine EU-Organisation, hatte bereits im Juni ein
Sicherheits-Bulletin
herausgegeben und darin u.a. vor folgenden Risiken gewarnt:
Geholfen hat es kaum. Wie schlimm die Situation für die Flughafen-Beschäftigten nach wie vor ist, wurde kürzlich von Betriebsräten und Gewerkschaftern
an die Öffentlichkeit gebracht. Dass die Situation auch für viele Piloten extrem ist, hat eine
Umfrage
unter europäischen Piloten über
Erschöpfungszustände
im Flugbetrieb verdeutlicht, die auch hierzulande in
Presse
und
Fernsehen
Aufmerksamkeit erregt hat.
Dass dieser Bericht nur die Spitze des Eisbergs zeigt, lässt sich daraus schliessen, dass die europäische Pilotenvereinigung ECA ihren Mitgliedern zeitgleich empfiehlt, solche Ereignisse zur Not auch über
eine anonyme Seite der EASA zu melden,
falls ihnen andernfalls Repressalien ihrer Airline drohen.
Die Folgen des Mißmanagements von Fraport, Lufthansa & Co. werden also in erster Linie auf dem Rücken der Belegschaften ausgetragen. Aber weil die Kundschaft sich derzeit
nahezu alles gefallen lässt,
sprudeln die Profitquellen kräftiger als je zuvor:
"Für das Gesamtjahr rechnet Vorstandschef Carsten Spohr mit einem Ergebnis, das "voraussichtlich eines der drei besten in der Geschichte der Lufthansa Group" sein wird".
Da will man natürlich das Geschäft bis an die Grenzen ausreizen und kann erst recht keine Rücksicht auf irgendwelche Nörgler nehmen, die sich über ungewöhnliche Flugrouten und wegen ein bißchen Krach aufregen.
Aus der Perspektive der Betroffenen heisst das umgekehrt: die Luftverkehrswirtschaft ist ausser Rand und Band und versucht, alle Grenzen, die ihr zum Schutz von Gesundheit und Umwelt auferlegt wurden, zu sprengen. Sie weiss dabei eine Aufsichtsbehörde hinter sich, die sich nicht scheut, die Bevölkerung immer wieder anzulügen und hinters Licht zu führen, um ihre Praktiken zu decken.
Wer dem Einhalt gebieten will, muss starken politischen Druck auf die Landespolitik ausüben, die ihre Behörden anweisen könnte, diesem Treiben Grenzen zu setzen. Es bleiben noch etwa 6 Wochen Zeit, um die Politiker*innen, die in Hessen gewählt werden wollen, zu fragen, wie sie dazu stehen.
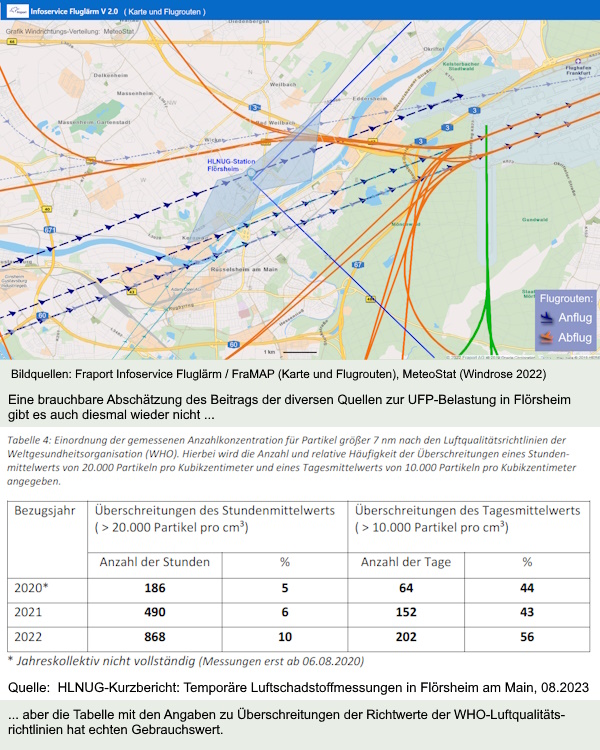
Für Details den jeweiligen Bereich der Grafik anklicken.
20.08.2023
Anfang August hat das 'Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie' (HLNUG) in einer
Pressemitteilung
seinen
Kurzbericht
zu
"Ultrafeinstaub in Flörsheim am Main"
vorgestellt. Als Ergebnis vermeldet die PM:
"Die Konzentration an ultrafeinen Partikeln (UFP) ist in Flörsheim überwiegend hoch – eine bedeutende Quelle ist der Frankfurter Flughafen, es gibt jedoch auch andere Quellen."
Weiter unten wird es etwas konkreter:
"Insgesamt ergab sich für 2022 ein Jahresmittelwert von ca. 11.000 Partikeln pro Kubikzentimeter. Laut Luftgüteleitlinien der Weltgesundheitsorganisation
ist die UFP-Belastung in Flörsheim als überwiegend hoch einzuschätzen
,
da der Tagesmittelwert der Partikelkonzentration an mehr als jedem zweiten Tag höher als 10.000 Partikel pro Kubikzentimeter lag.
Ursächlich ist hierfür das Zusammenspiel aus der hohen Hintergrundkonzentration und den zusätzlichen Beiträgen aus dem Flugbetrieb.
"
Diese Ergebnisse klingen natürlich sehr plausibel, aber leider trägt der Bericht rein garnichts dazu bei, bewerten zu können, welche Quellen in welchem Umfang zu der gemessenen Belastung beitragen.
Ehe wir aber darüber weiter lamentieren, wollen wir das Highlight dieses Berichts positiv hervorheben. Gegen Ende (S. 6 unten) findet sich eine halbe Seite unter der Überschrift
"Einordnung der Konzentrationswerte nach
WHO-Kriterien",
die auch die in der Grafik wiedergegebene Tabelle enthält.
Im Berichtstext heisst es dazu:
"Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2021 neue Luftgüteleitlinien veröffentlicht ... . Für ultrafeine Partikel wurden
erstmals zur Einordnung der Partikelanzahlkonzentration zwei Orientierungswerte genannt. Die Konzentration wird danach als hoch eingeschätzt bei Überschreitung eines Stundenmittelwerts von 20.000 Partikeln pro Kubikzentimeter oder bei Überschreitung eines Tagesmittelwerts von 10.000 Partikeln pro Kubikzentimeter."
Bereits auf S. 2 des Berichts wird mitgeteilt:
"Im Jahr 2022 wurde dieser Stundenmittelwert in Flörsheim insgesamt 868-mal überschritten, dies entspricht etwa 10 Prozent aller Stundenmittelwerte. ... Der Tagesmittelwert von 10.000 Partikeln pro Kubikzentimeter wurde an mehr als jedem zweiten Tag überschritten."
Damit wird zwar nicht gerade sehr plakativ, aber doch eindeutig gesagt, dass die UFP-Werte in Flörsheim
nach gesundheitlichen Kriterien zu hoch
sind. Damit erfüllt der Bericht zumindest die Anforderung, die Luftqualität für die Öffentlichkeit angemessen einzuschätzen.
Damit sind die positiven Aspekte dieses Berichts aber auch schon erschöpft. Warum die Werte so hoch sind, welche Quellen dafür eine Rolle spielen und was dagegen getan werden könnte, erfährt man daraus nicht. Die Auswertungsmethoden sind so untauglich wie bei
bisherigen Berichten,
und die Ignoranz gegenüber lokalen Besonderheiten ist noch krasser als bei der Auswertung der Messungen
in Mörfelden.
Um aber nicht allzu sehr mit technischen Details zu langweilen, haben wir deren Diskussion, zusammen mit einigen Zusatz-Infos, wieder auf eine
eigene Seite
ausgelagert. Dort steht dann auch, was an zusätzlichen Messungen und Auswertungen notwendig wäre, um den Ursachen der Belastung in Flörsheim auf die Spur zu kommen. Aussergewöhnliches ist nicht dabei, und man sollte die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass im
laufenden UFP-Projekt des UNH
das oder Besseres umgesetzt wird.
Dann hätte man auch eine sichere Basis für die Aussage, die das HLNUG nur postuliert, aber nicht belegt:
"Der Frankfurter Flughafen stellt in Bezug auf die Konzentration ultrafeiner Partikel für die Umgebung eine erhebliche Quelle dar."
Vor allem wüsste man aber dann auch genauer, wo anzusetzen wäre, um die Belastungen auf ein erträgliches Maß zu senken. Politische Unterstützung für die Forderung, die anstehenden Fragen endlich umfassend zu klären, kann daher sicher nicht schaden. Wenn schon sonst nichts, ist der Bericht dafür ein geeigneter Anlass.
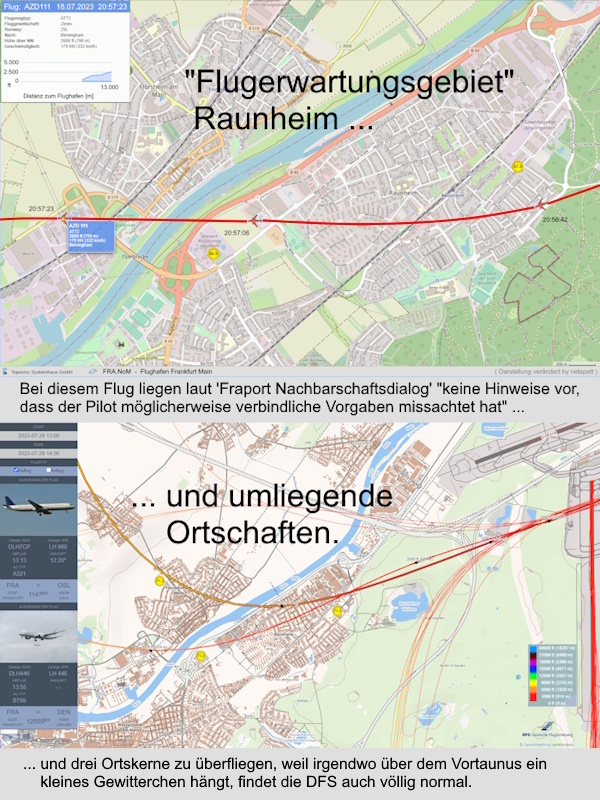
"Flugerwartungsgebiet" ist rund um FRA offensichtlich überall da, wo gerade geflogen werden kann, ohne dass es zu Kollisionen kommt. (Für Details jeweilige Grafik anklicken.)
12.08.2023 (Update 29.08.2023)
Wenn man sich bei Fraport über ein Fluglärmereignis beschwert, muss man davon ausgehen, dass man, wenn überhaupt, nichts als Standardfloskeln zurück bekommt.
Manchmal taucht darin ein Zombie auf, ein längst vergessen geglaubtes, untotes Etwas, das eigentlich garnicht existiert, aber dennoch hin und wieder angerufen wird und dann sogar juristische Wirkungen hervorrufen kann - etwas, was selbst in der an ungewöhnlichen Regeln reichen Luftfahrt schon aussergewöhnlich ist. Die Rede ist vom "Flugerwartungsgebiet".
Der Reihe nach. Eine Beschwerde über einen Überflug über Raunheimer Stadtgebiet am 18.07. kurz vor 21:00 Uhr wurde vom freundlichen "Team Nachbarschaftsdialog" der Fraport am 02.08. mit folgendem Text beantwortet:
"Das von Ihnen beanstandete Flugereignis vom 18.07.2023, 20:57 Uhr, wurde von uns zur weiteren Prüfung an die Fluglärmschutzbeauftragte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) weitergeleitet.
Nach Einsichtnahme in die Flugspuren der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) ergab diese Überprüfung, dass die Flugbewegung
von dem standardmäßig vorgesehenen Flugverfahren abwich.
Allerdings lag die Abweichung noch
innerhalb des nach den Regeln der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) festgelegten Flugerwartungsgebiets.
Überdies liegen keine Hinweise vor, dass der Pilot möglicherweise verbindliche Vorgaben missachtet hat.
Eine Weiterleitung der von Ihnen beanstandeten Flugbewegung an das für Ordnungswidrigkeiten bei An- und Abflügen zuständige Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) erfolgte daher nicht. ..."
Die Rückfrage, nach welchen ICAO-Regeln dieses Gebiet denn festgelegt wurde und wie es aussieht, blieb (bisher?) unbeantwortet.
Der Versuch, diese Frage selbst zu beantworten, erwies sich als aussichtslos, förderte aber Interessantes zutage.
Als Erstes kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Begriff des "Flugerwartungsgebiets" im deutschen Luftfahrt-Regelwerk nicht existiert. Auch entsprechende Suchen in EU-Regelwerken, die in deutscher Übersetzung vorliegen, blieben erfolglos.
Das ist bemerkenswert, denn die Antwort oben deutet ja darauf hin, dass dem Piloten ein Bußgeld hätte drohen können, wenn er diesen nicht existenten Bereich verlassen hätte. Per Internet-Suchmaschine haben wir einen Hinweis gefunden, dass sowas tatsächlich mal passiert ist.
In einer Zeitschrift für einen
elitären Männerklüngel
hauptsächlich aus Berufspiloten wird 2005
ein Fall diskutiert,
in dem das Luftfahrtbundesamt auf Veranlassung der DFS ein Bußgeld gegen einen Piloten wegen Verlassens des "Flugerwartungsgebiets KIRDI 2-SIGMA" in München festgesetzt hat. Die Empörung war groß, und bereits damals wurde energisch darauf hingewiesen, dass solche Gebiete nirgendwo definiert und für Piloten nicht erkennbar seien.
Allerdings fand man damals auf den Seiten der Fraport eine Beschreibung, wonach die Sollkurse der Abflugrouten
"von Toleranzgebieten bzw. Korridoren unterschiedlicher Breite"
umgeben sind.
"Die Korridorbreite richtet sich nach einer Vielzahl von Kriterien ... . Aus diesen ... wird die ... gültige Korridorbreite jeder Abflugroute festgelegt".
Konkret erfährt man da aber auch nur:
"Die Frankfurter Abflugrouten sind ... mit Flugerwartungsgebieten umgeben, die Sollkursabweichungen von mindestens einer Seemeile (1852 m) links bzw. rechts der Route zulassen. Entlang bestimmter Routen sind die Breiten grösser."
Wo genau wie damals geflogen werden durfte, konnte man daraus aber auch nicht erkennen.
In der gleichen Zeitschrift wurde Monate später die darauf einsetzende Diskussion
zusammengefasst,
und neben zwei Links zu Informationsseiten der Deutschen Flugsicherung auch ein Schreiben des Luftfahrt-Bundesamtes LBA
veröffentlicht,
das die Rechtsauffassung des Amtes so beschreibt:
"Im Übrigen verstößt ein Luftfahrzeugführer grundsätzlich bereits bei jedem Verlassen der allein rechtlich maßgeblichen so genannten Ideallinie gegen die als Rechtsverordnung erlassene Flugroute. Die allein verwaltungsintern zur Anwendung kommende Grenze des ... zu jedem Flugverfahren errechneten Flugerwartungsgebietes bestimmt dabei jenen Bereich, in dem das Verlassen der Idealspur ... gerechtfertigt sein kann, weil es auch bei Anlegen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt unvermeidbar sein könnte. ... Das ausgewiesene Flugerwartungsgebiet wirkt somit als Puffer zu Gunsten des Täters, der bereits bei Verlassen der Idealspur tatbestandlich handelt."
Wo dieses "Flugerwartungsgebiet" ausgewiesen worden wäre, konnte allerdings auch das LBA nicht erklären.
Die oben erwähnten Links zu Erläuterungen der Fraport oder der DFS sind alle seit vielen Jahren tot, auch in öffentlich zugänglichen Internet-Archiven konnten wir die Dokumente nicht finden. Stattdessen gibt es heute auf den Seiten
der Fraport,
der DFS
und
des BAF
nur ganz allgemeine Aussagen über
"Abweichungen von Abflugstrecken",
in denen von "Streckenkorridoren" oder "Toleranzgebieten" die Rede ist, die allerdings auch nirgendwo genauer beschrieben werden. Die DFS gibt lediglich an, es seien
"Abweichungen von der Abflugroute um mehrere hundert Meter möglich".
Das bedeutet also, dass sowohl die hiesige Fluglärmschutzbeauftragte als auch das LBA zur Beurteilung des ordnungsgemäßen Verhaltens von Flugzeugführern Konstrukte benutzen, auf deren Existenz und Ausdehnung jeglicher Hinweis getilgt worden ist.
Wir konnten nur eine einzige grafische Darstellung eines solchen Flugerwartungsgebietes finden. In einer
Präsentation
im Rahmen des
Konsultationsverfahrens zur Flugroute AMTIX-kurz
des FFR im Jahr 2018 gibt es eine Folie, auf der die Flugroute vom Ende der Startbahn West über Darmstadt nach Südosten von einem rosa Band umgeben ist, das sich bis auf rund 20 Kilometer Breite ausweitet. Um einen solchen Bereich zu verlassen, kann ein Pilot, der diese Route fliegen sollte, nur entweder völlig desorientiert sein oder sich plötzlich entschieden haben, woanders hin zu wollen.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es auch im
Forschungs-Informations-System Mobilität und Verkehr
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr einen Eintrag
Flugerwartungsgebiet
gibt, aber der stammt aus dem Jahr 2004 und ist damit ebenso überholt wie die politischen Ansichten des zuständigen Ministers.
Bleiben noch die ständigen Hinweise auf ICAO-Regeln, nach denen diese Gebiete angeblich mal konstruiert wurden. Da nähere Angaben fehlen, kann man nur nach Regeln und Begriffen suchen, die inhaltlich etwas mit der Fragestellung zu tun haben könnten, wann, warum und wie weit Piloten von vorgegebenen Flugrouten abweichen können.
Da wird man fündig in
ICAO Dokument 8161
in dem eine
"Cross-track tolerance "
und eine
"Along-track tolerance "
definiert werden, seitliche Abstände von der Ideallinie, in die die Unsicherheiten der technischen Navigations-Ausstattung an Flughafen und Flugzeug und die Manövrierfähigkeit des Fluggeräts eingehen. Diese Grössen werden verwendet, um Vorgaben für die Konstruktion von Flugrouten unter unterschiedlichsten lokalen Bedingungen und für alle Flugphasen zu entwickeln und dabei insbesondere ausreichende Abstände und Hindernisfreiheit zu gewährleisten. Was davon jeweils wofür zu verwenden ist, müssten technischen Expert:innen genauer aufschlüsseln.
Als Laie bekommt man zumindest den Eindruck, dass mit halbwegs moderner Navigation Korridore mit maximalen Breiten zwischen 0,5 und 2 nautischen Meilen (900 - 3.600 Meter) möglich sein sollten.
Bei der Einführung solcher modernen Verfahren wollte Frankfurt mal
Vorreiter sein,
aktuell sieht es allerdings so aus, als würde die
Deadline 25 Januar 2024
nur gerade so eingehalten.
Aber auch, wenn alle diese Verfahren veröffentlicht sind: die Methoden ihrer Festlegung und die Berechnung der verwendeten Korridore werden nicht mit veröffentlicht. Die dafür von ICAO angegebenen Gleichungen sind zwar keine höhere Mathematik, trotzdem lassen sich diese Berechnungen nicht ohne weiteres nachvollziehen, so dass die Korridore nach wie vor nicht bekannt werden. Damit wissen weder die Piloten genau, wo sie noch bußgeldfrei fliegen dürfen, noch weiss die lärmgeplagte Bevölkerung, wann eine Beschwerde Erfolg haben könnte.
Man kann aber auch nicht darauf hoffen, dass die zuständigen Behörden von selbst prüfen würden, dass ihre Vorgaben eingehalten werden. Zu den Prüfungen
erläutert das FFR:
"Wenn Flugbewegungen aufgefallen sind, z.B. infolge von Beschwerden, aufgrund außergewöhnlicher Werte an den Messstellen der Fraport oder aus sonstiger Überprüfung, dann wird jeder einzelne Flug überprüft."
Wenn sich aber niemand beschwert, das Flugzeug nicht extrem niedrig über eine der wenigen offiziellen Meßstellen donnert und nicht zufällig sonst jemand hinguckt, passiert nichts.
Es wäre daher allerhöchste Zeit, auch diese Verfahren auf einen modernen Stand zu bringen. Der 25.01.2024 wäre ein gutes Datum, um die nach altem DFS-Geheimrezept selbstgebackenen "Flugerwartungsgebiete" endgültig zu beerdigen und die neuen Standards für die noch tolerablen Flugrouten-Abweichungen zu veröffentlichen. Zwar ist zu befürchten, dass auch dann noch Wohngebiete in Raunheim und einigen anderen Kommunen unter diesen Korridoren liegen werden, aber das "Flugerwartungsgebiet Raunheim", das auch bei Abflügen als Ganzes beliebig überflogen werden darf, sollte der Vergangenheit angehören.
Die Einhaltung dieser Korridore müsste allerdings auch konsequent kontrolliert werden. Im Interessen von Lärmschutz und Sicherheit darf das Motto "Wenn keiner motzt, ist alles in Ordnung" ebenfalls nicht mehr länger gelten. Eine regelmäßige Überwachung durch eine unabhängige Stelle und ein ebenfalls dort angesiedeltes Beschwerde-Management, das Meldungen aus der Bevölkerung ernsthaft untersucht und qualifiziert beantwortet, sind schon lange überfällig.
Wenn man der DFS dann noch beibringen könnte, Lärmschutz ernst zu nehmen und keine Freigaben über Wohngebiete zu erteilen, nur weil das für Airlines gerade bequemer ist, dann könnten uns künftig vielleicht wirklich einige Belästigungen erspart bleiben.
P.S:: Beim Fertigstellen dieses Beitrags nervten schon wieder zwei startende Überflüge über das Stadtgebiet kurz hintereinander. Weil es gerade passt und deutlich macht, dass das keine Ausnahmefälle sind, haben wir sie mit dokumentiert.
Für die Überflüge am 12.08. teilt der 'Fraport Nachbarschaftsdialog' mit:
"Die durch die Fluglärmschutzbeauftragte erfolgte Überprüfung ... ergab, dass die Flugbewegung von dem standardmäßig vorgesehenen Flugverfahren abwich. Weitere Überprüfungen ... ergaben, dass die Abweichung wetterbedingt erfolgte."
Welche dramatischen Wetterereignisse dafür verantwortlich gewesen sein sollen, wird nicht mitgeteilt.
Unsere "weitere Überprüfung" ergibt, dass es inzwischen wohl wichtiger ist, dass Flugzeuge beim Start nicht nass werden, als dass die Bevölkerung vor unnötigem Fluglärm geschützt wird.
Die vollen Antworten und unser etwas ausführlicherer Kommentar dazu finden sich auf der
Detail-Seite.
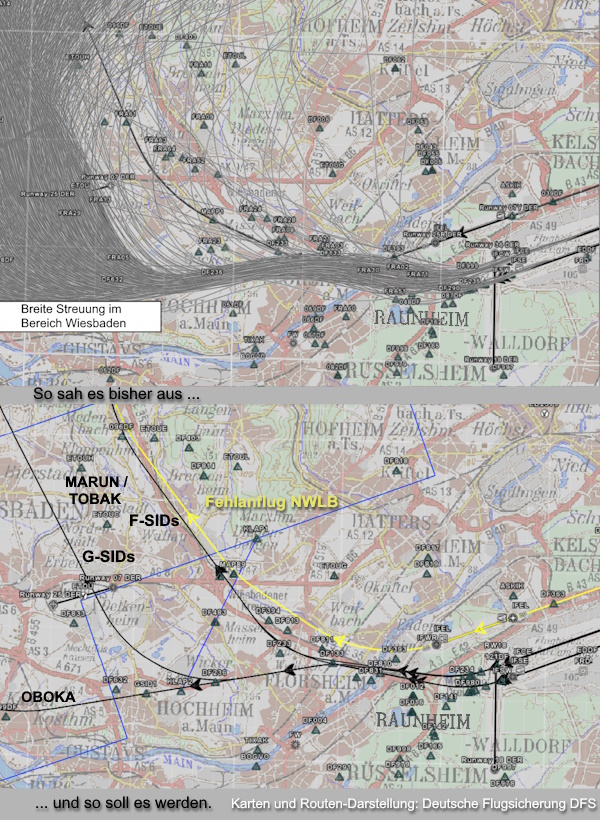
23.07.2023
In der jüngsten Sitzung der Fluglärmkommission am 19.07. konnte die Deutsche Flugsicherung stolz
präsentieren,
dass auch die Nordwest-Abflugstrecken bei der Umstellung auf das neue Navigationsverfahren
Performance-Based Navigation PBN
(mit zwei kleinen Ausnahmen)
"unverändert bleiben"
können.
In knapp einem Jahr, bis zum 11.07.2024, sollen die Routen umgestellt sein.
Die Fluglärmschutzbeauftragte hat die Lärmwirkungen dieser Umstellung
modellieren lassen
und kann erfreut feststellen:
" Maßnahme ist neutral zu bewerten aus Lärmschutzsicht".
Wegen bestehender Unsicherheiten in den Modellierungs-Annahmen wird sie ein
"Monitoring durchführen, ob Annahmen zu Verlauf, Streuung ... sich bestätigen sowie, ob Auffälligkeiten bei Höhe etc. festzustellen sind".
Die beiden kleinen Ausnahmen verdienen allerdings durchaus etwas Aufmerksamkeit, und ein grundsätzliches Problem spielt in der Diskussion bisher auch eine zu geringe Rolle.
Zur
ersten Ausnahme
schreibt die DFS in ihrer Präsentation:
"Zur Vermeidung der Streuung über Wiesbaden wird der Verlauf der Kurve leicht angepasst".
Das klingt völlig harmlos, und der Vergleich der alten und neuen Route zeigt auch nur eine minimale Abweichung zwischen Hochheim, Wicker und Delkenheim, aber der Kern der Aussage ist auch nicht diese Abweichung, sondern die "Vermeidung der Streuung über Wiesbaden".
Bisher war festgelegt, dass von der Route entlang des Mains erst nach Norden abgedreht werden darf, wenn ein fester Punkt erreicht ist, aber auch eine Mindesthöhe von 3500 ft (ca. 1.000 m über Grund). Das führte dazu, dass die Abflüge sich über einen sehr breiten Bereich über Wiesbaden verteilten, weil die Steigeigenschaften je nach Flugzeugtyp und Startgewicht sehr unterschiedlich sind und die vorgegebene Höhe zu sehr verschiedenen Zeitpunkten erreicht wurde.
Diese "breite Streuung" soll nun vermieden werden, indem ein fester Abdrehpunkt unabhängig von der erreichten Höhe festgelegt wird. Das hat absehbar zwei Effekte für die Betroffenen unter der Idealroute: sie werden häufiger überflogen, weil die seitlichen Verschiebungen wegfallen, und sie werden niedriger überflogen, weil keine Höhenvorgabe mehr existiert und viele bisher später nach Norden abgedreht sind, weil sie die Mindesthöhe eben noch nicht erreicht hatten. In den Lärmberechnungen wird der erste Effekt erfasst, aber durch die Entlastung der künftig nicht mehr Überflogenen kompensiert, der zweite allerdings nicht bzw. nur sehr unvollständig.
Natürlich müssen aus Sicherheitsgründen trotzdem noch die Mindestflughöhen nach der einschlägigen
EU-Verordnung
eingehalten werden, aber die liegen deutlich niedriger (600 m bzw. 2.000 ft über Grund, mit Ausnahmen).
Der lokale Vertreter der 'Bundesvereinigung gegen Fluglärm' hat versucht, mit Hilfe eines
Änderungsantrags
zur
Beschlussvorlage des FLK-Vorstands
u.a. die Mindesthöhe von 3.500 ft wieder einzuführen, das wurde allerdings von der Mehrheit der FLK abgelehnt. Das 'Bündnis der Bürgerinitiativen' kritisiert das in einer
Pressemitteilung
als "Förderung von vermeidbarem Lärm durch Absenkung von Flughöhen".
Für die Ablehnung der Einführung einer Mindestflughöhe durch die FLK-Mehrheit haben vermutlich unterschiedliche Motive eine Rolle gespielt. Für viele (insbesondere im Vorstand) sind die Ergebnisse der Lärm-Modellierung mit Dauerschallpegeln < 48 dB(A) und durchschnittlich weniger als ein Überflug pro Stunde sowie der Aussicht, dass ihr Lieblings-Bewertungsmaßstab, der
Frankfurter Fluglärm-Index,
sogar abnimmt, kein Grund, zusätzliche Maßnahmen einzuführen.
Andere sehen wohl eher die Auswirkungen auf die Abläufe auf FRA insgesamt. Wenn
"Luftfahrzeuge, die diese Vorgabe nicht einhalten können, andere Verfahren nutzen müssen",
wird die Flexibilität der Verteilung der Abflüge auf die Bahnen und damit letztendlich die Kapazität möglicherweise eingeschränkt. Und das geht für einige sicherlich gar nicht.
Die
zweite Ausnahme betrifft das Fehlanflugverfahren
der Landebahn Nordwest (25R), d.h. die Route, die Flugzeuge nehmen sollen, wenn sie aus irgendwelchen Gründen im Landeanflug aus Osten durchstarten müssen. Dies wurde neu konzipiert mit den Zielvorgaben, einen
"Steiggradient ... geringer ... als 5% (derzeitiges Fehlanflugverfahren)"
zu erreichen, damit
"die Verläufe des Fehlanflugverfahren und der NW SID ... bestmöglich voneinander entzerrt werden". (SID:
Standard Instrument Departure,
standardisierte Abflugroute. NW SID meint die Summe aller nordwestlichen Standardrouten.)
In der FLK-Sitzung am 24.05.2023 hatte die DFS als "Vorabinformation" noch einen etwas anderen Verlauf des neuen Fehlanflugverfahrens
vorgestellt
und begründet:
"Dadurch stellt die DFS eine bessere Nutzbarkeit (& Planbarkeit) des Anflugverfahrens sicher".
Ziel sei,
"die Komplexität und das Konfliktpotenzial aus betrieblicher Sicht zu minimieren".
Eingeführt werden sollte dieses dann schon PBN-konforme Verfahren zum 13.07.2023. Stattdessen wurde zu diesem Termin dann wohl das jetzt vorgestellte, sicherlich auch PBN-konforme Verfahren eingeführt.
Diese Änderung erfolgte laut DFS,
"um einen früheren Drehpunkt und somit eine Entzerrung von den F-/G-SID zu realisieren - dadurch ein etwas höherer Steiggradient des Fehlanflugverfahrens (4,5% im Vergleich zu 4,3%)".
In der Konsequenz führen die Fehlanflüge künftig also niedriger und weiter östlich nach Norden (Eddersheim und Weilbach dürfen sich freuen, da sie dabei direkt überflogen werden). In die Lärmbetrachtungen geht das natürlich nicht ein - Fehlanflüge sollen ja selten sein.
Das Ziel der "Entzerrung" wird damit allerdings nur sehr begrenzt erreicht. Ob in der ersten Abflug-Phase auf den N-SIDs durch PBN wirklich eine so viel bessere 'Spurtreue' erreicht wird, dass die Routen nicht mehr wie heute überlappen, ist zweifelhaft. Auch führt der geringere Steiggradient nicht dazu, dass schon in dieser Phase eine sichere Höhenstaffelung erreicht werden könnte.
Um einen "inhärent sicheren" Betrieb zu erreichen und Zwischenfälle zu vermeiden, wie sie
schon häufig
auf der Südbahn, aber auch
schon öfter
auf der Nordwestbahn vorgekommen sind, müsste also eine zeitliche Staffelung, d.h. ein abhängiger Betrieb zwischen den benachbarten Bahnen, eingeführt werden. Die DFS hat das vor ein paar Jahren
schon mal eingesehen,
glaubt aber inzwischen wieder,
darauf verzichten
zu können.
Warum aber wird dann fast zwölf Jahre nach Inbetriebnahme der Nordwestbahn ein neues Fehlanflugverfahren eingeführt? PBN ist, wie die DFS selbst schreibt, nicht der einzige, nicht einmal der wichtigste Grund. "Inhärent sicher" wird das Ganze dadurch auch nicht, d.h. auftretende Konflikte müssen weiterhin von den zuständigen Lotsen gelöst werden. Für die soll aber wenigstens "die Komplexität und das Konfliktpotenzial" minimiert und "eine bessere Nutzbarkeit (& Planbarkeit)" erreicht werden. Dass das jetzt als notwendig betrachtet wird, verweist auf das grundsätzliche Problem, das bislang unterbelichtet bleibt.
Im FLK-Beschluss zur PBN-Umstellung der Nordwestabflüge wird am Ende darauf hingewiesen,
"dass die Problemlage der erhöhten Nutzungsanteile der Nordwest-Abflugstrecken unverändert fortbesteht. Nach dem Betriebskonzept, das dem Planfeststellungsbeschluss zu Grunde lag, sollten nur noch 1,5% der Flugzeuge die Nordwest-Abflugstrecken nutzen, um Doppelbelastungen im hochbetroffenen Nahbereich (Anflüge bei Betriebsrichtung 07) so weit wie möglich zu vermeiden. Die tatsächlichen Nutzungsanteile liegen aufgrund des stetig ansteigenden Anteils an zweistrahligen Heavies, die nach der aktuellen Rechtsverordnung die Nordwest-Abflugstrecken nutzen dürfen, deutlich darüber".
Aus den Zahlen der Lärmberechnung geht ausserdem hervor, dass auch andere Flugzeugtypen, darunter insbesondere vierstrahlige Heavies, diese Routen zunehmend nutzen. Grund dafür ist offenbar, dass die
Probleme der Südumfliegung
nach wie vor
nicht gelöst
sind und auch durch die PBN-Umstellungen
nicht beseitigt
werden.
Sollen die Flugbewegungszahlen, wie von Fraport gewünscht, weiter steigen, kann die Nutzung der Nordwestabflüge also nicht, wie ursprünglich versprochen, auf Ausnahmesituationen begrenzt werden, sondern muss wieder ansteigen. Frühere Lärm-Abwägungen werden dadurch Makulatur, die Belastungen werden absehbar stärker ansteigen, als die vorliegenden Berechnungen aussagen. Die Forderung der FLK,
"dass eine systematische Mehrbelegung der Nordwest-Abflugstrecken so weit wie möglich vermieden wird",
wird wohl mit der Aussage beantwortet werden: "leider nicht weiter möglich".
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass auch diese Umstellung dazu genutzt wird, aus einem völlig verkorksten, heute schon überlasteten Bahnensystem noch mehr Kapazität herauszuquetschen, und das wiederum auf Kosten der Sicherheit.
Die Fluglärmkommission sollte aufhören, hilflose Bitten um Detail-Verbesserungen oder Nicht-Verschlechterungen zu formulieren. Stattdessen müsste sie die grundlegenden Probleme dieses Flughafens angehen und dazu mit den kommunalen Gremien Forderungen erarbeiten, die die wesentlichen Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung in den Mittelpunkt rücken - weniger Lärm und mehr Sicherheit. Ohne dem Flughafen Grenzen zu setzen, wird das nicht funktionieren.
Nur damit kann aber letztendlich dauerhaft verhindert werden, dass die ultimative kapazitäts-steigernde Flugroute doch noch eingeführt wird - der
Direktabflug nach Westen bei Betriebsrichtung 25. Damit würden dann Raunheim und andere Teile des westlichen Rhein-Main-Gebietes endgültig unbewohnbar.
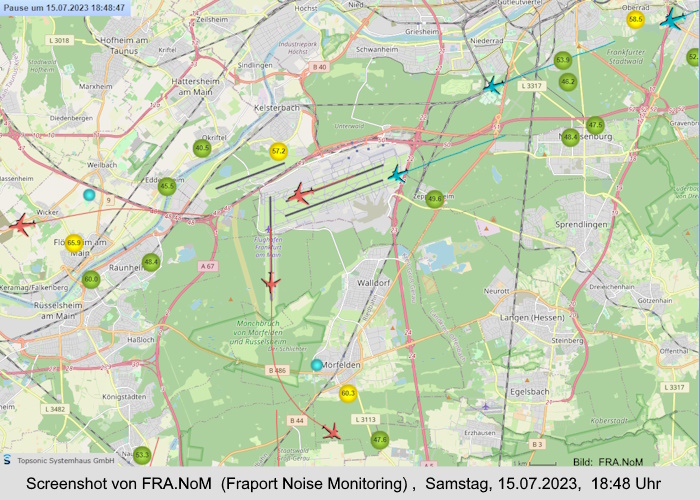
"Sicherheitsabstände erhöht" ? Hier werden nicht einmal die elementaren Anforderungen für den abhängigen Betrieb zwischen Centerbahn und Südbahn eingehalten ! Und das ist (nicht nur an diesem Abend) keine Ausnahme.
20.07.2023
Am Sonntag, den 16.07.,
meldet
das Verkehrsministerium
"24 verspätete Starts in der Nacht zum Sonntag"
und begründet für die Öffentlichkeit:
"Wegen Unwettern am Samstag ... kam es ... zu Verzögerungen im Flugbetrieb. So musste am Nachmittag die Abfertigung wegen Gewittern am Platz eingestellt werden. Bis in den Abend hinein mussten so genannte Air-Traffic-Control-Maßnahmen (ATC) ergriffen werden, die die geordnete Verkehrsabwicklung ... sicherstellen. Dabei werden die Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen sowohl bei den Anflügen als auch bei den Abflügen erhöht."
Das wurde dann genauso z.B. auch von der Hessenschau
weitergemeldet.
Die ersten beiden Sätze sind richtig, die beiden anderen dienen wieder einmal dazu, den wahren Sachverhalt zu verschleiern. Zwar lassen sich nicht alle Abläufe von aussen exakt erkennen und in ihrer Ursache bestimmen, aber es gibt ausreichend Indizien, um sich ein Bild zu machen.
In diesem Bild tauchen ATC-Maßnahmen, die zu "erhöhten Sicherheitsabständen" bei Starts und Landungen führen, nicht auf, ebensowenig wie in der 'offizielleren' Begründung der Aufsichtsbehörde in den monatlichen
Verspätungstabellen.
Über die wahren Gründe für die verspäteten Starts muss man also spekulieren.
Die Wetterlage an diesem Tag lässt sich gut dokumentieren. Laut METAR tobten über eine Stunde lang (16:20 - 17:20+ Uhr) Gewitter über dem Flughafengelände. Bis etwa 18:00 Uhr wehte heftiger Wind (bis 10 Knoten, Böen bis 20 Knoten) aus südwestlichen bis südlichen Richtungen.
Offenbar als Konsequenz fanden von 16:27 - 17:39 Uhr keine Starts statt, die Startbahn West wurde erst um kurz vor 18:00 Uhr wieder in Betrieb genommen. Danach erfolgten über eine Stunde lang Starts in relativ dichter Folge. Landungen erscheinen mehr oder weniger unbeeinflusst; in der Zeit, in der nicht gestartet wurde, fanden 40 Landungen statt.
In der Zeit nach 19:00 Uhr wechselten einige Phasen dichteren Betriebs mit längeren, sehr ruhigen Phasen ab - so ruhig, dass die Landebahn Nordwest über längere Zeit garnicht genutzt wurde. Hätte es einen Engpass bei den Startkapazitäten gegeben, hätte man durch deren Nutzung Kapazitäten auf dem Parallelbahnsystem freimachen können. Das war aber in keiner Weise nötig.
Von "erhöhten Sicherheitsabständen durch ATC-Maßnahmen" ist im Ablauf nichts zu sehen. In den dichteren Phasen waren die Staffelungsabstände eng wie immer, und in den ruhigen Phasen zufällig und nicht durch Sicherheitsvorgaben bestimmt.
Warum kam es also zu den verspäteten Starts? Ein
dramatisches Ereignis
wie vor vier Wochen war es wohl nicht. Es mag Engpässe gegeben haben, aber sie lagen nicht in mangelden Startkapazitäten auf den Bahnen. Es wäre den ganzen Abend über mehr als genug Zeit gewesen, all die Maschinen in die Luft zu bringen, die am Nachmittag wegen Gewitter nicht starten konnten.
Natürlich müssen startende Maschinen am Ziel auch landen können. Eine Stichproben-Überprüfung der Zielflughäfen zeigt aber, dass Engpässe dort nicht generell der Grund gewesen sein können. Zudem waren unter den Starts auch wieder sechs Kurzstrecken-Ziele (Basel, Wien, Leipzig, Dresden, München, Paris; alle Lufthansa), für die es ohnehin keine Rechtfertigung geben kann.
Wenn die Engpässe aber auf Personalmangel und/oder organisatorischem Unvermögen von Fraport und Airlines beruhen, rechtfertigen sie keine Ausnahmegenehmigungen, die die betroffene Bevölkerung gerade in Sommernächten erheblich belasten.
Dass die Aufsichtsbehörde den Dilettantismus der Flughafen-Betreiber durch falsche Aussagen verschleiern und zulasten der Gesundheit der Bevölkerung ausbügeln hilft, wird langsam schon zur Gewohnheit, bleibt aber nichtsdestoweniger ein Skandal.
Um dieses Verhalten zu ändern, reicht es nicht, wenn die Fluglärmkommission einen dürftigen
Beschluss
fasst, der die Behörde nur schüchtern an die Rechtslage erinnert und nicht einmal Aufklärung zu den angesprochenen fragwürdigen Genehmigungen verlangt. Um echten Druck zu entwickeln, müsste die FLK von der Behörde unabhängige Ressourcen einsetzen, um die Genehmigungspraxis zu überprüfen und an den Lärmschutz-Notwendigkeiten zu orientieren. Dafür wiederum müssten die Bürger:innen ihren Vertreter:innen dort und in anderen Gremien entsprechenden Druck machen.
Vorwahlzeiten sind dafür in der Regel die beste Gelegenheit - und die Landtagswahlen in Hessen sind nicht mehr weit (am 8. Oktober). Und die Behörde, die hier regelmäßig die Interessen der Bevölkerung mißachtet und der Fraport zudiensten ist, ist eine Landesbehörde. Wer in den Landtag gewählt werden will, sollte eine Idee haben, wie sich deren Verhalten ändern lässt.
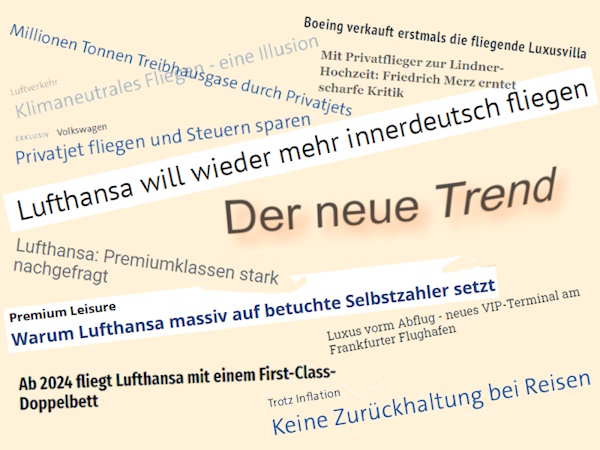
Alle Überschriften sind unverändert und aus Medien, die gemeinhin als seriös gelten.
12.07.2023 (Update 13.07.2023)
Klimaschutz war gestern - heute ist Luxus angesagt. Wenn die Erde sowieso vor die Hunde geht, muss man die Zeit bis dahin so gut wie möglich nutzen. Geben wir das Geld aus, solange man noch etwas Schönes dafür kaufen kann.
Solche oder ähnliche Endzeit-Stimmungen scheinen immer mehr Menschen zu befallen. Die Marketing-Abteilungen der grossen Konzerne reagieren prompt, versuchen garnicht mehr, ihre Produkte als irgendwie klima-verträglich zu vermarkten, sondern stellen den - vorgeblich unbeschwerten - Genuss in den Vordergrund.
Die Luftfahrt-Industrie greift diesen Trend begierig auf. Ihr ist sehr wohl bewusst, dass ihre Klimaschutz-Versprechen
schon immer unglaubwürdig
waren, und sie verzichten gerne darauf, diesen Unsinn weiterhin vertreten zu müssen.
So kann auch Lufthansa ungeniert einen neuen
Premiumkurs
ankündigen, bei dem mit der gleichen Menge Kerosin deutlich weniger Passagiere befördert werden, und auch den
Kurzstrecken-Flugverkehr
wieder ausbauen, der völlig überflüssig und deutlich klimaschädlicher ist als jede konkurrierende Art der Fortbewegung. Irgend eine Art von Rechtfertigung dafür halten sie nicht mehr für nötig.
Allerdings setzt sich auch dieser Trend nicht bruchlos durch. Zum einen steht ihnen auch hier die zunehmende Unfähigkeit im Weg, die eigene Produktion inklusive der Lieferketten zuverlässig zu organisieren. Zumindest mit der neuen First Class
dauert es etwas länger,
weil die Stühle nicht pünktlich geliefert werden.
Zum anderen verbindet z.B. das Handelsblatt sein
Bedauern
über die Verzögerung mit der Warnung:
"Sicher ist ein anhaltender Trend zum Premium keineswegs".
Seine
Prognose
für die Entwicklung des Luftverkehrs in Europa zeigt viele Risiken auf, von möglicher
"Zurückhaltung bei den Geschäftsreisen"
über wachsende Konkurrenz im Interkontinentalverkehr bis zu steigende Klimakosten.
Bei der notwendigen Konsequenz herrscht aber wieder Einigkeit. Was Lufthansa
schon lange fordert
und die Politik
noch länger forciert,
soll endlich in noch drastischerem Ausmaß erreicht werden:
"eine Konsolidierung",
nach der es
"auch in Europa auf Dauer nur noch drei große Netzwerk-Airlines und einen großen Billiganbieter geben"
soll. Gute Perspektiven für die Lufthansa-Gruppe, AirFrance-KLM, IAG und Ryanair.

Aber dummerweise verschwindet die Klimakatastrophe nicht, nur weil viele nichts mehr von ihr hören wollen. Und gerade die Luftfahrt bekommt das immer deutlicher zu spüren. So ist in weiten Teilen der USA am Vorabend ihres Unabhängigkeitstages der
Luftverkehr zusammengebrochen,
weil
"weite Teile des Ostens von Stürmen bedroht wurden, während der Süden und Westen weiterhin in einer Hitzewelle ausdörrten" (eigene Übersetzung).
Wegen der Rauchentwicklung durch die seit Wochen anhaltenden,
ausgedehnten Waldbrände
in Kanada gibt es
zahlreiche Flugverspätungen
in ganz Nordamerika, und auch aus China werden wetterbedingte Einschränkungen gemeldet.
Über dem Atlantik und Nordamerika führt die klimabedingte
Zunahme von Klarluft-Turbulenzen
dazu, dass Fliegen unangenehmer, teilweise sogar gefährlicher wird, weil sich Passagiere und Crew-Mitglieder verletzen können. Und auch hierzulande zeigt der
Beinah-Crash
auf FRA Ende Juni, dass die zunehmenden extremen Wetterereignisse den Luftverkehr massiv beeinträchtigen können.
Was der Luftverkehr in nächster Zeit tun will bzw. muss, um sich an die veränderten Bedingungen anzupassen, kann man sich von der zuständigen Eurocontrol-Mitarbeiterin erklären lassen (leider nur auf englisch).
Diese Anpassungsstrategien gehen aber implizit oder explizit davon aus, dass das Ziel des Pariser Abkommens, den Temperaturanstieg auf der Erde auf "deutlich unter 2°C" zu beschränken, auch eingehalten wird. Die Luftverkehrswirtschaft muss sich aber in wissenschaftlichen Untersuchungen immer und immer wieder vorrechnen lassen, dass ihre eigenen Maßnahmen zu einem
sehr viel höheren Anstieg
führen werden.
Jüngstes Beispiel ist eine gerade veröffentlichte
Studie
aus der Schweiz. In der
Pressemeldung
dazu wird klar gesagt:
"Fossiles Kerosin durch künstlich hergestellten, nachhaltigen Treibstoff zu ersetzen, reicht alleine nicht. Zusätzlich notwendig wäre eine Reduktion des Flugverkehrs."
Und das, obwohl die Studie im optimistischsten Szenario davon ausgeht, dass Technologie und Infrastruktur sowohl für die Produktion von "Sustainable Aviation Fuel" durch direkte CO2-Abscheidung (Direct Air Carbon Capture and Usage, DACCU) und Wasserstoff-Gewinnung unter ausschließlichem Einsatz erneuerbarer Energien als auch für die permanente geologische Speicherung von Kohlenstoff (Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS) zur Kompensation der verbleibenden Klimaeffekte so schnell wie technisch möglich entwickelt werden - ein Ziel, das die Autor:innen "ambitioniert" nennen.
Angesichts der
realen Entwicklungen
bei Maßnahmen zum Klimaschutz würde man wohl besser von einem Wunschtraum reden. Die weltweiten Treibhausgas-Emissionen fallen nicht, wie angestrebt, sondern
steigen wieder.
Nur die Klimakatastrophe selbst entwickelt sich schneller und umfassender als gehofft.
Aktuell
meldet
die Meteorologische Weltorganisation WMO:
"Nach vorläufigen Daten hat die Welt gerade ihre heisseste Woche erlebt. Sie folgt dem heissesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen, noch nie dagewesenen Ozeantemperaturen und der niedrigsten Ausdehnung des antarktischen Meereises."
Und das
"zu Beginn der Entwicklung eines El Nino, der voraussichtlich die Hitze auf dem Festland und in den Ozeanen weiter antreiben und zu noch extremeren Temperaturen und marinen Hitzewellen führen wird" (eigene Übersetzung).
Die Vorhersagen lauten, dass die
gerade begonnene El Nino-Periode
neun bis zwölf Monate andauern und mindestens von mittlerer Stärke sein wird. Dabei besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die vom Pariser Abkommen gezogene 1,5°C-Grenze temporär, wahrscheinlich in 2024, überschritten wird, mit entsprechenden Folgen. Im Update für Juli, August und September 2023
"werden ohne Ausnahme positive Temperatur-Anomalien über allen Landgebieten der nördlichen und südlichen Hemisphäre erwartet", mit Extremniederschlägen und Dürren, Hitzewellen, Stürmen usw..
Was folgt daraus? Die Luftverkehrswirtschaft beweist gerade einmal mehr, dass sie ihre Strategien ausschließlich daran ausrichtet, was kurzfristig den meisten Profit bringt. Selbstverpflichtungen für mehr Klimaschutz und entsprechende Programme sind Makulatur, noch bevor sie gedruckt bzw. online gestellt sind. Klimaschutz im Luftverkehr durchzusetzen, fünktioniert kurzfristig nur über das Ordnungsrecht, d.h. wie in den
Kampagnen gegen Luxus-Emissionen
gefordert, durch Verbote und Beschränkungen der unnötigsten Aktivitäten.
Langfristig muss der Luftverkehr, wie alle Elemente der öffentlichen Daseinsvorsorge, dem Profitprinzip entzogen und an den gemeinsamen Interesse der gesamten Gesellschaft orientiert werden. Und da steht das Interesse an einer gesicherten Lebensgrundlage in einer stabilen, lebensfähigen Umwelt weit vor dem an einer Hyper-Mobilität, die uns heutzutage als Normalität verkauft werden soll.
Auch dieses Ziel ist "ambitioniert" - aber alternativlos.
Nein, wir haben es nicht angestiftet, aber es ist auch kein Zufall, dass am Tag nach Erscheinen dieses Beitrag Aktivist:innen der "Letzten Generation" Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf
blockiert haben.
Ebenso wenig ist es Zufall, dass daraufhin die Ganz Grosse Koalition der Klimaschutz-Versager wieder
verbal Amok läuft,
von "schweren Straftaten" schwafelt und "langjährige Haftstrafen" fordert. Auch das
liegt im Trend.
Die Begründung für die Blockade-Aktionen ist sehr plausibel:
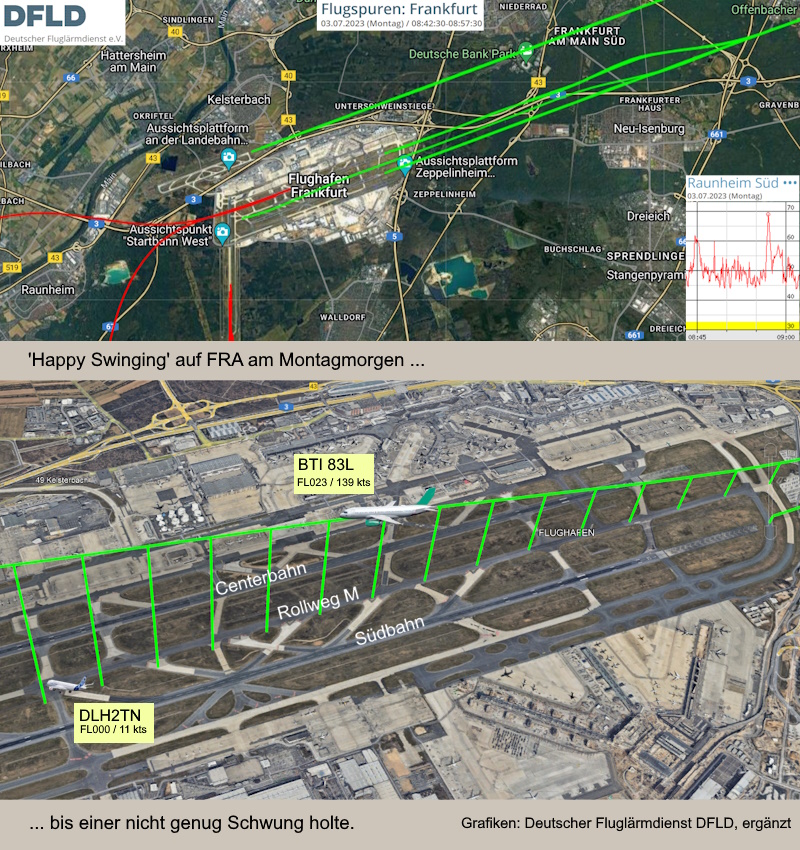
10.07.2023
Wieder einmal ist es der Aviation Herald, der über einen Zwischenfall
berichtet,
der der Öffentlichkeit sonst wohl verborgen geblieben wäre.
Die Meldung besagt, dass ein A319 der CarpatAir aus Riga im Anflug auf die Südbahn vom Tower auf die Centerbahn "geswingt" werden sollte, stattdessen aber den Rollweg zwischen den beiden Bahnen anflog, auf dem ein A320 der Lufthansa unterwegs war. Die Piloten bemerkten den Irrtum in einer Höhe von etwa 60 Meter über Grund, starteten durch und landeten im zweiten Versuch sicher auf der Südbahn.
Will man es positiv sehen, kann man festhalten, dass der A319 möglicherweise auch auf dem Rollweg ohne Schaden hätte landen können. Der A320 hat den Rollweg nur gekreuzt, und soweit man den zeitlichen Ablauf nach den zur Verfügung stehenden Daten beurteilen kann, wäre es wahrscheinlich nicht zu einem Zusammenstoß gekommen.
Denkt man negativ, hätte es passieren können, dass die Piloten den Fehlanflug zu spät bemerken, die beiden Flugzeuge zusammenstossen und einige hundert Menschen sterben.
In jedem Fall gibt es zu dem Vorfall im Hinblick auf die Sicherheit des Betriebs auf FRA einiges anzumerken.
Das Verfahren, aus Osten anfliegende Maschinen hinter Offenbach vom Anflug auf die Südbahn auf die Centerbahn zu "swingen", ist schon 10 Jahre alt und soll dem Lärmschutz in Neu-Isenburg dienen. Die DFS hat die Einführung im November 2013 in der Fluglärmkommission formell
beantragt,
praktiziert wurde es auch vorher schon.
Auch
Zwischenfälle
gab es bereits. Im September 2018 steuerte ein A321 der Tunisair ebenfalls nach einem Swing den Rollweg M an und startete rechtzeitig durch. Da allerdings startete auch ein A320 von der Centerbahn und kreuzte seinen Flugweg, aber es war gerade noch genug Abstand. Einzig erkennbare Konsequenz aus diesem Vorfall: laut Pilotenaussagen in den Kommentaren des Aviation Herald gibt es jetzt in der
ATIS
eine Warnung, dass man bei einem Swing Rollweg und Landebahn nicht verwechseln sollte. Die Piloten der CarpatAir haben das aber offenbar nicht mitbekommen.
Der aktuelle Fall wirft weitere Fragen auf. Bei der Betrachtung der Flugspuren fällt auf, dass der A321 deutlich später auf den nördlicheren Anflug wechselte als die anderen geswingten Flüge. Vermutlich war es da schon zu spät, um noch auf den
Localizer
der Centerbahn zu kommen, so dass die Piloten keine Warnung erhielten, dass der Anflug nicht korrekt verlief.
Aber warum erfolgte der Swing so spät? Kam die Aufforderung (bzw. das 'Angebot') der Lotsen zu spät? Gab es Mißverständnisse über das Verfahren?
Und auf Seiten der Lotsen: haben sie nicht gemerkt, dass der Anflug nicht korrekt war? Hat der angeblich nach dem
Beinah-Absturz 2020
neu "parametrierte und aktivierte Approach Path Monitor" nicht vor dem Fehlanflug gewarnt?
Ob wir das jemals erfahren werden, ist ungewiss, denn bisher ist nicht einmal klar, ob der Vorfall weiter untersucht wird.
Was folgt aus alldem? Wir haben einen Flughafenbetreiber (Fraport) und eine Kontroll-Organisation (DFS), die einen sicheren Betrieb auf FRA gewährleisten sollen, aber hauptsächlich damit beschäftigt sind, auftretende Probleme, egal wie sicherheitsrelevant sie sind, zu vertuschen und vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Wir haben Aufsichtsbehörden, die nur dann aktiv werden, wenn die Probleme wirklich gravierend sind und sich nicht länger geheim halten lassen. Aber auch dann wird verzögert und verschleiert, bis die Vorfälle entweder vergessen sind oder eine Scheinlösung präsentiert werden kann.
Im Fall dieses "Swing over" ist es nicht einmal eine Kapazitätsfrage. die Fraport und DFS dazu verleitet,
Kapazität statt Sicherheit
an erste Stelle zu setzen, und auch der Lärmschutz spielt nicht wirklich eine Rolle. Es geht einfach nur darum, die Abläufe zu vereinfachen und zu optimieren, indem die Flugzeuge schneller zum Terminal kommen und der Kreuzungsverkehr reduziert wird. Aber selbst dafür werden Verfahren eingeführt, die sicherheitstechnisch fragwürdig sind.
Allerdings müssen sie auch zur Kenntnis nehmen, dass Piloten anscheinend immer öfter mit solchen Verfahren überfordert sind. Das zeigen nicht nur die Fälle der mißlungenen Swings, sondern auch die Beinahe-Abstürze bei einer
vorgezogenen Landung
oder bei
extremen Windbedingungen.
Wie lange wird es noch dauern, bis doch mal was gründlich schiefgeht? Die Frage ist völlig offen. Angesichts der Entwicklungen in jüngster Zeit ist man aber zunehmend geneigt zu sagen: Wenn schon, dann bitte so, dass wenigstens die Bewohner:innen im Umland von schweren Schäden verschont bleiben.
Weniger makaber betrachtet, muss man darauf drängen, dass die Sicherheitsphilosophie von Fraport und DFS dringend überarbeitet wird und in allen Bereichen darauf gedrängt wird, dass Sicherheit an erster Stellen steht - auch wenn sie den Betrieb komplizierter macht und vielleicht sogar zu Kapazitäts-Einschränkungen führt. Die wären zwar für Fraport und die Airlines ein Problem - für alle anderen aber ein echter Fortschritt.

Diese Aufnahme ist nicht exakt um 23:00 Uhr entstanden,
ein solches Szenario kann aber häufig beobachtet werden.
06.07.2023
Eine der wenigen Maßnahmen, die das Leben rund um den Flughafen etwas erträglicher machen, sind die geltenden Nachtflugbeschränkungen.
Mühsam erkämpft,
sollen sie eigentlich sicherstellen, dass von 23-24 Uhr nur in Ausnahmefällen und von 0-5 Uhr garnicht geflogen wird.
Dass diese Regelungen aus gesundheitlicher Perspektive unzureichend sind, ist praktisch unbestritten. Nächtlicher Fluglärm ist besonders belastend, für empfindliche Personen unter Umständen
sogar tödlich.
Deshalb fordert auch das Umweltbundesamt in seinem Konzept für einen
Umweltschonenden Luftverkehr
ein
"Verbot des regulären Flugbetriebs von 22 bis 6 Uhr auf stadtnahen Flughäfen"
- und "stadtnah" ist FRA allemal.
Hinter dieser Forderung bleiben die Frankfurter Beschränkungen aber deutlich zurück. Für die jeweils vom Landeanflug Betroffenen schrumpft die Ruhezeit ohnehin in der Regel auf 5 Stunden, weil Landungen zwischen 23:00 und 24:00 Uhr generell erlaubt sind, wenn sie sich
"nicht schon aus der Flugplangestaltung ergeben",
sondern verspätet sind. Auch für Starts und Landungen zwischen 0:00 und 5:00 Uhr gibt es Ausnahmen, die allerdings genehmigungspflichtig sind.
Zuständig für die Überwachung der Beschränkungen und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen ist das Verkehrsministerium, das seine Aufgabe allerdings primär in der Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von
Schlupflöchern
im Interesse der Luftverkehrswirtschaft sieht.
So hat sich schon vor Jahren gezeigt, dass die rechtlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung von Verspätungs-Landungen
unzureichend sind,
aber anstatt auf eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen hinzuarbeiten, nutzt das Ministerium die bestehende Rechtslage nur zu gerne als Entschuldigung für Untätigkeit. Landungen bis 24:00 Uhr machen daher seit Jahren einen wesentlichen Teil der alltäglichen nächtlichen Fluglärmbelastung aus, die sich für Raunheim in diesem Jahr in monatlichen nächtlichen Dauerschallpegeln über 55 dB(A) und durchschnittlich zwischen 5 und 20 lauten Überflügen pro Nacht äussert (siehe
unten).
Entsprechend
fordert
die Fluglärmkommission, im
Lärmaktionsplan
für den Flughafen Frankfurt zumindest,
"Verspätungslandungen von 23-0 Uhr nur mit Einzelfallerlaubnis und nur aus Gründen, die nicht im Einflussbereich der Fluggesellschaft liegen dürfen",
zuzulassen.
In der Statistik auffälliger sind die meist gehäuft auftretenden Ausnahmegenehmigungen für verspätete Starts, die erteilt werden, wenn der normale Betriebsablauf durch besondere Ereignisse gestört wird. Auch hier hat das Ministerium der Luftverkehrswirtschaft schon immer gerne geholfen, das eigene Versagen im Umgang mit 'Extremereignissen' wie
Gewitter
oder
Frost
durch Umgehung der Nachtflugbeschränkungen zu kompensieren. Neu ist allerdings der dreiste Versuch, dabei auch die eigentlich streng geschützte Zeit von 0:00 bis 5:00 Uhr für Flüge zu öffnen, die keine Notfälle sind.
Da ein Großteil dieser Starts normalerweise über die Startbahn West abgewickelt wird, ist Raunheim davon in der Regel weniger betroffen, es gab allerdings auch schon Ausnahmen.
Bereits im letzten Jahr hatte die Fluglärmkommission schon im Juli darauf hingewiesen, dass die "Einhaltung des Nachtflugverbots ... oberste Priorität bleiben" müsse, da aufgrund der "bestehenden Abfertigungsprobleme an den Flughäfen (Personalmangel bei gleichzeitigem Nachfrageboom an Flugreisen)" ... "im Mai und Juni 2022 sogar noch mehr Verspätungsstarts von 23-0 Uhr als im Jahr 2019" genehmigt wurden. Die Jahresbilanz 2022 brachte dann auch die Main-Spitze zu der Schlussfolgerung: "Nachtflugverbot zum Lärmschutz wird immer häufiger umgangen".
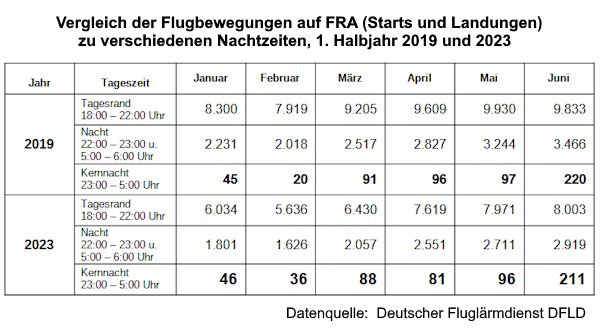
Alle Daten beziehen sich auf von den DFLD-Meßstationen erkannte Flugbewegungen,
sie können daher von den offiziellen Statistiken (geringfügig) abweichen.
Die durchschnittlichen Belastungen zu den verschiedenen Zeiten im laufenden Jahr und im Vor-Corona-Jahr 2019 zeigt die nebenstehende Tabelle. Dort wird unterschieden zwischen dem "Tagesrand", d.h. der üblichen "Feierabendzeit" von 18:00 - 22:00 Uhr, die eigentlich auch für die Erholung wichtig ist und in der Lärm nach EU-Regeln ebenfalls mit einem Zuschlag bewertet wird, der "gesetzlichen Nacht" von 22:00 - 6:00 Uhr, aber darin ausgenommen die "Kernnacht" von 23:00 - 5:00 Uhr, in der Beschränkungen für Flüge gelten.
Daraus kann man ablesen, dass am "Tagesrand", der am Flughafen natürlich als ganz normale Betriebszeit gilt, auch nicht wesentlich mehr Flugbewegungen pro Stunde abgewickelt werden als in den Nachtrandstunden, in denen diese Zahl laut gerichtlicher Auflage "an- bzw- abschwellen" soll (für Juni 2023 z.B. am Tagesrand 67, am Nachtrand 49 Flugbewegungen pro Stunde).
Für die "Kernnacht" ebenso einen Durchschnittswert von 7 Flügen pro Nacht zu errechnen, wäre zwar statistisch korrekt, verfälscht aber die wahren Sachverhalte. Im Juni 2023 entfielen von den 211 Flugbewegungen in dieser Zeit allein 115 auf die Nächte vom 20.06. bis zum 24.06, wobei der 20. mit 63 verspäteten Starts und 3 Landungen einsame Spitze ist. An diesem Tag fielen auch 6 Starts in die Zeit von 0:00 - 1:00 Uhr.
Diesen Fall nochmal näher zu betrachten, lohnt sich, weil daran die Verlogenheit, mit der die Aufsichtsbehörde versucht, solche Verspätungsstarts zu rechtfertigen, besonders deutlich wird. Als Begründung wird angeführt:
"Kapazitätsengpass aufgrund Luftraumsperrungen verursacht durch Air Defender 23 in Verbindung mit technischen Einschränkungen in Systemen der Flugsicherung und wetterbedingter ATC-Steuerungsmaßnahmen"
(ATC =
Air Traffic Control).
Der Hinweis auf das
Großmanöver AirDefender 23
soll die Ausrede dafür liefern, dass auch 6 Starts nach 0:00 Uhr genehmigt wurden. Das ist weder sachlich noch rechtlich haltbar.
Die Behörde
erläutert selbst,
was die speziell dafür erlassene
Allgemeinverfügung Air Defender 2023
enthält: die Möglichkeit,
"die regulär nur bis 23 Uhr geöffnete Landebahn Nordwest noch bis Mitternacht zu nutzen"
- sonst nichts. Auch welche sonstigen rechtlichen Möglichkeiten es für Ausnahmegenehmigungen für Starts nach 23:00 Uhr gibt, kann man da
nachlesen:
"In der Zeit von 00:00 h bis 05:00 h sind derzeit Flugbewegungen nur nach Ziffer 6 des Planfeststellungsbeschlusses in besonderen Ausnahmefällen möglich".
Dazu zählen
"Fälle besonderer Härte", "medizinischen Hilfeleistungs- oder Katastropheneinsätze", "Evakuierungsflüge", "Flüge in besonderem öffentlichen Interesse".
Nichts davon trifft auf die sechs Starts zu.
Sachlich ist es zwar nicht sicher zu beweisen (weil die genauen Manöver-Flugdaten nicht verfügbar sind), aber extrem unwahrscheinlich, dass die Luftraumsperrungen den Betrieb auf FRA an diesem Tag relevant beeinflusst haben. Zum einen waren alle Beteiligten
sichtlich stolz
darauf, dass
"Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt ... kaum merklich"
waren,
zum anderen
erklärte
der Manöver-Chef in seiner Abschlussbilanz,
"An einem Tag seien die Maschinen wegen Gewittern sicherheitshalber am Boden geblieben",
was natürlich nur jener 20.06. gewesen sein kann. Auch die Verspätungsbilanz von FRA für diesen Tag ergibt bis zum Nachmittag keine Hinweise auf einen Manövereinfluss.
Was die massiven Verspätungen an jenem Dienstag wirklich bewirkt hat, haben wir bereits vor ein paar Tagen erläutert: der
schwere Zwischenfall,
bei dem ein Transportflugzeug, das mitten im schweren Gewittersturm landen sollte, beinahe abgestürzt wäre. Danach ging eine Zeitlang auf FRA fast nichts mehr, und insbesondere die Arbeitsfähigkeit der DFS war offenbar massiv eingeschränkt - wohl weil im Tower angesichts der Manöver über dem Rollfeld Panik ausbrach. Das mit
"technischen Einschränkungen in Systemen der Flugsicherung und wetterbedingten ATC-Steuerungsmaßnahmen"
zu umschreiben, ist eine grobe Täuschung der Öffentlichkeit.
Ob Fraport und DFS in diesem Fall fahrlässig das Leben von Piloten und Bodenpersonal aufs Spiel gesetzt haben, weil sie Sicherheitsregeln missachteten und den Betrieb trotz massiver Unwetterwarnungen weiterlaufen liessen, wird (vielleicht) der BFU-Bericht zeigen. Klar ist, dass sich die Aufsichtsbehörde hier nicht nur in skandalöser Weise an der Vertuschung der entstandenen Gefahren beteiligt ist, sondern mit rechtswidrigen Maßnahmen und auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung versucht hat, den Schaden für Fraport gering zu halten.
Und das Verkehrsministerium lässt nicht nur die Lügen und Vertuschungen seiner Abteilung durchgehen, es versucht selbst, die nachfragende Presse mit absurden Argumenten hinters Licht zu führen. So
berichtet
die Main-Spitze:
"Auf die Frage nach den Gründen für die gehäuften Verspätungsflüge im Juni insgesamt verweist Ministeriumssprecherin Franziska Richter neben „Air Defender“ auch auf den Urlaubs- und Ferienflugverkehr sowie gehäufte Gewitterlagen."
Und weiter:
"55 Prozent der Verspätungsstarts führt Richter auf die Nato-Übung zurück, 21 Prozent auf Unwetter und weitere 24 Prozent auf „lange Rollzeiten“."
...
"„Lange Rollzeiten können aufgrund von erhöhten Wartezeiten in der Warteschlange vor der Startbahn 18 entstehen, nicht durch den eigentlichen Rollvorgang, der in Frankfurt mit 15 Minuten kalkuliert ist“, erklärt die Sprecherin."
...
"Als weitere mögliche Ursachen nennt sie das Wetter, Restriktionen im Luftraum, technische Probleme am Flugzeug und Notfälle wie Startabbrüche."
Hier wird offenkundig nicht einmal mehr der Versuch gemacht, auch nur halbwegs seriöse Argumente für die Genehmigungspraxis des Ministeriums zu finden. Insbesondere das Argument der "langen Rollzeiten", das wohl Verständnis bei Autofahrern wecken soll, die auch immer mal unvermutet in einen Stau geraten können, ist eine Frechheit, taucht aber dennoch auch in den offiziellen Begründungen auf.
Die dahinter stehende politische Botschaft ist eindeutig: die betrieblichen Probleme der Fraport und der Airlines haben Vorrang, Regelungen für den Schallschutz haben dahinter zurückzustehen. Dass das rechtswidrig ist, interessiert offenbar auch die politische Leitung des Ministeriums nicht. Es liegt an der betroffenen Bevölkerung, deutlich zu machen, dass sie etwas anderes will. Unser Vorschlag dafür bleibt der gleiche:

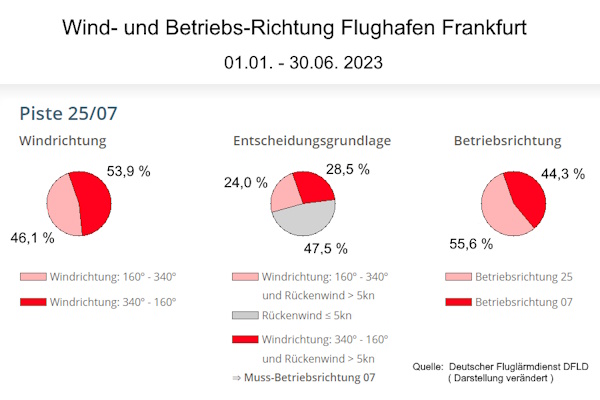
Mehr als die Hälfte der Zeit im ersten Halbjahr (53,9%) herrschte Ostwind, aber nur zu 28,5% mit mehr als 5 Knoten Rückenwind. Trotzdem wurde fast die Hälfte der Zeit (44,3%) über Raunheim angeflogen (Betriebsrichtung 07).
03.07.2023 (Update 12.07.2023)
Obwohl die Flugbewegungszahlen im ersten Halbjahr 2023 noch um rund 20% unter denen des bisherigen Spitzenjahres 2019 lagen, hat der Fluglärm in Raunheim bereits wieder beängstigende Ausmaße angenommen. Der sog. äquivalente Dauerschallpegel LAeq lag an der DFLD-Meßstation Raunheim Süd für den Monat Mai bei 59,6 dB(A), die Zahl der Lärmereignisse in der Nacht, die lauter als 68 dB(A) waren (NAT68), bei durchschnittlich 14,8 pro Nacht. Diese Werte sind höher als die Vergleichswerte vom Mai 2019.
Dass solche Ergebnisse möglich sind, liegt teilweise am Wetter, aber auch daran, wie der Flugbetrieb auf FRA organisiert wird.
Beim Wetter spielt der Wind die Hauptrolle. Da Raunheim insgesamt von den Überflügen der Landungen bei Betriebsrichtung 07 deutlich stärker belastet wird also von den Starts bei Betriebsrichtung 25, macht es einen spürbaren Unterschied, welche Betriebsrichtung gewählt wird. Das wiederum sollte in erster Linie von der Windrichtung abhängen, da Flugzeuge grundsätzlich gegen den Wind starten und landen sollten.
Für FRA gibt es allerdings, wie für viele andere Flughäfen auch, aus Lärmschutzgründen eine Sonderregelung. Da die
Lärmbelastung bei BR07
nicht nur in Raunheim, sondern im gesamten Rhein-Main-Gebiet grösser ist und auch die höchsten Belastungswerte erreicht werden, soll solange BR25 geflogen werden, bis die sog.
Rückenwindkomponente,
d.h. der Rückenwind aus Osten in Richtung der Bahn, stärker als 5 Knoten wird.
(Wegen der Bedeutung dieser Komponente haben wir für ihre Berechnung
ein eigenes Tool.)
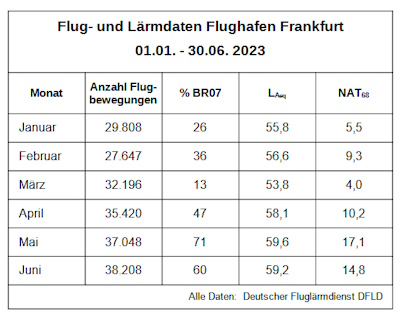
Alle Daten beziehen sich auf von den DFLD-Meßstationen erkannte Flugbewegungen, sie können daher von den offiziellen Statistiken (geringfügig) abweichen. Die Lärmwerte wurden an der Meßstation Raunheim-Süd gemessen.
Für den Flughafen Frankfurt stellt der
Deutsche Wetterdienst
sog. "Meteorological Aerodrome Reports"
METAR
und "Terminal Aerodrome Forecasts"
TAF
zur Verfügung, aus denen sich im Prinzip ablesen lässt, welche Betriebsrichtung aktuell und in der nächsten Zeit geflogen werden sollte. Vom 'Umwelthaus' gibt es auch eine
Betriebsrichtungs-Prognose,
die ein Höhenwind-Modell mit einbezieht.
Letztendlich aber entscheidet über die Wahl der Betriebsrichtung, und damit auch über die Belastungs-Verteilung, die Deutsche Flugsicherung DFS, und die hat neben dem Wind am Boden und in der Höhe noch eine Vielzahl nicht näher definierter "weiterer Parameter", die sie heranziehen kann, um die Betriebsrichtung zu wählen, die gerade am besten passt - für wen und warum, bleibt den Betroffenen verborgen. Die Wirkung spüren wir allerdings, wie die nebenstehende Tabelle zeigt.
Extrem hörbar und belastend war die
Ostwetterlage von Mitte Mai bis Mitte Juni.
Sie führte dazu, dass vom 12.05. - 16.06. fast ausschließlich über Raunheim gelandet wurde. Genauer wurde in dieser Zeit zu fast 95% der Betriebsstunden auf FRA Betriebsrichtung 07 geflogen. Verschärft wurde die Situation noch dadurch, dass vom 16.05. bis zum 31.05. (bzw.
wegen Pfusch
bis zum 01.06.) die Nordwestbahn wegen Sanierungsarbeiten gesperrt war und daher der gesamte Landeanflug über Center- und Südbahn, also über Raunheim, abgewickelt wurde. In dieser Zeit überschritt der Dauerschallpegel fast immer die 60 dB(A)-Grenze, zum Teil sehr deutlich.
Inwieweit diese Ostwetterlage tatsächlich auch mit einer Windkomponente von mehr als 5 Knoten aus 70° Ost (der Bahnrichtung) verknüpft war, bedarf noch einer genaueren statistischen Untersuchung. Durchgehend war das mit Sicherheit nicht der Fall; es lassen sich mehrere stundenlange Perioden mit geringeren und wechselnden Winden (und ohne Böen oder problematische Höhenwinde) nachweisen.
Der Trend bei Ostwetterlagen ist besorgniserregend.
Bereits im
Jahr 2018
war festgestellt worden, dass das "langjährige Mittel", wonach nur zu etwa einem Viertel bis zu einem Drittel der Zeit Betriebsrichtung 07 notwendig sein sollte, nicht mehr galt. In diesem Jahr wurde fast zur Hälfte der Zeit (45,7%) BR07 geflogen. Das Thema wurde zweimal in der
Fluglärmkommission
diskutiert, ein
Gutachten
wurde
präsentiert,
und die DFS sollte
erläutern,
wie sie die Betriebsrichtung festlegt. Da gab es zwar ein sehr eindeutiges Zitat aus dem
"Platzkontrollverfahren (Tower Frankfurt):"
"Bis zu einer Rückenwindkomponente von 5 KT ist im Parallelpistensystem die Betriebsrichtung 25 beizubehalten",
aber zur praktischen Umsetzung blieb es bei allgemeinen Floskeln.
Die Forderung aus dem
Beschluss
der Raunheimer Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018,
"die aktuelle Anwendungspraxis der bestehenden 5-Knoten-Rückenwindkomponente seitens der Deutschen Flugsicherung sorgfältig zu prüfen und hierüber öffentlich Bericht zu erstatten"
ist daher bis heute ebensowenig erfüllt, wie es eine Antwort auf die Frage gibt,
"wie die im Maßnahmenpaket 2010 angekündigte Anhebung der Rückenwindkomponente auf 7 Knoten ... realisiert werden kann" und "ersatzweise andere Möglichkeiten des aktiven Schallschutzes aufzuzeigen, die zu einer wirksamen Entlastung der bei BR 07 in der Region Hochbetroffenen führen können".
Nachdem 2019 der Anteil von BR07 im Jahresmittel wieder auf 31% zurückgegangen war und in den Jahren darauf die Flugbewegungszahlen Pandemie-bedingt einbrachen, verschwand das Thema in der Versenkung. Erledigt ist es aber offensichtlich nicht.
Dass die DFS nicht nur bei der Betriebsrichtungs-Wahl, sondern auch in vielen anderen Fragen ausgesprochen intransparent agiert, haben wir bereits seit Jahren dokumentiert, ausführlich z.B.
im Sommer 2019.
Das dort zitierte
Beispiel
war auch die letzte ausführliche Rückmeldung, die wir auf diverse Anfragen erhalten haben. Seither gibt es bestenfalls noch eine Standardfloskel oder (meist) garnichts.
Dass die DFS-Entscheidungen häufig erklärungsbedürftig wären, zeigt die Grafik am Anfang. Dort kann man ablesen, dass im ersten Halbjahr 2023 zwar etwas mehr als die Hälfte(!) der Zeit Wind aus östlichen Richtungen wehte, aber weniger als ein Drittel (28,5%) mit einer Stärke, die eine Rückenwindkomponente grösser als 5 Knoten erzeugen konnte. Trotzdem wurde fast der Hälfte der Zeit (44,3%) BR07 geflogen.
Dafür mag es in dem einen oder anderen Fall gute Gründe gegeben haben, aber insgesamt gewinnt man den Eindruck, als würde das eigentlich festgelegte Verfahren kaum noch angewendet.
Besonders krass zeigte sich das am Vormittag des Mittwoch, 28.06.. Von 6:00 - 11:00 Uhr wurde BR07 geflogen, obwohl in dieser Zeit Wind aus südöstlichen bis nordwestlichen Richtungen herrschte. Die maximal mögliche Rückenwindkomponente in dieser Zeit war 6 Knoten - allerdings in Richtung Osten, als bei BR25. Rückenwind bei BR07 kann es in dieser Zeit nicht gegeben haben. Die Erklärung der DFS dafür: (bisher??) Schweigen.
Offensichtlich hatte die DFS hier, wie häufig, andere Gründe für die Betriebsrichtungswahl als ein Verfahren, dass dem Lärmschutz dienen soll. Ob sich an diesem Verhalten etwas ändern würde, wenn, wie im
Ampel-Koalitionsvertrag
vorgesehen, aber nicht umgesetzt,
""effektiver Lärmschutz""
zur gesetzlichen Aufgabe der DFS gemacht würde, darf bezweifelt werden. Verbal sehen sie das ja schon lange so.
Fazit
Mit dem Wiederanwachsen des Flugverkehrs nach Corona erhalten die alten Baustellen des kommunalen Widerstands gegen die negativen Folgen des Flugverkehrs neue Aktualität. Für die Raunheimer Kommunalpolitik wäre es höchste Zeit, die alten Forderungen wieder aufzugreifen und mit neuem Druck in die einschlägigen Gremien und in die Öffentlichkeit zu tragen.
Insbesondere in die Fluglärmkommission, aber auch in die kommunalen Netzwerken
KAG
und
ZRM
sollte die spezifische Raunheimer Problematik sehr viel stärker eingebracht und nach Verbündeten gesucht werden (die es der Sache nach reichlich gibt). Gelingt es nicht, wirksamen Widerstand gegen die immer dreister werdenden Ansprüche der Luftverkehrswirtschaft zu entwickeln, droht Raunheim bis zur Unbewohnbarkeit immer stärker verlärmt und verdreckt zu werden.
Entgegen unseren Erwartungen hat die DFS doch noch auf unsere Anfrage zur Betriebsrichtungswahl am 28.06. geantwortet. Der volle Wortlaut:
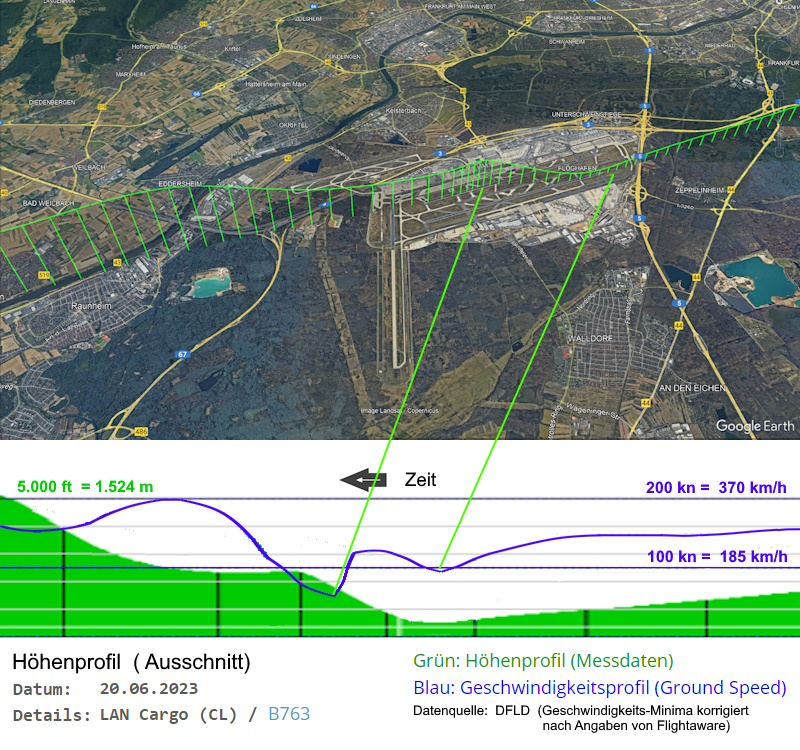
Sieht hier garnicht so dramatisch aus, wie es wohl gewesen ist. Allerdings sind die Daten unsicher, insbesondere das Höhenprofil war wohl nicht so glatt wie hier dargestellt. Eine tabellarische Darstellung der relevanten Daten liefert FlightAware.
26.06.2023
Am Dienstag, den 20.06., tobten schwere Gewitter über Rhein-Main und brachten auch den Flugbetrieb auf FRA kräftig durcheinander - besonders deshalb, weil eine landende Frachtmaschine beinahe abgestürzt wäre. Das zumindest lässt sich aus den Daten und Berichten schliessen, die der "Aviation Herald"
zusammengestellt hat.
Nach der Beschreibung (alle Zitate sind eigene Übersetzugen) setzte die aus Amsterdam kommende
B767-300
um 19:51 Uhr von Osten her zur Landung auf der Südbahn (25L) an, als die Besatzung "über der Landeschwelle" die Landung wegen einer
Scherwind-Warnung
abbrach und ein Durchstart-Manöver einleitete.
Die Maschine stieg zunächst "extrem steil" und verlor soviel Geschwindigkeit, dass ein
Strömungsabriss
drohte. Die Maschine kippte über die rechte Tragfläche ab, konnte über der Centerbahn (25C) abgefangen werden und stieg erneut so steil, dass wieder ein Strömungsabriss drohte.
Nach einem erneuten Höhenverlust konnten die Piloten die Maschine endgültig stabilisieren und in einem weiten Bogen über den Vordertaunus zum Flughafen zurückkehren, wo sie 35 Minuten später sicher landete.
In den Kommentaren des Aviation Herald berichten mehrere Augenzeugen, wie dramatisch das Ganze ausgesehen haben muss. Eine/r geht so weit zu sagen, dass
"die Piloten und die Menschen auf dem Vorfeld nur Augenblicke von einem schrecklichen Tod entfernt"
waren.
Ein "FRAinsider" berichtet, dass nach dem Vorfall nur noch eine Bahn in Betrieb war, weil
"die Hälfte der Tower-Besatzung ausgetauscht werden musste, um sich einer
Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen
zu unterziehen".
Was genau passiert ist, wie gefährlich das Ganze wirklich war und ob die Piloten tatsächlich
"einen bewundernswerten Job gemacht haben, um zu überleben",
wird man frühestens dann erfahren, wenn die
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU),
die den Vorfall untersucht, ihren Bericht vorlegt. Das kann erfahrungsgemäß eine ganze Weile dauern.
Insbesondere wenn sich, wie bei einem anderen
Beinahe-Absturz,
herausstellen sollte, dass es Fehler bei DFS oder Fraport gegeben hat (weil z.B. unter diesen Wetterbedingungen der gesamte Flugbetrieb hätte untersagt werden müssen), kann es auch Jahre dauern. Allerdings hat ein Sprecher der Behörde gegenüber dem Fachblatt "Aero" wohl
in Aussicht gestellt,
dass "erste Ergebnisse ... Ende September"
vorliegen könnten.
Was man jetzt schon beurteilen kann, ist die Arroganz, mit der alle Beteiligten die Öffentlichkeit behandeln. Wenn nicht Initiativen wie der "Aviation Herald" solche Vorfälle aufdecken würden, würden die im Umland des Flughafens von Sicherheitsfragen ja durchaus Betroffenen nichts erfahren. Fraport und DFS schweigen und hoffen, dass das Bild der schönen heilen Welt des Flugverkehrs keine Kratzer bekommt.
Noch dreister aber ist das hessische Verkehrs-Ministerium als zuständige Aufsichtsbehörde. Man darf wohl davon ausgehen, dass der Vorfall wenigstens dorthin gemeldet wurde. Dennoch gab das Ministerium am 21.06 eine
Pressemitteilung
zu
"63 verspätete Starts in der Nacht zum Mittwoch"
heraus, in der es heisst:
"Gründe für die starken Verzögerungen im Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt waren Kapazitätsengpässe verursacht durch das Zusammentreffen der NATO-Übung Air Defender 23, ... mit Gewittern, die aus Sicherheitsgründen zu einem zeitweisen Stopp jeder Bodenabfertigung geführt haben, verbunden mit größeren technischen Einschränkungen in den Systemen der Flugsicherung."
Auf die Begründungen für die Umgehung der Nachtflugbeschränkungen wird noch in einem anderen Beitrag einzugehen sein. Dass "Air Defender" dafür keine Rolle gespielt haben kann, geht schon daraus hervor, dass wegen der Gewitter an diesem Tag auch der militärische Flugbetrieb eingeschränkt war. Dass aber die massive Betriebsstörung durch den Vorfall mit der B763, die zur zeitweisen Einschränkung der Bahnennutzung geführt hat und damit mit Sicherheit wesentlichste Ursache für die Verzögerungen im Betriebsablauf war, mit keinem Wort erwähnt wird, ist eine Verhöhnung der Öffentlichkeit.
Auch die öffentliche Verwaltung und ihre politische Führung ist, wie hier erneut deutlich wird, der Meinung, dass es das dumme Volk nichts angeht, was im Flugbetrieb passiert, zumindest nicht über das hinaus, was sich in Hochglanz-Werbebroschüren unterbringen lässt. Es hat die Belastungen und die Sicherheitsrisiken, die ihm auferlegt werden, ohne Murren und unnötige Fragen hinzunehmen - jedenfalls solange, bis mal was richtig schiefgeht.

Zu großzügig, oder? Allerdings schummeln wir hier ein bißchen. Das Bild stammt von einem Unfall in Costa Rica im letzten Jahr, der anscheinend ganz ohne Mitwirkung von Klimaaktivist:innen zustande kam (für einen Bericht Bild anklicken), der Text aus der Berichterstattung über einen Prozess wegen einer Blockade einer Zufahrt zum Flughafen Leipzig/Halle 2021, wodurch DHL angeblich einen Schaden von zunächst 1,5 Millionen, später dann 84.000 € erlitten haben will.
21.06.2023
Je offensichtlicher die völlige Unzulänglichkeit der offiziellen "Klimaschutzbemühungen" von Staat und Konzernen wird, desto härter werden die Repressionen gegen diejenigen, die dieses Versagen öffentlichkeitswirksam anprangern. Am bekanntesten sind wohl die völlig überzogenen Maßnahmen gegen die Letzte Generation, über deren Aktionen sehr viele Medien berichten, allerdings meistens diffamierend.
Etwas weniger Medienecho fand ein Prozeß letzte Woche vor dem Landgericht Halle, den DHL wegen
einer Blockade-Aktion
am Flughafen Leipzig/Halle vor knapp zwei Jahren angestrengt hat. Wir berichteten damals:
"Dort haben Aktivist*innen in der Nacht zum 10.07.21 für einige Stunden eine Zufahrt blockiert, um gegen die geplante DHL-Erweiterung und die damit verbundene Steigerung der Zahl der Nachtflüge zu protestieren. Die Folgen für den Flughafen waren überschaubar: der Verkehr musste über eine der drei anderen Zufahrten umgeleitet werden und verzögerte sich geringfügig. Entsprechend verlief auch zunächst alles ganz ruhig: die Demonstranten waren von Anfang an (und blieben bis zum Ende) friedlich und absolut gewaltfrei, und nachdem ein anwesender Landtagsabgeordneter der Linken auch die formale Anmeldung der Aktion nachgeholt hatte, waren auch die Streifenpolizist*innen vor Ort zufrieden.
Erst als die Aktion schon fast beendet war, wurde es hektisch: Bereitschaftspolizei rückte an, kesselte die Demonstranten ein, brachte sie zur 'Identitätsfeststellung' in eine Sammelstelle, wo sie stundenlang unter unwürdigen Bedingungen festgehalten wurden. Ein Polizeisprecher erzählte von Millionenschäden für DHL und verzögerten Impflieferungen, Vertreter der Landesregierung liefen verbal Amok. Die Demonstranten sollen wegen 'Nötigung' angeklagt werden".
Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, und ob tatsächlich Aktivist:innen wegen 'Nötigung' angeklagt werden, ist noch offen. Erste, noch nicht rechtskräftige Strafbefehle gibt es bereits. DHL versucht gleichzeitig, mit Zivilprozessen gegen einzelne, willkürlich herausgegriffene Teilnehmer:innen der Aktion Exempel zu statuieren, indem deren wirtschaftliche Existenzen ruiniert werden und damit andere von ähnlichen Aktionen abgehalten werden sollen.
Der erste Verhandlungstag eines solchen Prozesses hat nun
stattgefunden,
und die perfide Strategie dahinter wird deutlich. Zunächst minimiert DHL das eigene Risiko: der "Streitwert", der die Prozesskosten bestimmt, ist mit 84.000 € relativ niedrig angesetzt, verhindert aber nicht, dass damit deutlich höhere Schadensersatz-Forderungen durchgesetzt werden könnten (über alle Prozesse hinweg steht immer noch die Drohung mit Forderungen bis zu einer halben Million Euro im Raum).
Dann bietet DHL zum Einstieg einen Vergleich an, der den Prozess noch billiger machen (Teilung der Prozesskosten) und den wichtigsten Zweck trotzdem erreichen würde (ein faktisches Schuldanerkenntnis und eine abschreckende Bestrafung). Die angeklagte Aktivistin hat den Vergleich
zunächst abgelehnt, ihre Verteidigung will aber angesichts der massiven Drohungen im Hintergrund und schlechter Erfahrungen mit der Justiz einen eigenen Vergleichsvorschlag vorlegen.
Zahlreiche Medien berichten über das DHL-Angebot unter der Überschrift
DHL verzichtet auf Schadensersatz,
was bestenfalls irreführend ist. DHL verzichtet faktisch auf garnichts. Nicht nur würde der Prozess preiswert seinen Zweck erfüllen, DHL müsste auch nicht beweisen, dass ihnen tatsächlich Schäden in der angeführten Höhe entstanden sind, was angesichts des Ablaufs der Aktion garnicht so einfach sein dürfte (falls die Verteidigung die notwendigen Ressourcen findet, um die DHL-Argumentation zu zerpflücken). Und schließlich: sollten die Forderungen anerkannt werden, würden die Angeklagten zwar wirtschaftlich ruiniert und in lebenslange Schulden gestürzt, sie könnten aber die geforderten Summen wahrscheinlich trotzdem nicht aufbringen. Mit dem tatsächlich eingehenden Geld könnte DHL wahrscheinlich nicht mal eine ihrer vielen
Fake-GoGreen-Kampagnen
finanzieren.
Die nächsten Zivilprozesse beginnen Mitte Juli, und sollten sie nicht per Vergleich beendet werden, ist im August mit dem ersten Urteil zu rechnen. Gründe für großen Optimismus gibt es nicht, denn Abschreckung ist politisch erwünscht. Schließlich hatte Bundesjustizminister Buschmann, Mitglied einer Partei, die vor langer Zeit mal liberal gewesen sein soll, von "sogenanntem zivilen Ungehorsam" gesprochen und gewarnt, "Wer Flughäfen blockiert, der muss wissen, dass er zum Teil erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht", und die Verursacher "werden ... diese Schäden unter Umständen ein Leben lang abzutragen haben". Die Justiz wird diesen Hinweis sicher nicht unberücksichtigt lassen.
Der Herr Minister sollte aber eigentlich wissen, dass das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung erst vor zwei Jahren
nachdrücklich vorgeschrieben
hat, insbesondere die Jugend vor einer ganz anderen lebenslangen Belastung zu schützen:
"Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz".
Konkret:
"Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft. ... Konkret erfordert dies, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgetaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden ...".
Genau darauf, dass das nicht in ausreichendem Maße geschieht, wollten die Aktivist:innen mit der Blockade hinweisen und damit ihre Grundrechte verteidigen.
Im Gegensatz dazu gibt es kein Grundrecht auf ungestörtes Profitmachen. Als das
Grundgesetz
verabschiedet wurde, hatte selbst die CDU noch in ihrem
Programm
stehen:
"Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein."
Daran hat sich nichts geändert.
Aber mit diesen Sätzen würde die CDU heute wohl auch im
Verfassungsschutz-Bericht
erscheinen, der "dogmatischen Linksextremisten"
vorwirft,
"die Klimaproteste als Tribüne zur Verbreitung ihrer ideologischen Positionen zu nutzen. Sie sehen in einem ausschließlich auf Profitmaximierung ausgerichteten „Kapitalismus“ die Ursache für den Klimawandel. Vorrangiges Ziel ist es, ihre Forderung nach einer „Systemüberwindung“ in die demokratischen Klimaproteste einzubringen".
Mit der Behauptung,
"Zu den auch von Linksextremisten im Rahmen der Klimaproteste genutzten Aktionsformen zählen unter anderem Blockaden und Besetzungen ..., die als „ziviler Ungehorsam“ bezeichnet werden",
wird auch da versucht, Aktionen wie die in Leipzig in die Nähe des Terrorismus zu rücken und damit abzuschrecken.
Die Leipziger BI "Gegen die neue Flugroute" / "Gegen Fluglärm in Leipzig", die an der Blockade nicht beteiligt war, aber mit den angeklagten Aktivist:innen solidarisch ist, fragt in einer
Pressemitteilung
zum Prozessbeginn,
"Wer verfolgt die Nötigung gegen die Fluglärmbetroffenen?"
und
"Wer leistet eigentlich den durch Nachtfluglärm mit Ihrer Gesundheit zahlenden Betroffenen Schadenersatz?".
Die Fragen sind rhetorisch, ebenso wie diese:
"Wer zahlt eigentlich für die Klimaschäden, die durch den DHL-Betrieb und den geplanten Ausbau entstehen?".
DHL möchte, ebenso wie die
gesamte Luftfahrt-Branche
ungestört expandieren und Profite maximieren dürfen. Wer da stört, wird aus dem Weg geräumt, die gesellschaftlichen Kosten tragen andere.
Da ist es wohl konsequent, wenn die bisherige "Deutsche Post DHL Group" ihren Namen
erneut ändert
und den Namensbestandteil eliminiert, der an ein früheres, im öffentlichen Interesse tätiges Unternehmen erinnert. Die entsprechenden Aufgaben erfüllt sie ohnehin nur noch
unzureichend.
Wofür die übrig bleibenden drei Buchstaben der künftigen "DHL Group" stehen, dürfte hierzulande allerdings kaum jemand wissen bzw sich merken wollen. Die Aktivist:innen in Leipzig und anderswo können den Namen künftig vielleicht als "Demokratie-feindlich, Hinterlistig, Lügenhaft" ausbuchstabieren, oder für den globalen Markt als "Dirty, High-emitting Logistics". Aber möglicherweise kostet das ja auch wieder Schadenersatz, wegen Rufschädigung.

Ein normaler Anflug über Raunheim (zum Vergrössern anklicken) ...

... und die nicht normalen Folgen.
14.06.2023
Kaum zu glauben, aber wahr: wie die
Main-Spitze berichtet,
ist das Autohaus Hempel in der Karlstrasse in Raunheim am Freitag letzter Woche nun schon zum fünften Mal von einer Wirbelschleppe getroffen worden. Wie auch beim
vorhergehenden Schadensfall
vor etwas über einem Jahr wurden verschraubte Platten aus dem Dach gerissen (kleines Foto).
Diesmal ist allerdings auch auf dem benachbarten Lagergelände ein deutlich sichtbarer Schaden entstanden. Wie das grössere Foto zeigt, wurde eine stabile Zeltkonstruktion hochgewirbelt und landete auf dem Dach des daneben liegenden Flachbaus.
Da der Besitzer des Materiallagers anwesend war und die genaue Zeit festgehalten hat, ist der Verursacher leicht auszumachen. Es war ein Ferienflieger der TUIfly, der vom griechischen Flughafen Heraklion auf Kreta nach Frankfurt flog.
Die Mittelstrecken-Maschine vom Typ Boeing 737-800 ist nicht für die Erzeugung besonders starker Wirbelschleppen bekannt. Sie ist in die vierte der sechs
neuen Wirbelschleppen-Kategorien,
"Upper medium", eingeordnet. (Die ersten drei Kategorien sind verschiedene Varianten von "Heavies".)
Wie die Grafik oben zeigt, war sie auch auf der korrekten Anfluglinie, in der üblichen Höhe und nicht auffällig laut - also ein ganz normaler Überflug bei Ostwind. Einzige Auffälligkeit ist eine geringfügige Zunahme der Geschwindigkeit beim Überflug über Raunheim (s. große Grafik), die aber schlimmstenfalls etwas mehr Lärm erzeugt haben kann.
Offensichtlich waren die Wirbelschleppen aber stark genug, um erhebliche Kräfte am Boden auszuüben, da nicht nur ein angeblich marodes Dach beschädigt, sondern auch ein stabiles Zelt herumgewirbelt wurden. Sturmböen, die sowas hätten bewirken können, gab es zu der Zeit nicht.
Fraport-Beauftragte waren vor Ort und "prüfen", aber das ist wie immer nur Show, weil es da nichts zu prüfen gibt.
Wir haben es in den vergangenen Jahren
immer wieder geschrieben
und wiederholen es hier nochmal:
der
Anspruch auf Schadensersatz
in solchen Fällen
"beruht auf einer Nebenbestimmung des Planfeststellungsbeschlusses von 2007. Dort heisst es: "Die Vorhabensträgerin wird verpflichtet, nachweislich durch eine Wirbelschleppe eines auf dem Flughafen Frankfurt Main landenden oder startenden Luftfahrzeugs verursachte Schäden auf ihre Kosten zu beseitigen oder die angemessenen Kosten der Schadensbeseitigung zu erstatten."
Hier ist nicht die Rede von irgendwelchen Qualitätsstandards, es geht nicht einmal nur um Dächer -
Fraport muss alle Wirbelschleppen-bedingten Schäden ersetzen.
Im Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshof zu den Klageverfahren gegen den PFB von 2009 heisst es weiterhin: "Diese Nebenbestimmung hat der Beklagte durch Erklärung in der mündlichen Verhandlung dahingehend abgeändert, dass nunmehr die Beigeladene nachzuweisen hat, dass bei Schadenseintritt die Voraussetzungen dieser Verpflichtung nicht erfüllt sind", oder im Klartext: der Minister
verpflichtet Fraport, zu beweisen, dass aufgetretene Schäden nicht durch Wirbelschleppen verursacht worden sind,
wenn sie nicht zahlen wollen."
Ein solcher Beweis könnte nur darin bestehen, zu zeigen, dass die Schäden nicht durch Luftbewegungen entstanden sind - oder dass in den Minuten vor Auftreten der Schäden kein Flugzeug vorbeigeflogen ist. Beides ist im vorliegenden Fall natürlich nicht möglich.
Dieser Fall macht damit erneut (fast)
alle Aspekte
des
Skandals im Umgang mit den Wirbelschleppen-Risiken
deutlich. Wirbelschleppen können Schäden
nicht nur an Dächern
anrichten. Hier hat es ein Zelt getroffen, in der Vergangenheit wurden Schäden an Dachfenstern, Sonnenkollektoren, Rollläden, Blumenkübeln usw. berichtet, auch Boote auf dem Main wurden schon getroffen. Gegen diese Gefahren gibt es keine Sicherung, sie können nur minimiert werden, wenn Wirbelschleppen den Boden nicht mehr in dieser Stärke erreichen können.
Die
Regulierung
aufgetretener Schäden wird vom Verursacher Fraport
völlig willkürlich gehandhabt.
Ihre
Schadensliste
weist für die aktuelle Anflug-Periode (April/Mai) bisher drei Schadensmeldungen auf (Stand 14.06.), davon sind zwei angeblich
"nicht auf Wirbelschleppen zurückzuführen".
Warum das so sein soll, kann allerdings niemand überprüfen.
Die
Dachsicherung
bleibt im Umfang völlig unzureichend und ist immer wieder
von Skandalen gezeichnet.
Fraport unterläuft teilweise die Verpflichtungen aus den Planergänzungen, schreckt Hausbesitzer*innen ab und liefert unzureichende Qualität.
Bis heute ist ungeklärt, unter welchen Bedingungen Wirbelschleppen am Boden Schäden anrichten können. Nachweislich können Schäden bei den derzeitigen Überflughöhen
von fast allen Flugzeugtypen
verursacht werden, nicht nur von besonders schweren Maschinen. Unklar ist auch, unter welchen Wetterbedingungen das möglich ist. Aussichten, dass diese Fragen in absehbarer Zeit geklärt werden, gibt es nicht.
Forschungen zu Wirbelschleppen
richten sich fast ausschliesslich darauf, die zulässigen Abstände zwischen Flugzeugen zu minimieren, um die Kapazitäten der Flughäfen zu erhöhen.
Trotzdem tut die Politik so, als sei alles geregelt, und überlässt die Betroffenen ihrem Schicksal. Wenn die sich wehren wollen, bleibt ihnen nur der Gang vor die Gerichte. Wie groß die Chancen sind, dort gegen Fraport Recht zu bekommen, haben die juristischen Auseinandersetzungen um den Planfeststellungsbeschluss zum Flughafenausbau und
in anderen Fragen rund um den Luftverkehr hinreichend gezeigt. Ohne ausreichende Unterstützung und finanziellen Rückhalt kann man niemandem raten, diesen Weg zu gehen. Recht haben und Recht bekommen sind eben hierzulande sehr unterschiedliche Dinge, wenn es um starke wirtschaftliche Interessen geht.
Denn eine grundlegende Lösung des Problems, eine wirkliche Minimierung des Risikos von Schäden durch Wirbelschleppen, wäre nur möglich, wenn Raunheim und Flörsheim deutlich höher und weniger überflogen würden - beides Dinge, die dem Wachstumswahn der Fraport diametral entgegen stehen. Daher versuchen sie konsequent, das Problem zu verleugnen und zu vertuschen - und haben dabei die volle Unterstützung der Landesregierung und des zuständigen Ministeriums. Und es ist zu befürchten, dass sich daran auch nichts ändern wird, egal wie die Wahl im Herbst ausgeht.
30.05.2023
"Mitte Juni 2023 wird es laut über Deutschland",
warnt die
Informationsstelle Militarisierung.
"Die Bundeswehr, die US Luftstreitkräfte und 23 weitere Verbündete planen die größte Luftwaffenverlegeübung seit Bestehen der NATO."
Das Grossmanöver
Air Defender 23
steht unter Leitung der deutschen Luftwaffe, ist aber Teil der bereits seit Ende April laufenden, US-geführten Gross-Übung
DEFENDER 23,
in deren Rahmen praktisch alle Waffengattungen der NATO Manöver in verschiedenen europäischen Ländern durchführen.
DEFENDER wird vom gerade erst erweiterten Hauptquartier der US Army für Europa und Afrika in Wiesbaden (Erbenheim und Mainz-Kastel) aus kommandiert, aber Air Defender spielt sich hauptsächlich ausserhalb des Rhein-Main-Gebiets im Norden, Südwesten und Osten Deutschlands und über der Nordsee ab.
Über die Auswirkungen der Flugmanöver auf die Zivilbevölkerung wird im Moment noch heftig spekuliert. Bereits im März hat die Bundesregierung in ihrer
Antwort
auf eine "Kleine Anfrage" der Fraktion der Linken im Bundestag zu den Lärmemissionen des Manövers ausgeführt:
"Die Bundeswehr ist bestrebt, die Belastungen für die Bevölkerung ... so gering wie möglich zu halten. Gänzlich werden sie sich aber nicht vermeiden lassen. Die „Zeitenwende“ erfordert wieder verstärkte militärische Übungstätigkeiten, um unsere Freiheit und die unserer Bündnispartner wirksam wahren zu können."
Gemessen wird der Lärm allerdings nicht,
"da dies nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm an Militärflugplätzen nicht vorgesehen ist".
"Erhöhte Entschädigungszahlungen"
nach Fluglärmschutzgesetz werden deshalb auch nicht erwartet. Es gibt Aussagen über die Treibhausgas-Emissionen, allerdings nur zu den jeweiligen Übungsflug-Einsätzen, nicht als Gesamtbilanz des Manövers. Ob die "kompensiert" werden sollen, wird nicht erwähnt.
Obwohl garnicht danach gefragt, betont die Bundesregierung, dass auch
"die Belastungen für ... den zivilen Luftverkehr ... so gering wie möglich"
gehalten werden sollen. Entsprechend hat Lufthansa-Chef Spohr schon frühzeitig
"mehr Flexibilität bei den Nachtflugverboten"
gefordert.
Er
"möchte, dass Flugzeuge während Air Defender zu späten und frühen Uhrzeiten landen und starten dürfen, zu denen dies sonst nicht erlaubt ist. Dann könnten Flüge stattfinden, die zu anderen Uhrzeiten durch das Manöver ausfallen".
Die Politik wird dieser Forderung selbstverständlich folgen. So hat die hessische Landesregierung bereits erklärt,
Ausnahmen beim Nachtflugverbot
auf FRA zulassen zu wollen, und Gleiches gilt für den
Flughafen Stuttgart.
Alle anderen werden wohl folgen.
Wie groß die Probleme im zivilen Luftverkehr wirklich werden, ist umstritten. Öffentlich wurde zunächst abgewiegelt, es würde wohl zu
Verspätungen,
aber nicht zu Anullierungen von Flügen kommen. In der Fluglärmkommission Frankfurt
präsentierte die DFS,
"mit Auswirkungen auf die Pünktlichkeit und Flugwegverlängerungen für die zivile Luftfahrt ist zu rechnen".
Die Gewerkschaft der Fluglotsen hält diese Darstellung für
"wirklichkeitsfremd"
und
erklärt,
dass
"... Simulationen der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) ... ergeben [haben], dass für die Dauer der Nato-Großübung täglich mit Gesamtverspätungen ... von bis zu 50.000(!!!) Minuten pro Tag gerechnet werden muss. Darüber hinaus wird erwartet, dass bis zu 100 zivile Flüge pro Tag ihr Umlaufziel zur Nachtschliessung der verschiedensten Flughäfen in Deutschland nicht erreichen".
Die DFS-Geschäftsführung und der "Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft" wiederum erklären diese Simulationen für veraltet und erwarten, dass es
"wegen Umleitungen von Flügen um die gesperrten Bereiche zu Verspätungen kommen [werde]. Die meisten Flüge dürften aber pünktlich sein".
Dafür sollen
deutlich mehr Fluglotsen
eingesetzt werden.
Die US Army benennt als Ziel von DEFENDER 23 u.a.:
"increase lethality of the NATO Alliance through long-distance fires". Übersetzt soll dieser Militär-Slang wohl bedeuten, dass die "Vernichtungs-Fähigkeit" der NATO-Allianz durch "weitreichende Feuerkraft" gestärkt werden soll. Was genau dabei vernichtet werden soll, darüber darf man spekulieren.
Dass Air Defender 23 lethal wirken kann, hat sich möglicherweise bereits gezeigt. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Hohn, der
"nicht dauerhaft von der Bundeswehr genutzt"
und
"nur für Notfälle oder Großereignisse aktiviert"
wird, ist am 15. Mai
ein Learjet abgestürzt,
die beiden Piloten starben. Das Flugzeug
"aus der Flotte eines Tochterunternehmens von Airbus ...",
der
" Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD)",
"... diente der Bundeswehr für die Simulation von Feindflugzeugen"
und sollte aktuell
"zum Training von Fluglotsen der Bundeswehr genutzt werden".
An
anderer Stelle
heisst es:
"Flugzieldarstellungen werden benötigt, damit Bundeswehreinheiten die see- oder landgestützte Flugabwehr mit Lenkflugkörpern und Rohrwaffen üben können".
Die
Untersuchungen
dauern an.
Und obwohl die US Air Base in Frankfurt schon lange nicht mehr existiert, ist FRA bei militärischen Planungen nicht völlig aussen vor, gerade was besondere Risiken angeht. Wegen der besonders langen Bahnen ist der Flughafen Frankfurt weiter in die NATO-Notfallplanungen integriert, und schon in der Vergangenheit wurden Militärflugzeuge
hierher umdirigiert,
wenn technische Probleme eine Landung riskant zu machen drohten. Auch Todesopfer gab es hier schon: erst vor kurzem wurde der
40. Jahrestag
eines Starfighter-Absturzes über dem Stadtwald begangen, bei dem die Frankfurter Pfarrersfamilie Jürges getötet wurde.
Es gibt durchaus noch mehr gute Gründe, sich durch solche Manöver nicht sicherer zu fühlen. Deswegen
ruft die Friedensbewegung
unter dem Titel
"Für Diplomatie statt militärische Eskalation mit „Defender“-Kriegsmanövern!"
auf zur Demonstration und Kundgebung am 17. Juni vor dem Standort des
56th Artillery Command
der US Army in Mainz-Kastel. Diese Einheit war bis 1991 für die in Deutschland stationierten Mittelstreckenraketen Pershing 2 zuständig, wurde 2021 reaktiviert und soll künftig die in Grafenwöhr zu stationierenden Hyperschall-Raketen "Dark Eagle" kommandieren, die in rund 8 Minuten Moskau erreichen können.
Vielleicht wird ein US-amerikanisches Reisebüro dann wieder, wie zu Zeiten der Pershing 2, versuchen, auch mehr zivilen Flugverkehr hierher zu locken mit dem Slogan:
Besuchen Sie Europa, solange es noch steht.

27.05.2023
Mit einer
starken Aktion
startete diese Woche eine neue europäische Kampagne zum "Verbot von Privatjets und Luxus-Emissionen". Anläßlich der diesjährigen europäischen Privatjet-Verkaufsmesse
EBACE
vom 23.-25-05. in Genf haben 103 Aktivist*innen einige ausgestellte
Luxusjets blockiert.
Der Flughafen sah den Flugverkehr gefährdet und stellte den Betrieb vorübergehend ein.
Zeitgleich startete auf der Kampagnen-Plattform
WeMove Europe
eine
Petition
an "europäische Entscheidungsträger":
"Ban private jets and luxury emissions" ("Verbietet Privatjets und Luxus-Emissionen").
Die
Medien-Resonanz
im deutschen Sprachraum war für eine derartige Aktion relativ gut, denn es wurde nicht nur über die Tatsache einer Blockade berichtet, sondern auch über die Gründe dafür. Eine
Greenpeace-PM
wurde von etlichen Zeitungen zitiert und Medien vom
Schweizer Rundfunk und Fernsehen
bis zum
untergrundblättle
berichteten direkt.
Die Staatsmacht reagierte wie aktuell bei
Klimaprotesten immer häufiger
mit
Verhaftungen
und mehr als 24stündigem Arrest, und die Veranstalter drohen mit Klagen und finanziellen Forderungen, um die Aktivist*innen mundtot zu machen.
Die Aktion war nicht nur eine gelungene Fortsetzung der Aktivitäten vom Anfang dieses Jahres, sondern auch geeignet, neue Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des sog. Geschäftsflugverkehrs zu lenken, der einen ungebrochenen Wachstumstrend und damit ständig steigende Klimabelastungen aufweist. Entsprechend sieht der Abschlussbericht der Messe "aufregende Markt-Chancen", da auch die weiteren Prognosen der Verkaufszahlen für die Hersteller sehr erfreulich sind.
Die
Erfolgsmeldungen
dieser Messe tragen aber auch erfolgreich dazu bei, die Absurdität dieser ganzen Veranstaltung deutlich zu machen. Wenn mit den Worten
"Seit fünf Jahren steht sie im Angebot. Jetzt konnte Boeing erstmals eine BBJ 777X verkaufen. Der VIP-Businessjet bietet mehr Platz als drei Wohnungen und ist für den Hersteller ein gutes Geschäft"
gemeldet wird, dass einer der grössten existierenden Langstreckenjets als 'Boeing Business-Jet' mit
"... einem einzigartigen privaten Schlafzimmer ... [einem] geräumigen Büro- und Empfangsbereich ... [und] Privatbereich"
verkauft werden konnte, der künftig mit rund 20 Personen an Bord
"fast alle Städte auf der Welt nonstop miteinander verbinden kann",
dann macht das deutlich, welche Perversion der Luxuskonsum einer völlig abgehobenen Elite inzwischen erreicht.
Dass zu dieser Elite nicht in erster Linie exotische Ölscheichs, exaltierte Schlager- und Film-Sternchen und neureiche Profifussballer gehören, kann man in diversen Studien oder
speziellen Portalen
nachlesen. Das Ranking der gelisteten Personen unterscheidet sich je nach Zuordnungskriterien, aber man findet immer wieder die gleichen wirtschaftlich Mächtigen und Teile der politischen Führungen.
Der Entwurf für die Ausstattung des Boeing-Luxusjet wurde im Übrigen von Lufthansa Technik vorgelegt, die auch die Lufthansa-Kabinen für das 'neue Marktsegment' Premium Leisure entwickelt hat: "In der neuen Lufthansa-Bordwelt Allegris verknüpfen First-Class-Suiten für Paare und Business-Class-Lösungen für Familien "Premium" deutlich enger mit "Leisure" als bisher", d.h. sie setzen auf Flugreisende, die auch für ihre Freizeit-Trips auf Luxus Wert legen. Dass mit solchen Bestuhlungen die Klimaschäden pro Person und Flug deutlich ansteigen, weil viel mehr Platz verbraucht wird und mit den gleichen Emissionen weniger Personen befördert werden können, interessiert sie nicht.
Indem die Kampagne auf Privatjets und Luxus-Emissionen fokussiert, macht sie deutlich, dass es auch im Luftverkehr deutliche soziale Unterschiede gibt. Es ist etwas anderes, ob jemand einmal im Jahr Verwandte auf anderen Kontinenten besucht oder für einige Wochen in Urlaub fliegt (was allerdings aus der Perspektive der Mehrheit der Weltbevölkerung auch schon Luxus ist), oder ob jemand als Vielflieger permanent um die Welt jettet und dabei einen tausendfach höheren Klimaschaden anrichtet (im Privatjet nochmal deutlich mehr als in der First- oder Business-Class, die lt. ICCT auch schon "2,6 bis 4,3 mal mehr CO2" emittieren als die Economy-Class).
Auch werden dadurch direkte Aktionen zivilen Widerstands wie in Genf (hier waren Stay Grounded, Greenpeace, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion, ANV-COP21 und Abolir Jatos mit Aktivist*innen aus 17 Ländern beteiligt) anschlussfähig an die vielfältigeren Aktionsformen und Diskussionen, wie sie in den Bewegungen für
globale Klimagerechtigkeit,
z.B. bei
Fridays for Future,
Oxfam
oder
in den Kirchen
geführt werden.
Und es ist kein Aufweichen bisheriger Forderungen. Indem an extremen Beispielen verdeutlicht wird, dass Flugverkehr aus ganz unterschiedlichen Gründen, von existenzieller Notwendigkeit bis zu absurdem Luxus, durchgeführt wird, wird die Debatte um notwendige Reduktionen der Zahl der Flugbewegungen auf eine rationalere Basis gestellt und es werden neue Zugangsmöglichkeiten zu Teilen der Bevölkerung eröffnet.
Während in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden and Portugal entsprechende Diskussionen bereits breitere politische Kreise erfasst haben, ist es hierzulande bisher fast ausschliesslich
die Linke,
die entsprechende Forderungen unterstützt. Das ist allerdings angesichts des klimapolitischen Versagens der anderen großen Parteien keine Überraschung und eigentlich nur noch mehr Anlass, den öffentlichen Druck zu erhöhen.
Wenn in Medien die Frage, ob
eine Welt ohne Privatjets möglich
sein könnte, nicht mehr kategorisch verneint, sondern mit Hinweis auf notwendige oder nützliche Ausnahmen beantwortet wird, ist das ein Zeichen, dass das Thema gesellschaftlich relevant zu werden beginnt. Und auch wenn ein vollständiges Verbot von Privatjets in Europa in den nächsten Jahren nicht zu erreichen sein wird: die Kampagne stellt wirksame kritische Fragen und entwickelt Druck in die richtige Richtung. Sie ist daher unbedingt unterstützenswert.

Studio-Atmosphäre: Vorstand und Aufsichtsrat präsentieren sich Aktionär*innen
und der Öffentlichkeit, die an den Bildschirm verbannt sind.
25.05.2023
Wie in jedem Jahr hat die Fraport auch kürzlich wieder ihre Jahreshauptversammlung abgehalten und dazu auch wieder eine Reihe von Dokumenten veröffentlicht. Diese Pflichtübung wird wesentlich erleichtert dadurch, dass anlässlich der Corona-Pandemie Regeln eingeführt wurden, die es Konzernen erlauben, ihre JHVs virtuell abzuhalten - eine Vereinfachung, die Fraport sich nun auch für die nächsten Jahre hat in die Satzung schreiben lassen. Und obwohl zwei Aktionärsvertreter pflichtgemäß ein bißchen herummaulten, wurde dieser Vorschlag, wie fast alle anderen auch, mit über 90% Zustimmung angenommen.
Primär dienen solche Veranstaltungen natürlich dazu, die Wirtschafts- und Finanzdaten des Konzerns in leuchtenden Farben darzustellen und den Anlegern zu versichern, dass ihr Geld da gut aufgehoben ist. Aber auch für die allgemeine Öffentlichkeit gibt es eine Reihe von Botschaften wirtschaftlicher und politischer Natur. Daher wurde auch der erste Teil der Veranstaltung
life für alle
übertragen, während der zweite Teil nur über ein spezielles Portal für Aktionär*innen zugänglich war.
Das öffentliche Video wird wohl kein Quoten-Hit, denn dem hessischen Finanzminister Boddenberg als Aufsichtsratsvorsitzendem beim Abwickeln der Formalia zuzusehen oder den Diavortrag von Vorstandschef Schulte zu bewundern, ist sicherlich nur etwas für Hardcore-Fans. Politisch interessant darin ist vielleicht die kurze Bewerbungsrede des Frankfurter OB Mike Josef (Minute 28:05-28:25), der als Nachfolger von Peter Feldmann mit 85,8% der Stimmen in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Ganz Zielgruppen-spezifisch betonte er die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Flughafen für Frankfurt - und verlor kein Wort über Fluglärm, Schadstoff-Belastung oder Klimaschäden.
Die wichtigsten Botschaften wurden aber schon vorab an die Öffentlichkeit gebracht. Der
Schulte-Vortrag
stand schon Tage vorher im Netz, und die für Fraport wichtigsten Inhalte wurden
in einem dpa-Text
in mehreren Medien wiedergegeben.
Dabei stehen im Vordergrund die
weltweiten Aktivitäten
der Fraport, insbesondere die von Skandalen umgebenen Ausbaumaßnahmen in
Griechenland
und
Brasilien,
die inzwischen mehr Profit abwerfen als das Kerngeschäft in Frankfurt. Wie Schulte in seinem Vortrag stolz zeigt, trägt das "internationale Segment", das vor zehn Jahren 20% des "operativen Konzernergebnisses (EBITDA)" lieferte, inzwischen fast 60% bei.
Bezüglich der Entwicklung am Standort Frankfurt heisst es:
"Am heimischen Drehkreuz Frankfurt stehen der Neubau des dritten Terminals sowie die Modernisierung der bestehenden Abfertigungsgebäude im Zentrum. Erheblichen Aufwand muss das Unternehmen treiben, um nach der Corona-Flaute ausreichend Personal zu rekrutieren."
Das ist einerseits wieder das übliche Schöngerede des
selbstverschuldeten Personalmangels,
der offenbar auch von den Aktionären nicht hinterfragt wurde, andererseits ein kleiner Hinweis darauf, dass in Schultes Ausführungen zu FRA im Gegensatz zur
vorhergehenden Medienkampagne
nicht Terminal 3, sondern die Modernisierungen im als "Lastpferd" bezeichneten Terminal 1 mehr Raum eingenommen haben.
Das liegt eigentlich auf der Hand, denn hier geht es ums Kerngeschäft: im Terminal 1 werden rund vier Fünftel des Gesamtbetriebs abgewickelt, und hier haben die Hauptkunden, die Lufthansa-Group und ihre 'Star Alliance'-Partner, ihren Sitz. Deren Prozesse zu optimieren und auf dem aktuellen technischen Stand zu halten, muss für Fraport höchste Priorität haben, und darum geht es bei den permanenten Umbauten und Erweiterungen, die neuerdings unter dem Titel "Transforming Terminal 1" laufen. Dabei werden neue Einrichtungen für Check-in und Sicherheitskontrollen geschaffen, der Sicherheitsbereich erweitert (und dabei der öffentlich zugängliche Bereich eingeschränkt) und dabei als "Abfalleffekt" (O-Ton Schulte) noch ein neuer "Marktplatz" geschaffen, auf dem besserverdienenden Passagiere ungestört shoppen können und damit wie in Terminal 3 zusätzliche Profite einspielen sollen.
Die eigentliche politische Botschaft dieser JHV steht aber in keinem Mainstream-Medium abgedruckt. Sie besteht eben darin, dass der Fraport-Kurs auf ungebremstes, dauerhaftes Wachstum nirgendwo in Frage gestellt wird. Kritische Aktionär*innen kommen in Fraports virtueller Welt nicht mehr zu Wort,
kritische Fragen
werden nicht gestellt, Abstimmungen über Personalien und Formalia werden zur Formsache. Wenn Fraport nach der JHV erfreut
feststellen kann:
"Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu",
und das jeweils zu über 90%, dann stellen sie damit im Kern fest, dass sie für ihren Kurs die Unterstützung einer ganz grossen politischen Koalition (auch "Schwampel" genannt) haben, die den Vorstandskurs mitträgt.
Wer einen anderen Kurs für nötig hält, muss sich Bündnispartner offensichtlich woanders suchen.

17.05.2023
Scheinbar ohne besonderen Anlass hat Fraport am Dienstag letzter Woche eine "kleine Delegation" von Medien-Leuten zu einem Besuch der Baustelle von Terminal 3 eingeladen. Die Experten wussten, welche Meldung von ihnen erwartet wurde:
"Airlines wollen in neues Terminal 3"
war sowohl bei
airliners.de
als auch bei
aero.de
am nächsten Morgen zu lesen.
Für die Wirtschafts-Seiten gabs eine dpa-Meldung mit der trockenen Überschrift
Terminal 3 im Plan,
aber Medien wie die Frankfurter Rundschau schoben abends nochmal eine Lobeshymne hinterher:
Fraports südlicher Superlativ.
Fraport-Chef Schulte lässt sich von dpa freudig wiedergeben:
"Für die erwartete Entwicklung des Flugverkehrs gebe es in Deutschland wenige andere Standorte mit konkreten Ausbauplänen oder ungenutzten Reserven ... . Er bezieht sich auf Einschätzungen von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), dass der Flugverkehr bis 2051 um 67 Prozent wachsen werde. „Mit dem neuen Terminal können wir einen Quantensprung nach vorne gehen.“"
Mal abgesehen davon, dass Quantensprünge in der Regel räumlich nicht allzu weit führen: Die
"Super-Prozesse", die
"ein Qualitätsmerkmal"
sein sollen und dazu führen, dass Fraport
"mit dem Terminal 3 strategisch richtig unterwegs"
ist, weil
"die Sicherheitschecks von Anfang an beinahe zum Vergnügen"
werden und
"Wartezeit ... hier kein Thema mehr"
sein soll, sind eigentlich nichts weiter als der ganz normale Service, den man von einem funktionierenden Flughafen erwarten können sollte. Das eigentliche
"Highlight ... in der großen hinteren Halle"
sind
"100 Retailflächen und zusätzliche Gastrobetriebe auf 12200 Quadratmetern".
Die sollen auch künftig den
zusätzlichen Profit
generieren, mit dem der Flugbetrieb quersubventioniert werden kann.
Auch von anderen Flughäfen gibt es Meldungen über Zukunftspläne, die aber eher in eine andere Richtung deuten. Beispiele:
Der
Flughafen Düsseldorf
will die bestehenden Kapazitäts-Beschränkungen nicht länger infrage stellen und stattdessen
smart wachsen.
Dazu will man
"einen Antrag auf Änderung des laufenden Planfeststellungsverfahrens (PFV) zur Kapazitätserweiterung"
stellen mit dem Ziel,
"innerhalb der genehmigten Kapazitätsobergrenze [zu] wachsen ... durch die Verschiebung von Bewegungskontingenten zugunsten des Linien- und Charterverkehrs ... [ohne] Betriebsgenehmigung für zusätzliche Starts und Landungen".
Konkret bedeutet das, dass ein Teil des bisherigen Betriebs (die
Allgemeine Luftfahrt)
auf den benachbarten
Regionalflughafen Mönchengladbach
ausgelagert werden soll, um dadurch Platz zu schaffen.
Der Flughafen Wien
teilt mit,
dass er
"beantragt, die ursprüngliche Realisierungsfrist für die erste Bauphase, die mit 31.12.2023 bestimmt war, neu auf 30.6.2033 festzulegen und die weiteren Fristen dementsprechend anzupassen",
sprich, die seit 2012
heiss umkämpfte
dritte Bahn nun erst in etwa 15 Jahren in Betrieb nehmen zu wollen. An fehlendem Geld liegt es wohl nicht, da die Gewinne
wieder wachsen
und die Anleger
optimistisch sind.
Um die Hintergründe dieser Entwicklungen besser zu verstehen, lohnt ein Blick in das neueste Lobbypapier der Dachorganisation der europäischen Flughäfen, ACI Europe. Es ist eine
Synopse
genannte Zusammenfassung und Popularisierung einer ausführlicheren
Studie
zur Wettbewerbssituation der Flughäfen in Europa. Die
Pressemitteilung
zur Veröffentlichung fasst den Kern der Botschaft zusammen: Es gibt einen scharfen Wettbewerb in
"einem stark fragmentierten Netzwerk von annähernd 700 Flughäfen - bei nur 7 grossen Airline-Gruppen als Protagonisten, die zwischen den Flughäfen für ihre Routen, Flugzeug-Basen und ihr Wachstum wählen"
(eigene Übersetzung).
Damit setzt ACI Europe eine Kampagne fort, die sie schon
vor zwei Jahren
begonnen haben und die darauf zielt, das "regulatorische Umfeld" für Flughäfen zu verbessern, sprich Regeln abzubauen und weitere Profitmöglichkeiten zu eröffnen. Trotz dieser eindeutigen politischen Zielrichtung sind einige der dabei vorgebrachten Argumente durchaus relevant.
Gerade für Flughäfen wie FRA ist das Aufkommen an Passagieren und Fracht aus der und in die Region zwar nicht unbedeutend, aber ein immer kleiner werdendes Segment vom Gesamtaufkommen. Im Kern wird FRA immer mehr zum
Tourismus-Hub
mit einem Einzugsgebiet
"von Basel bis Hannover und von Düsseldorf bis Nürnberg",
in dem sie mit etlichen anderen Flughäfen konkurrieren.
Und dass Billig- und Ferienflieger wie
Ryanair
schnell darin sind, irgendwo eine Basis aufzumachen und ein paar Jahre später wieder aufzulösen, haben sie auch hier schon bewiesen.
Auch die Hub-Funktion im Interkontinental-Verkehr unterliegt einem gewissen Wettbewerb. Wer z.B. von Nordamerika nach Asien nicht direkt fliegen kann, kann wählen, wo in Europa er/sie umsteigen möchte. Laut der ACI-Studie gilt das für die Hälfte bis zu drei Vierteln der Verbindungsflüge an europäischen Hubs, mit 67% für FRA.
Und auch der lokale Platzhirsch Lufthansa Group und ihre Star Alliance kann ein Stück weit ihre Hubs in Frankfurt, München, Wien, Zürich und Brüssel gegeneinander ausspielen, auch wenn vieles davon in der Vergangenheit
nur Theaterdonner
war. Immerhin verschafft sie sich mit ihrer jüngsten
Zubringer-Tochter
ein Instrument, mit dem alle diese Hubs nahezu gleichwertig bedient werden könnten.
In diesem "Wettbewerbs-Umfeld" stellt sich Fraport
wie gewohnt aggressiv
auf als "Standort mit konkreten Ausbauplänen", der ein möglichst grosses Stück vom vermeintlich nun endlich langfristig wachsenden Kuchen haben will.
"Airlines wollen in Terminal 3"
ist nichts weiter als die selbstbewusste Behauptung, den
"beauty contest",
in dem nach den Worten des ACI Europe-Generaldirektors
"Flughäfen wetteifern, um die ungebundenen Airlines anzuziehen"
(eigene Übersetzung),
gewinnen zu können.
Grenzen
wollen sie nicht anerkennen, weder was die eigenen Möglichkeiten noch die planetaren Ressourcen und die Leidensfähigkeit der Bevölkerung im Umland angeht. Und während Flughäfen wie Düsseldorf oder Wien nach Möglichkeiten suchen, Konfrontationen zu vermeiden oder in die Zukunft zu verschieben, zieht Fraport ihren Kurs durch, wohl wissend, dass sie breite politische Unterstützung in Bund und Land haben und der Widerstand dagegen nur noch sehr schwach ist.
Wenn der Hinweis, Terminal 3 sei
"Chance statt Milliardengrab"
,
dennoch ein wenig nach Pfeifen im dunklen Wald klingt, dann deshalb, weil die Risiken nicht zu übersehen sind. Auch bei wohlhabenderen Menschen stehen die Ausgaben für Reisen früh zur Disposition, wenn die wirtschaftliche Lage schlechter wird. Und je mehr Gebiete rund um die Welt je nach Lage und Jahreszeit entweder austrocknen oder absaufen, desto enger wird es für den globalen Tourismus. Schon wie die Welt 2026, wenn T3 in Betrieb gehen soll, aussehen wird, ist ungewiss. Alles darüber hinaus ist es erst recht.
Wir können es uns nicht verkneifen, noch auf eine Besonderheit hinzuweisen. In der
dpa-Meldung
zur Fraport-Aktion wird medial ausgewogen im letzten Absatz noch berichtet:
"Gegner wollen wegen Fluglärms hingegen eine niedrigere Obergrenze durchsetzen und kämpfen auch gegen das T3. Die Kapazitätssteigerungen und mehr Starts und Landungen würden zu einer "weiteren Verlärmung" führen, heißt es bei der Bürgerinitiative gegen Fluglärm Raunheim. Insgesamt kämpfen mehr als 80 Initiativen im "Bündnis der Bürgerinitiativen" gegen den Flughafenausbau."
Wow! 80 Initiativen kämpfen im Bündnis, aber nur die BI Raunheim wird namentlich erwähnt. Womit haben wir uns das verdient?
So ganz genau wissen wir es auch nicht. Gefühlt passt das Kurz-Zitat sinngemäß zu jedem zweiten Beitrag auf unserer Seite, stammt aber wohl aus der
Einschätzung,
die wir im November letzten Jahres anlässlich der Meldung zur Schliessung von Terminal 2 verfasst haben. Da kamen wir zu dem Ergebnis:
"Terminal 3 soll Kapazitätssteigerungen nicht nur dadurch ermöglichen, dass mehr Passagiere abgefertigt werden können, sondern auch dadurch, dass Starts und Landungen dichter gepackt und damit mehr Flugbewegungen pro Stunde realisiert werden können. Auch wenn das auf absehbare Zeit nicht ganztägig gebraucht, sondern nur stundenweise praktiziert werden sollte, würde das zu weiterer Verlärmung und mehr Risiken führen."
Bis dpa mal so viel kritischen Hintergrund und vielleicht sogar die genaue Quelle für die zugrunde liegende Argumentation veröffentlicht, müssen wir uns wohl noch ein paar Jahre anstrengen. Aber immerhin: es ist ein Anfang.
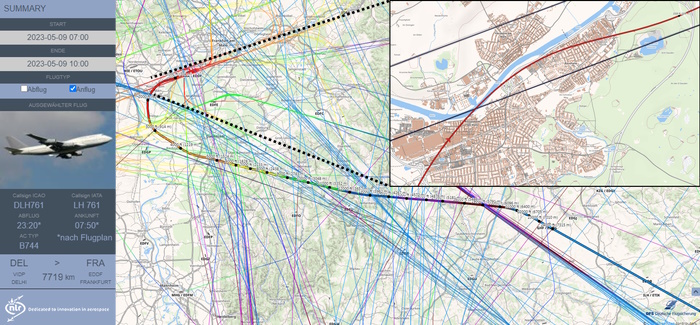
Flug der B747-400 vom Absinken aus der Reiseflughöhe bis zur Landung
und Ausschnitt des Fluges über Rüsselsheim und Raunheim (zum Vergrössern anklicken)
10.05.2023
Am Vormittag des Dienstag, 09.05., wunderten sich Anwohner*innen in Alt-Raunheim über einen ungewöhnlichen Anflug. Es sah aus, als habe eine vierstrahlige Maschine im letzten Moment einen Swing von der Nordwestbahn auf die Centerbahn ausgeführt. Neben der ungewöhnlichen Route wirkte sie auch besonders niedrig und besonders laut.
Eine genauere Betrachtung ergibt ein etwas anderes Bild. Die Boeing 747-400 der Lufthansa aus Dehli, Indien, flog in der Tat einen etwas ungewöhnlichen Kurs, aber nicht nur über Raunheim. Schon unmittelbar nach Einflug in den deutschen Luftraum wich sie von Österreich kommend von den üblichen Flugrouten ab und flog in relativ niedriger Höhe auf einem Kurs auf FRA zu, der sonst als "Curved Approach" nur zu betriebs-armen Zeiten genutzt werden kann.
Nach einem sehr niedrigen Anflug über Bauschheim und die Innenstadt von Rüsselsheim drehte sie vom Main kommend über Raunheim auf den Anflug zur Centerbahn ein, wo sie offenbar ohne Probleme landete.
Obwohl zu dieser Zeit reger Betrieb herrschte, wurden die Anflüge auf die Nordwest- und die Südbahn während dieses Anflug unterbrochen, was als sicheres Zeichen dafür gelten kann, dass es primär darum ging, die Maschine aus Indien so schnell wie möglich herein zu holen. Offensichtlich lag hier ein Notfall vor, der von der DFS als so dringend eingeschätzt wurde, dass alles andere zurückstehen musste.
Gehen wir gutwillig davon aus, dass es hier nicht darum ging, dass ein wichtige Persönlichkeit zu spät zum Frühstück kommen könnte (die Maschine hatte mehr als eine halbe Stunde Verspätung), spricht alles dafür, dass hier ein medizinischer oder ähnlich dringender Notfall vorlag.
Grund zur Beschwerde gäbe es damit nicht. Was liesse sich sonst aus dem Fall lernen?
Es war offenbar schon früh klar, auf welchem Kurs die Maschine landen sollte. Trotzdem ist sie beim Einschwenken auf die Centerbahn zu weit nach Norden geraten und musste den Kurs korrigieren. Das kann man als Indiz dafür werten, dass der "Curved Approach" tatsächlich nur im
abhängigen Betrieb
genutzt werden kann, d.h. wenn eine Maschine von Süden kommend östlich des Rheins auf die Center- oder Südbahn einschwenkt, darf kein Anflug auf die Nordwestbahn stattfinden.
In den kommenden 14 Tagen könnte er allerdings öfter angewendet werden, denn wie Fraport
nochmals mitteilt,
wird die
Nordwestbahn vom 16. bis 31. Mai komplett gesperrt.
In dieser Zeit soll die Oberfläche der Bahn erneuert werden. Als Konsequenz weisst Fraport lediglich darauf hin, dass in dieser Zeit die
Lärmpausen
ausgesetzt werden müssen. Dass unter den An- und Abflügen vom Parallelbahn-System dann mit wesentlich mehr Krach zu rechnen ist, auch wenn die Zahl der zulässigen Flugbewegungen pro Stunde
geringfügig abgesenkt
wird, ist ja selbstverständlich.
Generell gilt ohnehin: je näher man dem Flughafen kommt, desto mehr muss man mit Belastungen aller Art rechnen und hat sie hinzunehmen. Natürlich könnte man davon träumen, dass DFS, Fraport & Co. in einem Fall aussergewöhnlicher Belastung wie dem oben beschriebenen Anflug von sich aus informieren, was passiert ist und warum diese oder jene Maßnahme notwendig war, oder eine brauchbare Prognose vorlegen, welche Belastungen während der Sperrung zu erwarten sind. Aber das würde ja voraussetzen, dass dort Verständnis für die Probleme der Anwohner vorhanden wäre. Soweit sind wir jedoch noch lange nicht.

07.05.2023
Fraport
träumte schon 2019 davon,
"in das Flugtaxi-Geschäft"
einzusteigen.
"In fünf bis zehn Jahren wollen wir in den Regelbetrieb"
gehen, liessen sie damals verlauten. In jüngerer Zeit waren die Aussagen
etwas zurückhaltender.
Wie schnell es letztendlich gehen könnte, ist noch unklar, da noch
eine Reihe von Problemen
zu lösen sind und auch deutsche Konzerne Flugtaxis derzeit nur
für den asiatischen Markt
entwickeln. Die Vorbereitungen für die Einführung von Drohnen als Taxis oder Lasttransporter gehen aber auch
hierzulande weiter,
und es gibt Hinweise, das unangenehme Überraschungen drohen können.
So behauptete Fraport ursprünglich, es gäbe
"Kein Dreck, kein Krach. Der Antrieb ist elektrisch, der Flug geräuschlos",
aber das war natürlich nur der übliche Fraport-Unsinn. Galileo sagt realistischer,
"Bei Start, Landung und während des Flugs machen Drohnen weniger Lärm als Flugzeuge oder Hubschrauber. In 75 Meter Höhe erzeugen sie zwischen 70 und 75 Dezibel. Das ist ungefähr so laut wie ein Staubsauger oder die Waschmaschine im Schleudergang", und das klingt schon weniger freundlich.
Wissenschaftlichere Auseinandersetzungen mit Drohnen-Lärm konzentrieren sich, wie eine
UBA-Literaturstudie
zeigt, aktuell noch
"auf Drohnen der Bauform Multicopter mit einer maximalen Startmasse bis 25 kg, da valide Literaturangaben für andere Bauformen und/oder höhere Startmassen derzeit kaum vorliegen. Aber auch für Drohnen mit einer maximalen Startmasse unter 25 kg ist die Datenlage derzeit sehr dünn".
Immerhin reichen die Daten aus, um festzustellen,
"dass die Geräusche von Drohnen deutlich stärker belästigend sind, als sonstige Verkehrsgeräusche. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf ihre Geräuschcharakteristik, die durch eine starke Tonhaltigkeit sowie ein hochfrequentes, breitbandiges Geräusch gekennzeichnet ist".
Trotz "dünner Datenlage" hat die auch für Umweltregeln zuständige EU-Agentur für Luftsicherheit, die European Union Aviation Safety Agency
EASA,
einen
Vorschlag
für eine
"Erfassung und Begrenzung des Lärms von Flugtaxis"
entwickelt und führt aktuell eine
Anhörung
dazu durch.
Formell handelt es sich um "Technische Spezifikationen für den Umweltschutz" (Environmental Protection Technical Specifications (EPTS)),
anwendbar auf "elektrische senkrecht startende und landende Luftfahrzeuge" (electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) aircraft),
die "von mehreren, vertikalen, nicht-klappbaren und gleichmäßig verteilten Rotoren" angetrieben werden.
EASA gibt an, dass das weltweit die erste diesbezügliche Norm ist, die
"Grenzen setzt und gewährleistet, dass die Lärmbelastung nicht exzessiv wird".
Sie kann daher durchaus als Muster für alle folgenden Regulierungen dieser Art von Flugkörpern, vulgo Drohnen, betrachtet werden.
"Nicht exzessive" Lärmbelastung klingt schon nicht nach besonders hohem Anspruch, aber nicht einmal der wird erfüllt. Denn weiter wird erläutert, dass die vorgeschlagenen Spezifikationen
"den international harmonisierten Zertifizierungs-Standard für schwere Helikopter als Startpunkt"
nehmen, um
"Chancengleichheit und Vergleichbarkeit der Technologien"
zu gewährleisten.
Technisch bedeutet das, dass der "maximal erlaubte Lärmpegel", ausgedrückt als "Effective Perceived Noise Level (EPNL)" und abhängig vom maximal zulässigen Startgewicht des Flugkörpers und Flugphase auf folgende Werte festgelegt wird:
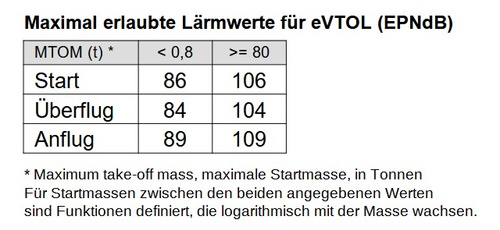
Mit anderen Worten: Drohnen dürfen künftig nicht nur genauso laut sein wie schwere Hubschrauber, die größten dürfen sogar noch ein bißchen lauter sein als das größte existierende Passagierflugzeug. Und sie sollen nicht über "lärm-optimierte" Flugrouten zu Flughäfen, sondern über dicht besiedeltes Gebiet bis in den innerstädtischen Bereich fliegen. Selbst wenn man nur die unteren Grenzwerte für leichtere Drohnen betrachtet, bewegt sich das in Bereichen, die auch von moderneren, nicht ganz so grossen Passagierflugzeugen wie dem A320 erreicht werden.
Wie die EU ihr Ziel, die Lärmbelastung der Bevölkerung bis 2030
deutlich zu senken,
erreichen will, wenn sie zugleich zahlreiche dicht besiedelte Gebiete neuen derartigen Belastungen aussetzt, bleibt ihr Geheimnis.
Man muss das Ganze wohl so verstehen: EASA geht bei der Standard-Definition genauso vor, wie die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation ICAO das üblicherweise auch tut: die Grenzwerte werden so gewählt, dass sie niemandem wehtun, weil sie von der aktuellen Technik ohnehin eingehalten werden. Der betroffenen Bevölkerung sagen sie im Grunde: Wenn ihr in eurer Region Geschäfte mit solchem Gerät duldet, ist es euer Problem. Wir werden euch vor dem dabei entstehenden Lärm nicht schützen.
Daraus kann man ableiten, welche Botschaft jetzt an Fraport & Co. gehen müsste: Falls ihr wirklich noch davon träumt,
"Fluggäste mit Ziel Messe oder Hauptbahnhof"
per Flugtaxi vom Flughafen dorthin zu bringen, wacht endlich auf. Die Region verträgt nicht noch mehr Lärm, und auch Ökostrom steht für solchen Unsinn auf absehbare Zeit nicht genügend zur Verfügung.
Wer der EASA direkt die Meinung zu diesem Vorschlag sagen möchte, kann das noch bis zum 15. Juni dieses Jahres über ein spezielles
Web-Tool
tun. Man muss sich dafür allerdings registrieren.
Ob in den über 70 Seiten des Papiers, das noch jede Menge technischer Details zu Definition und Messung der relevanten Lärmwerte enthält, noch weitere kritikwürdige Punkte enthalten sind, können wohl nur ausgewiesene Fluglärm-Experten beurteilen. Politisch sollte es allerdings völlig ausreichen, darauf hinzuweisen, dass mit diesem Vorschlag
"die gesellschaftlichen Bedenken gegenüber dieser neuen Form des städtischen Transports"
keineswegs ausgeräumt, sondern im Gegenteil nur verstärkt werden.
Den Widerstand gegen die Umsetzung dieser neuen Geschäftsmodelle werden solche Stellungnahmen allerdings nicht ersetzen können.
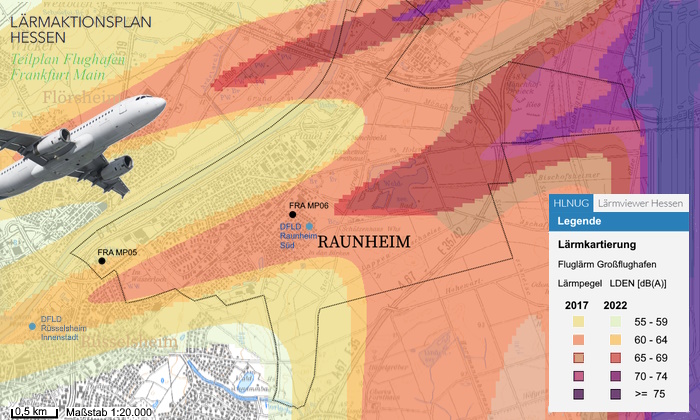
Versuch eines Vergleichs der Ergebnisse der Fluglärm-Kartierungen 2017 (Datenbasis 2016)
und 2022 (Datenbasis 2019) für den Bereich der Gemarkung Raunheim.
20.04.2023
(Updates
24.04., 29.04. und 30.04.2023)
Knapp ein Jahr nachdem die letzte Version des "Lärmaktionsplan Flughafen Frankfurt" vorgelegt wurde, ruft das Regierungspräsidium Darmstadt zur Beteiligung der Öffentlichkeit an einer neuen, vierten Runde der Aktionsplanung auf. Auch die Stadt Raunheim weist ihre Bürger*innen auf die Möglichkeit zur Teilnahme hin.
Dass das
über 270 Seiten dicke Werk
nun schon relativ kurz nach Erscheinen wieder zur Diskussion steht, hat Gründe, die das RP lieber nicht allzu sehr in den Vordergrund rücken möchte.
Der erste ist natürlich, dass die
EU-Umgebungslärm-Richtlinie,
die Anlass für die ganze Aktion ist, 2002 verabschiedet wurde und alle fünf Jahre eine Überprüfung der Lärmsituation und der Aktionsplanung vorsieht. Also waren 2007, 2012, 2017 und nun 2022 neue Lärmkartierungen zu erstellen und die Aktionspläne zu überarbeiten. Dass das jedesmal ein bißschen länger gedauert hat, so dass die Verspätung in der letzten Runde schon fünf Jahre betrug und jetzt gleich (verspätet) weitergemacht werden kann, zeigt, wie wichtig die Sache genommen wird.
Es gibt aber durchaus noch weitere, interessantere Gründe, nach denen man aber etwas tiefer graben muss.
Da wäre zunächst der
Tadel der EU-Kommission,
freundlich-motivierend verpackt in einen Bericht über die bisherigen Wirkungen der Umgebungslärm-Richtlinie. Dort findet man zunächst den Hinweis, dass die Kommission schon vor Längerem
"gegen 15 Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichender Umsetzung eingeleitet"
hatte (zu denen eines gegen Deutschland gehörte), von denen sieben
"aufgrund der verbesserten Einhaltung der Bestimmungen ... eingestellt werden"
konnten (zu denen das gegen Deutschland nicht gehörte). Für den selbsternannten Musterschüler der EU in Sachen Umwelt ist das kein Ruhmesblatt.
Der EU-Bericht weist auch darauf hin, dass seit 01.01.2022 eine
Änderung
der Umgebungslärm-Richtlinie in Kraft ist, wonach die Risiken bestimmter gesundheitsschädlicher Lärmwirkungen erfasst und bewertet werden müssen. Für Fluglärm betrifft das die "starke Belästigung" und die "starke Schlafstörung".
Damit genügt es nun definitiv nicht mehr, wie im "Aktionsplan" vom 11.04.2022 nur ganz wertneutral
"die neusten Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung"
vorzustellen und darauf hinzuweisen, dass dadurch
"die für lärmmindernde Maßnahmen zuständigen Luftfahrtbehörden nicht verpflichtet"
werden, irgend etwas zu tun. Nun ist das RP gefordert, die Risiken explizit zu berechnen und zu bewerten, d.h. zu beurteilen, was getan werden muss, um sie zu senken. Man darf gespannt sein.
Damit wären wir bei der Hauptkritik des EU-Berichts angekommen. Er stellt nüchtern fest, dass die Lärmbelastungen trotz Umsetzung der Richtlinie in den letzten 20 Jahren kontinuierlich zugenommen hat und auch
"das spezifische Ziel, die Zahl der Menschen, die einer chronischen Belastung durch Verkehrslärm ausgesetzt sind, bis 2030 gegenüber 2017 um 30% zu senken",
nicht erreicht werden wird. Warum das so ist, hat die Kommission in Bezug auf Lärm von Großflughäfen in einer
eigenen Studie
untersuchen lassen. Diese stützt sich zwar wesentlich auf Berichte und Einschätzungen der jeweils für die Flughäfen "zuständigen Behörden" (und wäre eine eigene Betrachtung wert), macht aber trotzdem deutlich, dass die lokale Lärmschutzpolitik sich primär an den jeweiligen nationalen Regeln und Verfahren orientiert und die EU-Regeln und -Ziele wenig Einfluss darauf haben.
Zu einem ähnlichen Ergebnis sind wir bei einer
Analyse
des Ablaufs der letzten Runde der Lärmaktionsplanung durch das RP Darmstadt ebenfalls gekommen:
"Und so überrascht es nicht, dass die durchgeführten und geplanten Maßnahmen eben die sind, die Landesregierung, DFS, 'Forum Flughafen und Region/ExpASS', Fraport usw. in den letzten Jahren präsentiert haben. Eine eigenständige Ergebnis-Darstellung und -Bewertung dieser Maßnahmen hält das RP nicht für seine Aufgabe. Es werden lediglich sehr allgemeine verbale Angaben über die Durchführung der Maßnahmen gemacht ("ist in Betrieb", "wird zu x% der Zeit genutzt" etc.). Ob dadurch irgendwo weniger Lärm ist oder gar die Belästigung sinkt, spielt keine Rolle."
Die EU-Kommission hat mit der oben genannten Änderung der Umgebungslärmrichtlinie und zwei Urteilen des Gerichtshof der Europäischen Union deutlich gemacht, dass es so nicht gemeint ist.
Ein weiterer wichtiger Grund für einen neuen Lärmaktionsplan ist, dass dafür veränderte Lärmwerte in der Umgebung des Flughafens Frankfurt zugrunde gelegt werden müssen. Das heisst nicht, dass sich die Lärmsituation tatsächlich wesentlich verändert hätte. Geändert hat sich erstmal nur das Verfahren, mit dem aus den stattgefundenen Flugbewegungen die jeweils in der Fläche bewirkten Lärmbelastungen berechnet werden.
Ruft man den
Lärmviewer Hessen
der Hessischen Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf und wählt "Lärmkartierung 2022" und "Fluglärm Großflughafen", bekommt man zunächst einen kurzen Erläuterungstext angezeigt, dessen
ausführlichere Variante
auf der HLNUG-Webseite zur Verfügung steht. Auch das RP Darmstadt stellt
Erläuterungen
zur Verfügung.
Daraus kann man lernen:
"Bislang galt für die Lärmkartierung die Vorläufige Berechnungsmethode für die Berechnung von Umgebungslärm an Flugplätzen (VBUF). Jetzt wurde die neue Berechnungsmethode für die Berechnung von Umgebungslärm an Flugplätzen (BUF) eingeführt. Diese neue Berechnungsmethode basiert auf dem EU-weit einheitlichen Lärmberechnungsverfahren CNOSSOS in Kombination mit neu definierten Vorgaben, welche Lärmwerte in der Lärm-Berechnungssoftware für verschiedene Flugzeuggruppen bei Starts und Landungen jeweils in bestimmten Abständen vom Flughafen bei der Berechnung unterstellt werden sollen."
Wir haben uns mal angesehen, was die neue Berechnung für Raunheim bedeutet und die Kartierungen 2017 und 2022 verglichen. In der Grafik sieht man, dass die höchsten Lärmkategorien '>=75 dB(A)' und '70-74 dB(A)' (Schwarz-blaue und violette Färbung) nach wie vor nur auf dem Flughafengelände bzw. in unbewohntem Gebiet nahe der Start- und Landebahnen auftreten, wobei die violette Zone in der neuen Berechnung deutlich schmaler wird, aber noch fast genauso weit vom Flughafen weg ragt. Die '65-69 dB(A)'-Zone (hellbraun/rotbraun) wird ebenfalls schmaler, ragt aber auch praktisch noch genauso weit Richtung Raunheim wie vorher. Anders sieht es mit der '60-64 dB(A)'-Zone (rotorange/gelborange) aus: die ist über dem Raunheimer Stadtgebiet breiter und ragt nun bis Rüsselsheim hinein. Dass die '55-59 dB(A)'-Zone (hellgelb/grüngelb) ebenfalls grösser geworden ist, tangiert Raunheim kaum: nur der südwestlichste Zipfel der Gemarkung, im Wald zwischen Horlachgraben und Waldweg, lag bisher ausserhalb - jetzt aber auch nicht mehr.
Vergleicht man das mit den gemessenen Ergebnissen an den vorhandenen Meßstationen, berichtet
Fraport
(für die "6 verkehrsreichsten Monate") für die Station 05 Opelbrücke einen Lden-Wert von 58,4 dB(A), für die Station 06 Raunheim 62,5 dB(A). An den
DFLD-Stationen
Raunheim Süd wurde ein Lden-Wert von 61,7 dB(A), in Rüsselsheim Innenstadt 61,6 dB(A) (für das ganze Jahr) gemessen. Diese Werte passen besser zu der neuen Berechnung als zu der alten.
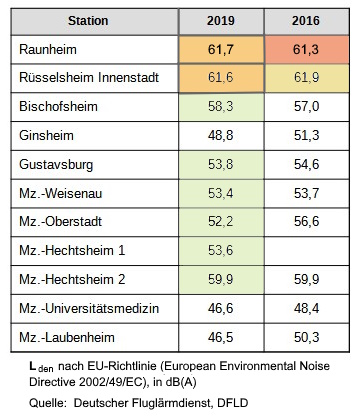
RP und HLNUG haben aber ein anderes Problem:
"Bei der Berechnung nach BUF werden in der Nähe des Flughafens geringere Immissionen berechnet und in weiter entfernten Gebieten oft höhere Immissionen als bei der bislang zu verwendenden Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen (VBUF)."
Das RP weiss auch:
"Umso weiter sich die Messstationen vom Flughafen entfernen, desto größer wird tendenziell der Unterschied zwischen Lärmberechnung und Lärmmessung"
(HLNUG sagt ähnliches, formuliert aber vorsichtiger). Um diese letzte Aussage zu überprüfen, haben wir uns die Meßwerte für die Stationen im DFLD-Netz, die in oder nahe der nach Westen reichenden Zunge der '55-59 dB(A)'-Zone liegen, für die Jahre 2016 und 2019 (die den Kartierungen 2017 und 2022 zugrunde liegen) näher angesehen.
Vorab sei aber auf einen Vorbehalt hingewiesen, den der DFLD allen diesen Mittelwert-Rechnereien voranstellt:
"Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch".
Die Überflugerkennung wird umso schlechter, je leiser ein Flugzeug im Vergleich zu sonstigen Lärmereignissen ist. Während in Raunheim praktisch jeder Überflug richtig erkannt wird, ist die Fehlerquote z.B. in Mainz deutlich höher, wobei der DFLD zweifelhafte Werte eher ausschliesst und daher dort tendenziell "zu niedrig" misst.
Tatsächlich liegen die Meßwerte der Stationen, die in der Kartierung 2022 erstmals in der '55-59 dB(A)'-Zone liegen, alle in oder knapp unterhalb dieses Bereichs. Die 2016er Werte liegen fast alle höher, hätten also bereits damals in diese Zone gehört, lagen aber z.T. weit ausserhalb. Man kann die gleiche Betrachtung für den Bereich östlich des Flughafens durchführen und kommt zu ähnlichen Ergebnissen.
Damit sieht es so aus, als würde die neue Berechnung nach BUV die tatsächlichen Lärmverhältnisse auch weiter entfernt vom Flughafen besser oder zumindest nicht schlechter wiedergeben als die früheren Berechnungen. Das aber wollen die betroffenen offiziellen Stellen lieber nicht wahrhaben.
Schon in der
Sitzung
der Fluglärmkommission im Februar hatten
das Ministerium
und
HLNUG
ausführliche Präsentationen zur neuen Lärmberechnung vorgelegt. In den insgesamt 76 Folien wird u.a. gezeigt, dass die veränderten Ergebnisse tatsächlich überwiegend auf das geänderte Berechnungsverfahren und nur zum geringsten Teil auf Änderungen in der Datengrundlage zurückzuführen sind (d.h. es wurde 2019 wahrscheinlich etwa genauso viel Lärm erzeugt als 2016, aber die Rechnung ergibt höhere Werte). Für den Vergleich von Messung und Rechnung werden die Meßstationen der Fraport und des
Umwelt- und Nachbarschaftshauses
herangezogen. Erwartungsgemäß liegen auch hier die Meßwerte niedriger als die Rechenwerte, allerdings gibt es in den als besonders problematisch betrachteten grösseren Entfernungen zum Flughafen praktisch keine solchen Meßstationen, und deren Auswertungen entsprechen auch nicht der für die Umweltlärmkartierung geforderten Norm (sondern der des 'Fluglärmschutzgesetzes').
Besonders interessant, wenn auch sehr technisch, sind die Ausführungen dazu, warum weder die Messungen noch die Berechnungen den "wahren" Lärm wiedergeben können und welche Einschränkungen, Annahmen, Vereinfachungen etc. die Ergebnisse jeweils beeinflussen. Darauf geht auch ein
Kommentar
der 'Bundesvereinigung gegen Fluglärm' (BVF) mit kritischen Fragen zu den Meßergebnissen der Fraport ein. Im Ergebnis hat die FLK
beschlossen,
von allen Beteiligten weitere Untersuchungen und eine genauere Erfassung des verursachten Lärms zu fordern.
Damit nähern wir uns auch dem Kern der ganzen Aufregung. Niemand beurteilt die Aufenthaltsqualität in einer bestimmten Region danach, ob der über 24 Stunden gemittelte äquivalente Dauerschallpegel im Jahresmittel 54,4 oder 55,1 dB(A) beträgt. Rechtlich ist das aber ein bedeutender Unterschied.
Nach EU-Umgebungslärmrichtlinie gelten Menschen als lärmbelastet, wenn sie in Gebieten mit Lden >54,5 dB(A) oder Lnight >49,5 dB(A) leben. Wie das HLNUG der FLK mitgeteilt hat, sind die Zahlen der durch Fluglärm Belasteten im Rhein-Main-Gebiet durch die neue Berechnung ganztags von knapp 190.000 auf knapp 400.000 und nachts von über 36.000 auf über 82.000 gestiegen. Das allein ist schon ärgerlich genug und gibt ein schlechtes Bild ab, hat aber sonst keine gravierenden Konsequenzen.
Aber es droht Schlimmeres. Bei der überfälligen Novellierung der Lärmberechnungen gemäß Fluglärmschutzgesetz sollen ebenfalls die neuen Rechenverfahren zum Einsatz kommen, und hier hätten erhöhte Lärmwerte weitaus drastischere Konsequenzen: neue Lärmschutzbereiche und neue Siedlungsbeschränkungszonen, daraus resultierend neue Ansprüche auf passiven Schallschutz, neue Bauverbote und etliches andere mehr. Kein Wunder, dass nun fieberhaft nach Schräubchen gesucht wird, mit denen die Lärmwerte wieder in die richtige Richtung gedreht werden können.
Dabei ist die Forderung nach einer besseren Messung und Berechnung des von Flugzeugen verursachten Lärms natürlich nicht falsch. Ansätze dafür gibt es schon länger. Wie man die Messungen verbessern kann, könnte Fraport selbst vom UNH noch lernen, u.a. in
diesem Aufsatz.
Dass bessere Berechnungen des Lärm auch in grösseren Entfernungen vom Flughafen möglich sind, hat der Deutsche Fluglärmdienst
DFLD
im Auftrag der Initiative
Zukunft Rhein-Main
schon
vor fast 10 Jahren
gezeigt.
Womit wir wieder bei der Anhörung zum Lärmaktionsplan wären. Nach dieser Vorgeschichte wird das RP Forderungen nach einer besseren Erfassung des Fluglärms als Vorbedingung für erfolgreiche Aktionen dagegen kaum generell ablehnen können. Allerdings sollte man nicht bei der FLK-Forderung einer einmaligen Untersuchung stehenbleiben, sondern eine dauerhafte, die ganze Region umfassende Fluglärm-Überwachung auf dem neuesten Stand der Technik fordern, also inklusive moderner Software zur Geräuscherkennung und Korrelation mit Flugbewegungsdaten zur sicheren Identifizierung von Überflugereignissen und über die EU-Mindeststandards hinausgehender, an die lokalen Gegebenheiten angepasster Berechnungsprogramme. Das lässt sich auch wunderbar verknüpfen mit der Forderung nach wirksamen Gebührenerhöhungen in Abhängigkeit vom tatsächlich verursachten Lärm.
Ansonsten müssen wir auch zugeben, dass wir von der Änderung des Verfahrens der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Möglichkeit, bereits in der ersten Runde Stellungnahmen abgeben zu können, überrascht wurden. Deshalb erscheint dieser Betrag erst wenige Tage, bevor die Frist zur Einreichung von "Anregungen und Vorschlägen zu Lärmminderungsmaßnahmen" abläuft (30.04.2023) und bevor ein Entwurf für eine BI-Stellungnahme vorliegt.
Andererseits könnten wir natürlich unsere
Stellungnahme
zur letzten Runde einfach nochmal abgeben, denn alle Vorschläge wurden damals mit einer der drei Standard-Begründungen ("geht nicht", "zu teuer", "kein Bock") abgelehnt. Vielleicht wäre das unter den neuen Bedingungen nicht mehr ganz so einfach.
Wir wollen aber dem RP bei seinem Bemühen, die Belasteten-Zahlen wieder abzusenken, entgegen kommen, und auch dafür gibt es hilfreiche EU-Materialien. Die EU-Kommission hat das
Phenomena-Projekt
durchführen lassen, das Lärmaktionspläne analysiert hat mit dem Ziel, Maßnahmen zu identifizieren, die
"signifikante Reduzierungen (20%-50%) der Gesundheits-Belastungen liefern können, die aus dem Umweltlärm von Strassen, Schienen und Flugzeugen resultieren (eigene Übersetzung)".
Die Europäische Umweltagentur hat
Szenarien
entwickeln lassen, wie sich die gesundheitlichen Wirkungen von Verkehrslärm bis 2030 entwickeln könnten und was dagegen am besten hilft. Für Fluglärm ergibt das optimistische Szenario, dass sich diese Wirkungen durch technische Fortschritte und operative Maßnahmen nur in begrenztem Umfang reduzieren lassen. Am Frankfurter Flughafen mit seinem verkorksten Bahnensystem und dem chronisch überfüllten Luftraum ist davon fast nichts zu erwarten. Das kann man sich im Detail auch in der
Dokumentation
zur
"5. Internationalen Konferenz Aktiver Schallschutz ICANA 23"
ansehen und -hören.
Was dagegen eindeutig hilft und die Belasteten-Zahlen drastisch senken kann, sind Betriebsbeschränkungen, insbesondere während der Nachtzeiten. Die können überall umgesetzt werden und haben unmittelbare, direkt spürbare Wirkungen. Aus den "Schlussfolgerungen" des Phenomena-Projekts (S. 317):
"Die beste Einzellösung im Hinblick auf die Reduzierung der Gesundheitslasten ist die Einführung eines Nachtflugverbots an allen Flughäfen, d.h. ein EU-weites Verbot von Nachtflügen. Reduzierung der Gesundheitslasten bis 2030: 37-60%" (eigene Übersetzung).
In einen realistischen Lärmaktionsplan für den Flughafen Frankfurt für die nächsten fünf Jahre gehören daher unbedingt die beiden folgenden Forderungen:
Inzwischen liegt auch die gemeinsame
Stellungnahme
der kommunalen Netzwerke
ZRM
und
KAG
vor. Die acht Seiten sind lesenswert und beinhalten auch noch Tabellen mit weiteren Aufschlüsselungen der Betroffenheiten nach der neuen Lärmberechnung. Im Hinblick auf Einschätzungen und Forderungen fühlen wir uns in Vielem bestätigt.
Zur bisherigen Lärmaktionsplanung wird mit Verweis auf die EU-Kritik festgestellt, dass die aktuelle Planung
"nicht den unionsrechtlichen und nationalen Regelungen zur Ermittlung der Belange und den Inhalten des Lärmaktionsplan"
entspricht und insbesondere
"jegliche Verbindlichkeit und der Wille zur Umsetzung"
fehlt.
Die neue Berechnungsmethode wird begrüsst, denn sie
"deckt sich mit der Wahrnehmung der von Fluglärm betroffenen Anwohner*innen ..."
und
"... bestätigt, dass auch die weiter entfernt lebenden Menschen in der Metropolregion Rhein-Main vom Fluglärm stark belästigt werden, bzw. erheblichen Schlafstörungen ausgesetzt sind. Die ermittelten Zahlen und Daten erfordern für den Flughafen Frankfurt am Main weitaus mehr Anstrengungen zur Fluglärmreduzierung, als dies bisher der Fall war".
Zu den Forderungen
"wird betont, dass der Fluglärmschutz in der Nacht aufgrund der hohen Zahl an Betroffenen erheblich erweitert werden muss. Dies gilt entsprechend auch für den Fluglärmschutz für den gesamten Tag - hierbei spielt die Anordnung von Betriebsbeschränkungen und damit die Änderung des Planfeststellungsbeschlusses eine zentrale Rolle".
Konkret:
"Eine der wichtigsten Forderungen ist die Ausweitung des Nachtflugverbots auf 22 bis 6 Uhr",
was mit Übergangszielen bis 2030 verbunden wird.
Zum
"Fluglärmschutz für den gesamten Tag"
heisst es:
"Eine noch stärkere Lärmbelastung durch weitere Flugbewegungen muss dringend vermieden werden!"
Damit haben wir es nun schwarz auf weiss, dass unsere Forderungen keineswegs radikal und weltfremd sind - aber umgesetzt werden sie deswegen noch lange nicht. Selbst wenn alle kommunalen Vertreter*innen, die durch die beiden Netzwerke repräsentiert werden, aufrichtig und ernsthaft hinter diesen Forderungen stünden (woran in dem einen oder anderen Fall durchaus Zweifel erlaubt sind), erhalten sie nur dann Gewicht, wenn die betroffene Bevölkerung selbst deutlich macht, dass sie ihr wichtig sind.
Es bleibt uns mit Sicherheit nicht erspart, selber aktiv dafür einzutreten, wenn es in der Region leiser werden soll.
Und wir haben es nun auch noch kurz vor Einsendeschluss geschafft, eine
aktualisierte Stellungnahme
beim RP einzureichen. Die gut versteckten Daten über die Belasteten-Zahlen, die darin erwähnt werden, sind auf der HLNUG-Webseite
als xlsx-Tabellendokument
herunterladbar.
Zum weiteren Ablauf schreibt das RP:
"Die eingehenden Stellungnahmen und Anregungen werden geprüft und mit den hierfür zuständigen Institutionen bzw. Fachbehörden abgestimmt. Die Prüfaufträge und Ergebnisse finden sich anschließend im Lärmaktionsplan wieder. Dieser wird zunächst in einem Entwurf veröffentlicht. In einer zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung – voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2024 – haben betroffene Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Verbände, Organisationen und Interessengemeinschaften erneut Gelegenheit zur Information über den dann aktuellen Sachstand und können Stellungnahmen abgeben."
Wir haben also ein Jahr Zeit, dafür Druck zu machen, dass Lärmschutz von der Politik ernst genommen wird.
Noch später als wir, aber dafür wesentlich umfangreicher und mit sehr viel mehr technischen Details, hat auch die 'Bundesvereinigung gegen Fluglärm' (BVF) ihre
Stellungnahme
veröffentlicht. Etliche Vorschläge sind für eine kurzfristig wirksam werdende Lärmreduzierung durchaus relevant und verdienen Unterstützung.
Insgesamt bleibt die Stellungnahme aber hinter dem, was politisch notwendig und vielleicht auch durchsetzbar ist, deutlich zurück. So ist von der klaren Forderung auf der
BVF-Webseite,
"Einführung von Nachtflugverboten zwischen 22 und 6 Uhr an allen deutschen Flughäfen zum Schutz der Nachtruhe der Anwohner",
in der Stellungnahme nichts zu finden. Auch andere Forderungen, die unter Betroffenen weitgehend Konsens sind, werden nicht erwähnt. Andererseits gibt es Forderungen, deren Nutzen durchaus bezweifelt werden kann.
Eine offene Diskussion unter allen Fluglärm-Gegner*innen in der Rhein-Main-Region über Strategie und Taktik und gemeinsame Forderungen für die kommenden Auseinandersetzungen wäre sicherlich notwendig und nützlich. Aber auch unterschiedliche Ansätze sind durchaus hilfreich, solange sie den Gegner in der gleichen Richtung unter Druck setzen.
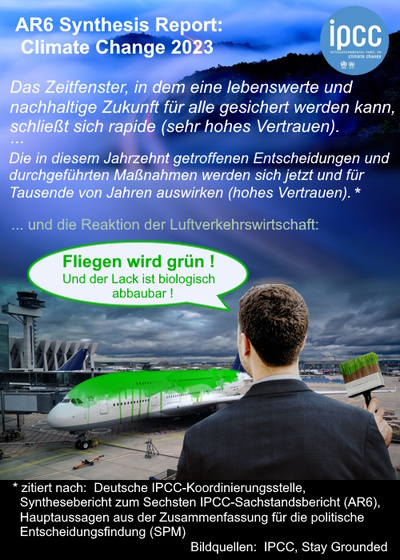
08.04.2023
Ende März hat der sog. Weltklimarat, offiziell die UN-Organisation 'Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC)',
seinen sechsten Berichtszyklus ('Sixth Assessment Report', AR6) mit der Vorlage des sog. Synthese-Berichts
(AR6 SYR),
der die Ergebnisse der Einzelberichte der letzten Jahre seit dem
Pariser Abkommen
zusammenfasst und interpretiert, abgeschlossen.
Die Hauptaussagen lassen sich bei der
Deutschen IPCC-Koordinierungsstelle
schon
auf deutsch
nachlesen. Die "Zusammenfassung für Politikmacher" (Summary for Policymakers,
SPM,
36 Seiten) und den "längeren Bericht"
(Longer Report,
85 Seiten) gibt es nur in Englisch. Der komplette Bericht und dessen deutsche Übersetzung werden wohl erst in einiger Zeit vorliegen.
Die Reaktionen auf diesen Bericht fallen auf allen Ebenen unterschiedlich aus. Während die IPCC-Pressemitteilung noch Optimismus verbreitet und betont, dass die Einhaltung des Pariser 1,5°C-Zieles technisch immer noch möglich wäre, wenn sofort und entschieden gehandelt würde, stellt die UN-Pressemitteilung die schon aufgetretenen Schäden und die Notwendigkeit schnellen Handelns in den Vordergrund. Und nur drei Tage später warnt der UN-Generalsektretär davor, dass der Klimawandel den Planeten unbewohnbar machen werde, wenn nicht sofort "Transformation statt Flickwerk" umgesetzt werde.
Auch in der deutschen Wissenschafts-Community betonen die, die an dem IPCC-Report mitgearbeitet haben, im
Press Briefing
des 'Science Media Center' eher die immer noch bestehenden Chancen, während andere das für
Selbstbetrug
halten. Wieder andere schliessen daraus, dass sich die Klimapolitik nun auf die
Anpassungen
an die unvermeidlich kommenden Veränderungen konzentrieren müsse.
Wie diese Veränderungen in der näheren Zukunft aussehen könnten, versuchen Beiträge
anhand der Grafiken
des IPCC-Berichts oder als
Zeitreise
darzustellen.
Fast allen Stellungnahmen ist aber gemeinsam, dass sie mit grossem Nachdruck darauf hinweisen, dass die Anstrengungen zur Emissionsreduktion in den nächsten Jahren entscheidend für die Entwicklung der Klimaänderungen über eine lange Zeit sein werden. Wohl kein Satz aus dem IPCC-Report wird so oft zitiert wie dieser:
Die Antwort der Luftverkehrswirtschaft auf diese Herausforderung ist eindeutig und bleibt unverändert: sie möchte noch über Jahrzehnte hinaus ihre Treibhausgas-Emissionen steigern und ihre klimaschädigenden Wirkungen noch mehr als verdoppeln. Dabei sind diese Szenarien teilweise schon wieder überholt. Während Industrievertreter öffentlich in noch höheren Wachstumsprognosen schwelgen, verstecken sie das Nicht-Erreichen der Klimaziele, die sie sich gerade erst gesetzt haben und die ohnehin schon gemäß der Fachmethodik als "critically insufficient" ("hochgradig unzureichend") eingeschätzt wurden, im Kleingedruckten. Diese Zieleinstufung bedeutet, dass "das Ziel mit einer Erderwärmung von mehr als 4°C konsistent ist, falls alle anderen Sektoren einem ähnlichen Pfad folgen".
Im Einzelnen wird erläutert, dass wesentliche technologische Fortschritte beim Fluggerät in den nächsten zwanzig Jahren nicht zu erwarten sind, weil aufgrund der aktuellen Knappheit an Flugzeugen alte Maschinen länger im Einsatz bleiben und die Hersteller, die ebenfalls unter Personalknappheit leiden, auf Jahre hinaus mit der Produktion der "bewährten" Flugzeugtypen ausgelastet sind. Auch die "operativen Verbesserungen" wie optimierte und
"klimaschonendere" Flugrouten
werden kaum oder garnicht umgesetzt, angesichts zunehmender Militarisierung wichtiger Lufträume gibt es auf absehbare Zeit hier eher Verschlechterungen.
Im Gegensatz dazu nehmen die meisten
Industrieszenarien
"technologische Effizienzsteigerungen" von 0,5-2 Prozent pro Jahr an. Diese wurden in der Vergangenheit durchaus erreicht, haben aber
nicht zu Emissionsminderungen
geführt, weil sie vom Wachstum des Verkehrs überkompensiert wurden.
Auch die eigentlichen 'Wunderwaffen' der Luftfahrtindustrie, die "nachhaltigen Flugzeugtreibstoffe"
(Sustainable Aviation Fuels, SAF),
erfüllen die Erwartungen nicht. Die "klimafreundlichste" Variante unter ihnen, die sog. eFuels, die mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt werden sollen, stehen auf absehbare Zeit nur in minimalen Mengen zur Verfügung. Nach einer
Analyse
des 'Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung' können die rund 60 weltweit bis 2035 angekündigten (aber finanziell noch nicht abgesicherten) Projekte zu deren Herstellung nur 10% allein des deutschen Bedarfs in den Sektoren Flugverkehr, Schiffsverkehr und Chemie, wo sie alternativlos sind, abdecken.
Auch wenn eFuels (auch 'Synfuels' oder 'Power-to-liquid'-Treibstoffe genannt) in fernerer Zukunft wohl die Treibstoff-Basis für den unvermeidlichen Langstrecken-Flugverkehr bilden werden, kann ihr Beitrag zur aktuell notwendigen Eindämmung der Klimakatastrophe
nur gering
sein. Das bestätigen auch alle 'offiziellen' Szenarien.
SAFs
aus Biomasse
oder organischen Abfällen, die die klimaschädlichen Emissionen bestenfalls teilweise reduzieren und ebenfalls nur begrenzt zur Verfügung stehen, wenn sie nicht mit der Nahrungsproduktion, der Erhaltung der Biodiversität oder anderen, klimafreundlicheren Nutzungen
in Konkurrenz treten
sollen, stossen teilweise ebenfalls auf technische oder ökonomische Schwierigkeiten. Im Extremfall ist ihre Herstellung
mit erhöhten Krebsrisiken verbunden
oder wird aus ökonomischen Gründen
stillschweigend ganz aufgegeben. Dazu kommt, dass für manche Herstellungsverfahren das
Risiko der Nutzung illegaler Rohstoffquellen
mit hohen Umweltrisiken wie der Rodung von Tropenwäldern so hoch ist, dass die EU sogar schon derartige Treibstoffe begrenzt hat, was von der Industrie natürlich
heftig bekämpft
wird.
Eine
Industrie-Marktanalyse
kommt daher zu dem Schluss, dass schon für die Erfüllung der in den USA und Europa beschlossenen Beimischungsquoten 2030 Bio-Rohstoffe auf der ganzen Welt zusammengekauft werden müssen und die Versorgung darüber hinaus extrem unsicher ist. ICAO unterscheidet in der Trendanalyse einen "illustrativen Fall" der SAF-Nutzung, in dem sich die Emissionen von CO2 bis 2050 "nur" etwa verdoppeln würden, und eine "100%-Nutzung" von SAF und sagt auch (wenn auch nur in einer
Bildunterschrift),
was dafür nötig wäre:
Wie wenig die Luftfahrtindustrie an Klimaschutzmaßnahmen interessiert ist, wenn sie keine Kosten sparen helfen, zeigt sich auch daran, dass der schon lange mögliche, relativ preiswerte und im Strassenverkehr und selbst in der Schifffahrt schon lange übliche Einsatz sog. 'hydrobehandelter Treibstoffe', manchmal auch 'Advanced' oder 'Alternative Fuels' genannt, kaum genutzt wird. Dabei handelt es sich im Fall des Luftverkehrs um fossiles Kerosin, das nachbehandelt wird, um den Gehalt an Schwefel und bestimmten Kohlenstoff-Verbindungen
(Aromaten
und
Naphthalin)
zu reduzieren. Die CO2-Emissionen ändern sich dadurch nicht, aber andere klima- und gesundheits-schädliche Emissionen (einschließlich ultrafeiner Partikel) werden zum Teil
deutlich gesenkt.
Der
volkswirtschaftliche Nutzen
durch die dadurch vermiedenen Schäden ist eindeutig positiv, aber der Treibstoff wird für die Fluggesellschaften geringfügig teurer. Daher wäre entsprechender Zwang, z.B. Genehmigungs-Auflagen, notwendig, um diese Vorteile zu nutzen.
Um das Fazit aus all dem kommt selbst die Tagesschau nicht herum:
Klimaneutrales Fliegen bleibt eine Illusion,
jedenfalls für die nächsten Jahrzehnte, und nicht nur wegen der
sonstigen Klimawirkungen
des Luftverkehrs. Die von der Luftfahrtindustrie angebotenen Lösungen wirken nicht, wie das
Kompensationssystem CORSIA,
kommen viel zu spät, wie die eFuels, oder richten mehr Schaden als Nutzen an, wie die Biofuels.
Entwickelt sich der Luftverkehr
weiter wie bisher,
wird er wesentlich zur Beschleunigung und Verschlimmerung der Klimakatastrophe beitragen. Soll diese eingedämmt werden, muss er sich will alle anderen Sektoren an die gegebenen planetaren Grenzen
anpassen.
Die Wahl zwischen diesen beiden Wegen ist in der Tat eine der wesentlichen politischen Fragen für die Zukunft der gesamten Menschheit, und die Antwort wird in den nächsten Jahren gegeben werden. Klimaschutz und
Klimagerechtigkeit
wird es ohne einen schrumpfenden Luftverkehr nicht geben können.
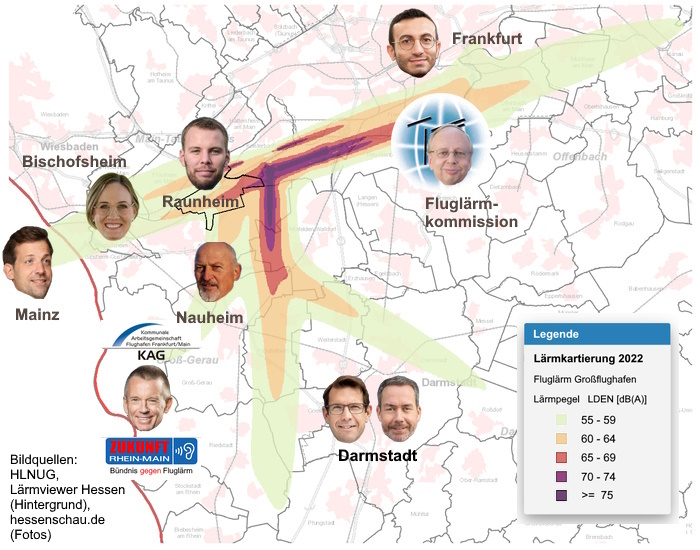
30.03.2023
Seit Beginn des Jahres hat sich einiges getan, was für den kommunalen Widerstand gegen den wieder wachsenden Fluglärm rund um den Frankfurter Flughafen von Bedeutung sein kann. Verantwortliche in Kommunen und Gremien wurden neu gewählt, und einige Strukturen verändern sich.
An erster Stelle steht für uns natürlich die Wahl des Bürgermeisters in Raunheim, die David Rendel etwas überraschend bereits im ersten Wahlgang überzeugend
mit 55 Prozent
der Stimmen gewonnen hat. Am 01.April tritt er sein Amt an.
Wir gratulieren und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. Schließlich hat David Rendel im Wahlkampf deutlich gemacht, dass er das Thema Fluglärm ernst nimmt, u.a. mit einem
Beitrag
auf seiner Webseite und in einem
Zeitungsbeitrag.
Auch in etlichen anderen Städten der Region, die stark vom Fluglärm betroffen sind, wurden oder werden neue (Ober-)Bürgermeister*innen gewählt. Ob bei den Wahlentscheidungen das Thema Fluglärm eine Rolle gespielt hat, wissen wir natürlich nicht. Auch ob die Gewählten das Thema anders angehen werden als ihre Vorgänger, und falls ja, wie, wird sich erst zeigen müssen. Wir haben im Folgenden jeweils ein paar Indizien gesammelt.
In Frankfurt hat der SPD-Kandidat Josef die Stichwahl am 26.03. sehr knapp gegen den CDU-Kandidaten Becker
gewonnen.
Frankfurt hat u.a. deshalb besonderes Gewicht in Fluglärmfragen, weil die Stadt Anteilseignerin der Fraport ist, mit zwei Personen im Aufsichtsrat sitzt und die Geschäftspolitik mitbestimmen kann (theoretisch zumindest). Die Frankfurter BIs freuen sich, dass der neue OB Kernforderungen wie ein echtes Nachtflugverbot von 22-6 Uhr und die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene
unterstützt
und dass Strukturen wie die
Stabsstelle für Fluglärmschutz
weiter arbeiten können und u.a. Daten über Lärm und Flugbewegungen liefern.
Man kann wohl davon ausgehen, dass die
Politik seines Vorgängers
im Bereich Flughafen im Wesentlichen fortgesetzt werden wird. Weder die 'Kommunalpolitischen Leitlinien' der Frankfurter SPD zum
Thema Flughafen,
die Josef als SPD-Vorsitzender vertritt, noch der
Frankfurter Koalitionsvertrag (Thema: "Flughafen": S.160-163),
den er als "sein Programm" bezeichnet, lassen jedenfalls konkrete Veränderungsabsichten erkennen.
In Mainz hat der Unabhängige Nino Haase, der bei der vorhergehenden Wahl noch für die CDU kandidiert hat, die jahrzehntelange SPD-Dominanz beendet und die Stichwahl am 05.März mit 63% gegen den Kandidaten der Grünen
gewonnen.
Auf seiner
Wahlkampf-Webseite
findet sich nichts zum Fluglärm unter den
Highlights,
aber weiter hinten im
Programm
verspricht er, für
"Leisere Anflugverfahren und Nachtflugverbot"
zu sorgen. Eine Mainzer BI hatte vor der Wahl alle Kandidat*innen
befragt
und auch vom späteren Gewinner eine
Antwort
bekommen. Die in aller Regel Flughafen-kritische Mainzer Internetzeitung Mainz& hat ein
längeres Portrait
des neuen OB veröffentlicht.
In der Fluglärmkommission wird Mainz wohl auch weiterhin durch die zuständige Dezernentin Steinkrüger vertreten, die dort dem Vorstand angehört. Mainz ist ebenso wie Raunheim hauptsächlich von Betriebsrichtung 07 am Flughafen betroffen, daher gibt es objektiv gemeinsame Interessen. Inwieweit das wirksam wird, muss man sehen.
Etwas näher dran, in Nauheim, hat auch ein Unabhängiger, Roland Kappes, die Stichwahl am 19.03. mit knapp 63% gegen die SPD-Kandidatin
gewonnen.
Er löst den CDU-Bürgermeister Fischer ab, der seit 2018 Vize-Vorsitzender der Fluglärmkommission war.
Nauheim ist hauptsächlich durch die Südumfliegung belastet und war ein wesentlicher Akteur im
juristischen Streit
um diese Route. Nach deren endgültiger juristischer Bestätigung sind die Aktivitäten dort deutlich zurückgegangen.
Auch in Bischofsheim wurde ein CDU-Bürgermeister abgelöst, dort durch die SPD-Kandidatin Lisa Gößwein, die die Stichwahl am 26.März mit 50,5% der Stimmen
gewonnen hat.
In ihren
Positionen
zum Wahlkampf kam das Thema Flughafen nicht vor, aber das war bei ihrem Konkurrenten auch nicht anders. Immerhin hat sie mit Landrat Thomas Will einen Experten zum Thema in ihrem SPD-Ortsvorstand. Da Bischofsheim ebenso wie Raunheim hauptsächlich von Betriebsrichtung 07 am Flughafen betroffen ist (wenn auch weniger stark), wäre eine Unterstützung von dort sehr erfreulich.
In Darmstadt tritt am 02.April der SPD-Kandidat Benz in der
Stichwahl
gegen den Grünen Kolmer an, der aktuell gerade als zuständiger Darmstädter Dezernent in den Vorstand der Fluglärmkommission gewählt wurde.
Der Fluglärm spielt im Darmstädter Wahlkampf ebenfalls keine Rolle, bei beiden Kandidaten ist kein Wort darüber zu finden. Direkt betroffen sind in Darmstadt auch nur die nördlichsten Stadtteile, der überwiegende Teil des Stadtgebiets bekommt davon nichts mit.
In der Fluglärmkommission wird sich zunächst so oder so nichts ändern, da der OB die Zuständigkeiten der Dezernent*innen nicht beliebig ändern kann.
Im Laufe des Jahres wird u.a. auch in Rüsselsheim (am 02.07., Stichwahl am 16.07.) und in Offenbach (am 17.09., Stichwahl am 08.10.) die/der Oberbürgermeister*in neu gewählt. Auch dort können sich also noch personelle Veränderungen ergeben.
Die
Fluglärmkommission
hat in ihrer
Sitzung am 22.02.
turnusgemäß ihren Vorstand neu gewählt. Nachfolger von Thomas Jühe als Vorsitzender wurde der Offenbacher Stadtrat
Paul-Gerhard Weiß,
neuer stellvertretender Vorsitzender der Kelsterbacher Bürgermeister Manfred Ockel. Die FLK schreibt zu der Neuwahl auch weiterer Mitglieder:
"Der Vorstand deckt damit wieder das relevante Spektrum der regionalen Fluglärmbetroffenheit ab. Alle Betriebsrichtungen mit ihren jeweiligen An- und Abflugrouten sind personell im Vorstand abgebildet."
In dieser Sichtweise ist die besondere Raunheimer Betroffenheit durch Anflüge auf die Südbahn bei Betriebsrichtung 07 dann wohl durch Frau Steinkrüger aus Mainz abgedeckt.
Am 22.03 hat das hessische Verkehrsministerium
mitgeteilt,
dass es einen
Entwurf für ein FLK-Gesetz
im Landtag eingebracht hat. Eine Erläuterung dazu wurde bereits in der Sitzung der FLK am 22.02.
präsentiert.
Die SPD-Fraktion im Landtag
kritisiert,
dass
"nicht alle Anregungen der Fluglärmkommission für dieses Gesetz aufgenommen"
wurden, die Linksfraktion
hält es für überflüssig,
"dass die Finanzierung und die Anstellung der Geschäftsführung über einen Trägerverein laufen soll, dessen Vorsitzende dann auch noch die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) ist". Der Gesetzentwurf muss noch das übliche parlamentarische Verfahren durchlaufen, ehe er in Kraft tritt.
Der Vollständigkeit halber sei noch die Entwicklung der beiden Zusammenschlüsse 'Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt am Main'
KAG
und 'Initiative Zukunft Rhein-Main'
ZRM
erwähnt. Beide haben in den letzten Jahren relativ wenig Aktivität gezeigt, sollen aber reaktiviert werden. In einer
KAG-Pressemitteilung
anlässlich der Neuwahl des Vorstandes heisst es:
"Landrat Thomas Will ... freut sich darauf, ab Herbst [2022] erneut den Staffelstab zu übernehmen. Als KAG-Vorstandsvorsitzender und gleichzeitig Sprecher der Initiative „Zukunft Rhein-Main“ (ZRM) strebt er eine stärkere Zusammenarbeit mit der ZRM in einem neu zu gründenden Arbeitskreis an, um den flugverkehrsrelevanten Themen, die die Region bewegen, mehr Nachdruck und den Gremien eine stärkere Wirkung zu verleihen".
Eine
gemeinsame Veranstaltung
ist bereits geplant.
Die Mitglieder beider Zusammenschlüsse sind zwar zu einem grossen Teil, aber nicht vollständig identisch, und auch die Grundlagen sind verschieden. Die KAG ist eine kommunale Arbeitsgemeinschaft auf Grundlage eines entsprechenden Gesetzes, in der nur Städte, Gemeinden und Landkreise Mitglied werden können. Die ZRM ist eine Initiative, in der neben Städten, Gemeinden und Landkreisen auch die BUND-Landesverbände Hessen und Rheinland-Pfalz und das BBI Mitglied sind. Auch die Zielsetzungen sind unterschiedlich formuliert, so dass ein einfacher Zusammenschluss nicht möglich ist.
Raunheim ist Mitglied in der KAG, aber aufgrund früherer Differenzen nicht in der ZRM. Es wäre an der Zeit, diesen Zustand zu ändern und die Raunheimer Interessen in beiden Zusammenschlüssen zur Geltung zu bringen.
Über alledem sollte man aber nicht vergessen: wer auch immer in den Gremien sitzt und in welchen Strukturen auch gearbeitet wird: politischer Druck und daraus resultierende Veränderungen wird es nur dann geben, wenn die Betroffenen an der Basis deutlich machen, dass ihnen das Thema wichtig ist, und nachdrücklich Verbesserungen einfordern.

Das ist sicher noch nicht das endgültige Logo
25.03.2023
Am 24.03. hat das UNH eine Pressemitteilung verschickt und darin mitgeteilt, dass erstens der erste Teil der UFP-Studie am 01.April startet und zweitens die Webseite zum Projekt https://www.ultrafeinstaub-studie.de/ online ist. Unser Logo-Vorschlag wurde nicht berücksichtigt, aber ansonsten ist das eine gute Nachricht.
Die Pressemitteilung gibt einen kurzen Überblick über die Ziele der Studie, bisher geleistete Arbeiten und die geplanten weiteren Abläufe. Besonders interessant ist ein Zitat des stellvertretenden Studienleiters, Prof. Alexander Vogel von der Goethe-Universität Frankfurt:
"Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeiten liegt auf der Klärung der Frage, wie groß der Einfluss von startenden und landenden Flugzeugen und Überflügen für die UFP-Belastung am Boden ist".
Sollte das so umgesetzt werden, könnte endlich das
lang gehegte Dogma,
wonach die UFP-Emissionen fast nur vom Flughafengelände ausgehen, zu den Akten gelegt werden.
Die Webseite wirkt auf den ersten Blick tatsächlich sehr aktuell und vollständig, selbst das
Transparenzpapier
ist brandneu (Stand 24.03.2023) und enthält den aktuellen "Stand der Studienerarbeitung". Etwas gewöhnungsbedürftig ist es, dass die neueste PDF-Version nur im Abschnitt "Transparenz", aber nicht im Download-Bereich verfügbar ist. Dort finden sich, wie zu allen anderen Themen offenbar auch, nur die veralteten Versionen (wäre da "Archiv" nicht ein besserer Titel für diesen Bereich?).
Zur
Belastungsstudie
gibt es eine Beschreibung der Ziele, die erreicht, sowie der Arbeitspakete, die dazu abgearbeitet werden sollen. Details dazu, was jeweils wo und wie gemessen oder modelliert wird, darf man hier natürlich (noch) nicht erwarten. Das Ganze ist hinterlegt mit einem
Zeitplan,
der einen Zeitraum von 36 bis maximal 42 Monaten abdeckt, also bis zum 31.03. bzw. 30.09.2026.
Entsprechend dem Bearbeitungsstand gibt es zur
Wirkungsstudie
natürlich wesentlich weniger Material. Neben einer kurzen Beschreibung der Ziele, die wohl als vorläufig zu verstehen ist, ist der Inhalt der
Designstudie dargestellt, also der Vorstudie, die ein Konzept für die Struktur der tatsächlichen Studie entwickeln soll. Der entsprechende
Zeitplan umfasst daher auch nur 10 Monate (01.-10.2023).
Die "häufig gestellten Fragen"
(FAQs)
sind gegenüber der Version, die im Februar an die BIs versandt wurde und für uns
Anlass zu Kritik
gab, deutlich überarbeitet worden und anscheinend ebenfalls auf dem aktuellen Stand. Das wäre sicher auch ohne unser Gemecker passiert, aber wir freuen uns, dass einiges davon offensichtlich nicht ganz falsch war.
In einem wichtigen Punkt gibt es allerdings eine Diskrepanz, die hoffentlich bald geklärt wird. Die Antwort auf die nun wirklich häufig gestellte Frage:
"Werden die UFP-Emissionen von Überflügen in der Belastungsstudie berücksichtigt und wenn ja, wie?"
verweist auf eine
"Anforderung an die Modellierung ..., „die Fahnenabsenkung durch Wirbelschleppen zu untersuchen, um zu klären, welchen Einfluss startende oder landende Flugzeuge auf die bodennahen UFP-Konzentrationen haben“."
Diese Anforderung ist im Arbeitspaket 3.3, auf das verwiesen wird, nicht zu finden, und auch in keinem anderen. Man kann nur hoffen, dass das daran liegt, dass die Inhalte der Arbeitspakete alle nur sehr knapp zusammengefasst dargestellt werden und dieser konkrete Modellierungsaspekt in den Modellierungsaufgaben trotzdem enthalten ist, z.B. im AP 2.7. Mit dem DLR-IPA sind zumindest die wichtigsten Wirbelschleppen-Modellierer hierzulande im Konsortium vertreten.
Zeitgleich mit der Pressemitteilung hat das UNH auch eine
"Dokumentation Gesprächsaustausch zu UFP 22. Februar 2023"
an die BI-Vertreter*innen verschickt, die zum letzten "Austauschgespräch" geladen waren. Die stellt uns wieder vor ein bekanntes Problem. In der Dokumentation ist die in
unserem letzten Beitrag
breit diskutierte Vorbemerkung des Moderators wie folgt wiedergegeben:
"Einleitend werden noch einmal die Voraussetzungen aus Sicht des FFR dargelegt, um für alle Teilnehmenden eine positive und respektvolle Umgebung zu schaffen:",
danach folgen fünf Spiegelstriche, darunter
"- Keine Veröffentlichung von Unterlagen vor deren inhaltlichen Diskussion"
(Grammatik-Fehler im Original).
Zweifelsohne ist die Dokumentation eine Unterlage, die bisher nicht von den Teilnehmenden diskutiert worden ist, und sollte daher "aus Sicht des FFR" nicht veröffentlicht werden. Auch wird es vor "Ende Sommer/Anfang Herbst", wenn das nächste Treffen stattfinden soll, keine Möglichkeit dazu geben. Andererseits sind ja die von BI-Seite Teilnehmenden nicht als Individuen eingeladen worden, sondern eben als Vertreter*innen ihrer BIs, und sollten diese daher über die Ergebnisse informieren. Wie verteilt man Unterlagen an Bürger*innen, ohne sie zu "veröffentlichen"?
Wir haben bereits im letzten Beitrag dargelegt, was wir von dieser "Sicht des FFR" halten, deswegen kann jede/r, die/der diesen Text liest, auch die Dokumentation
hier
nachlesen. Darin sind noch weitere Unterlagen verlinkt, die allerdings während des Treffens präsentiert wurden und damit vielleicht als diskutiert gelten können (Achtung: sie stehen nur bis zum 30.04. zur Verfügung).
Sollte dem FFR nach diesem erneuten Verstoss gegen ihre "Voraussetzungen" ein Treffen bei unserer Teilnahme nicht mehr kuschelig genug sein, wird sich dafür sicher eine Lösung finden.
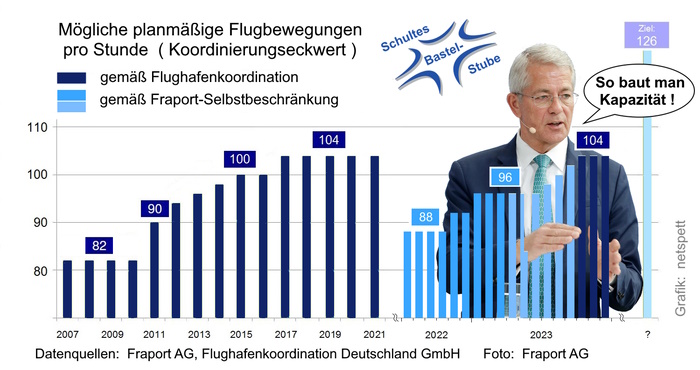
Der Koordinierungseckwert gibt nur an, was potentiell machbar ist. Wieviel Flugbewegungen (Starts und Landungen) tatsächlich stattfinden, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab.
17.03.2023
Fraport war in den letzten Wochen mit einigen Neuigkeiten in der Presse, und wie üblich darf man das meiste davon nicht allzu ernst nehmen, wie z.B. die Pöbeleien gegen ein echtes Nachtflugverbot und ein Verbot von Kurzstreckenflügen im
Frankfurter Oberbürgermeister-Wahlkampf
oder gegen Steuern, Gebühren und Abgaben anlässlich der
ADV-Frühjahrstagung.
Einen Punkt, der tatsächlich eine gewisse Bedeutung hat, wollen wir hier näher betrachten:
die Aussagen über die Entwicklung der Flughafen-Kapazität in diesem Jahr und die dafür angeblich ausschlaggebenden Gründe.
Angaben zu den geplanten Kapazitäten findet man nicht im
Fraport-Newsroom,
der auf positive Berichterstattung fixiert ist. Selbst im 'Ausblick' der gerade erst veröffentlichten
Pressemitteilung
und in der
Präsentation
zum
Geschäftsbericht 2022
steht dazu nichts.
Laut Presseberichten hat Fraport-Chef Schulte in der zugehörigen Pressekonferenz die Kürzungen als
Qualitätsoffensive
verkauft und dabei auch versucht, die Personalsituation schönzureden, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen.
Wer es genauer wissen will, muss sich die Zahlen auf den jeweiligen Fachseiten zusammensuchen, auch in der Fachpresse waren sie nur teilweise zu finden. Interessant ist das deshalb, weil Fraport noch mit den Nachwehen der Corona-Pandemie zu kämpfen hat (leicht ironisch auch als spezielle Form von Long Covid bezeichnet) und die Planung deshalb anders läuft als üblich.
Normalerweise werden auf nach EU-Regeln
koordinierten Flughäfen
(zu denen in Deutschland FRA und sechs weitere gehören) für jede Flugplanperiode eine maximale Anzahl sog. "Zeitnischen" (Slots) pro Stunde (ggf. unterschiedlich für verschiedene Tageszeiten) vom dafür national zuständigen "Flughafenkoordinator" (FluKo) festgesetzt und damit die maximal pro Stunde mögliche Anzahl von Flugbewegungen bestimmt. In Deutschland ist dafür die
Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH
zuständig.
Deren Festsetzung für FRA ist
seit 2017
unverändert: pro Stunde sind maximal 104 geplante Flugbewegungen möglich, plus 2 "ad hoc" eingeschobene Flüge, wenn nötig. Diese Festlegung wurde zunächst auch für den
Sommer 2023
getroffen.
Sie kommt allerdings nicht zum Tragen, da Fraport wie schon für den
Sommer 2022
und den
Winter 2022/23
auch für den
Sommer 2023
eine "temporäre Reduzierung" der Eckwerte auf Basis einer anlässlich der Pandemie eingeführten Leitlinie beantragt hat.
Demnach bleibt der sog. Koordinierungseckwert, der 2022 von 88 auf 96 Flugbewegungen pro Stunde gesteigert wurde, noch bis einschliesslich Juni bestehen. Ende Mai, wenn die Nordwestbahn für Instandsetzungsarbeiten vom 16.-31.05. geschlossen wird, wird er sogar auf 84 abgesenkt. Von Juli bis Oktober soll er dann in 2er-Schritten wieder auf 104+2 gesteigert werden.
Grund dafür seien
"- ausgelöst v.a. durch wetterbedingte Einflüsse - erneut sehr herausfordernde operative Tage"
im Winterflugplan, deren Analyse zu dem Schluss geführt habe,
"dass die kurzfristige Rückkehr zu den Eckwerten 104+2 in der aktuellen Situation noch zu ambitioniert"
sei. Das soll wohl auf den 10tägigen Mini-Winter im letzten Dezember anspielen, in dem der Betrieb auf FRA
deutlich hörbar
aus dem Ruder gelaufen ist und zahlreiche unzulässige Nachtflüge durchgeführt wurden.
Auch im kommenden Sommer wäre
"noch mit erheblichen operativen Auswirkungen zu rechnen, insbesondere sobald zusätzliche Einflüsse auf das Gesamtsystem des Flughafen Frankfurt einwirken",
wie etwa Regen, Wind oder gar
Gewitter.
Da bremst man doch lieber etwas, bis
"das Gesamtsystem und die Ressourcen aller Prozess- und Systempartner diese Belastung wieder abbilden können".
Dieser letzte Satz ist in all dem Fraport-Geschreibsel der einzige schüchterne Hinweis darauf, dass die Probleme ganz überwiegend darauf zurückzuführen sind, dass die Hauptakteure am Frankfurter Flughafen, Fraport und Lufthansa, die Pandemie auf asozialste Weise
zur Profitmaximierung
genutzt haben. Der völlig überzogene Personalabbau, der insbesondere ältere, tariflich besser gestellte Arbeitsverhältnisse beseitigen und die Belegschaften insgesamt billiger, flexibler und unterwürfiger machen sollte, hat nun zu der allseits bejammerten Personalknappheit geführt, die beide daran hindert, die Möglichkeiten der aktuell vorhandenen Nachfrage auszuschöpfen.
Für Fraport stellt sich das so dar: gemäß
Geschäftsbericht 2019
beschäftigte der Fraport-Konzern in Deutschland 19.294 Personen. Im Bereich 'Aviation' waren 6.380 Personen tätig, im 'Ground Handling' 9.073. Im
Geschäftsbericht 2022
lauten die entsprechenden Zahlen 15.691, 5.569 und 7.035. Die Zunahmen gegenüber 2021 betrugen 92, 93 und 98 Personen. Grob zusammengefasst heisst das, dass Fraport in Deutschland 2022 rund 3.500 Personen weniger beschäftigt hat als 2019; in den betriebs-kritischen Bereichen 'Aviation' und 'Ground Handling' waren es konzernweit 800 bzw. fast 2.000 weniger. Trotz angeblich "intensiver Werbung" waren 2022 in den kritischen Bereichen jeweils weniger als 100 Personen mehr beschäftigt als 2021.
Fraport malt das Bild anders. In der Fachpresse wird Fraport-Finanzchef Zieschang
zitiert
mit den Angaben, dass 2022
"rund 4.000 Mitarbeiter weniger an Bord waren als 2019",
aber Fraport Ende 2023
"immer noch mit einer im Vergleich zu 2019 um mindestens 3.000 Leute verringerten Mannschaft zurechtkommen"
wolle. Gleichzeitig soll aber bei den Bodenverkehrsdiensten ('Ground Handling')
"im August ... wieder so viel Personal einsatzbereit sein ... wie vor der Krise",
also fast 2.000 Personen mehr.
Lokalzeitungen befassen sich mit solchen Details garnicht und erwähnen nur, dass Fraport
"rund 1500 Personen für die Bodenabfertigung ... in diesem Jahr neu einstellen"
will, im Vergleich zu
"rund 4000 Stellen, die während der Corona-Krise gestrichen wurden",
in
einem Fall
mit dem wohl auch in der Fraport-Pressekonferenz geäusserten Zusatz
"vor allem im administrativen Bereich".
Wie das mit den Zahlen aus den Geschäftsberichten zusammen passen soll, wird nicht erklärt, und wie aus den knapp 100 Personen mehr im letzten Jahr in einem
"leergefegten Arbeitsmarkt"
nun weit über 1.000 werden sollen, auch nicht.
Die Lufthansa tut in diesem Spiel nach aussen so, als würde sie ihrem Partner Fraport, mit dem sie gerade ein operatives Joint Venture gegründet hat, bei der Bewältigung der Schwierigkeiten großzügig entgegenkommen, hat aber selbst jede Menge Probleme sowohl mit ihren Piloten als auch im Technik-Bereich. Sie kann das aber relativ entspannt durchstehen, denn auch die personell besser aufgestellte Konkurrenz kann ihr wegen fehlender Flugzeuge kaum Marktanteile abnehmen. Und da die Zuwächse im Verkehr aktuell fast ausschließlich auf Privatreisen zurückzuführen sind, ist auch die auch jetzt wieder hervorgeholte Warnung vor "Abwanderung von Flügen ins europäische Ausland" völlig absurd.
Als Fazit bleibt: es gelingt Fraport mit freundlicher Medienunterstützung relativ gut, ihr eklatantes Management-Versagen während der Pandemie vergessen zu machen. Überzogener Personalabbau und daraus folgend miserabler Service und Leistungserbringung weit unter Nachfrageniveau wären normalerweise ein Grund, den gesamten Vorstand zu feuern. Dass das nicht passiert, hat vor allem zwei Gründe: der Hauptkunde Lufthansa hat genau die gleichen Probleme, und die Endkunden nehmen alles in Kauf, zahlen sogar noch höhere Preise und sorgen damit bei beiden für schnell steigende Gewinne.
Damit erfüllen die Vorstände von Fraport und Lufthansa ihre Hauptaufgabe: die Anteilseigner werden zufriedengestellt, alles andere ist zweitrangig. Dabei muss Fraport, überwiegend in öffentlicher Hand, nicht einmal
Dividende zahlen,
es genügt, dass die wirtschaftlichen Aussichten "positiv sind" und
"die eigene Prognose und die Schätzung vieler Analysten"
übertroffen wurden.
Perversion am Rande: einen wesentlichen Beitrag zum positiven Fraport-Ergebnis im letzten Jahr lieferten wieder die griechischen Flughäfen, die Fraport vor fünf Jahren einem
unter EU-Zwangsverwaltung
stehenden griechischen Staat
praktisch gestohlen
hat und für die sie während der Pandemie auch noch
griechische Subventionen
kassiert haben. Die
"stark touristisch geprägten Airports ... begrüßten 2022 rund vier Prozent mehr Fluggäste als 2019 – ein neues Allzeithoch".
Und in diesem Jahr soll es noch mehr Urlaubsreisen geben - in ein Land, dessen
Infrastruktur ruiniert
ist und dessen Tourismussektor derart prekäre Arbeitsverhältnisse anbietet, dass dort trotz hoher Arbeitslosigkeit im Land Arbeitskräfte aus
"Afghanistan, Pakistan, Syrien und Ägypten"
angeworben werden
müssen.
Und weil das alles so schön läuft, möchte Fraport auch bei den neuen Privatisierungsrunden in Griechenland dabei sein und bietet schon mal
für den Flughafen Kalamata
mit, und, wenn es soweit ist, wahrscheinlich auch
"für alle übrigen (22) Airports in einer Ausschreibung".
Die Anwohner des Flughafens dürfen im kommenden Sommer den Lärm erdulden in der Gewissheit, dass es in den nächsten Jahren nur schlimmer werden kann. Fraport und Lufthansa werden sich nicht auf Dauer selbst im Weg stehen, und von einer Politik, die den Klimaschutz insgesamt auf die lange Bank geschoben hat, ist keinerlei Intervention zu erwarten. Auch freiwillige Selbstbeschränkungen der Luftverkehrsindustrie oder der Reisewütigen wird es nicht geben. Und breiter Widerstand, der den Wahn bremsen könnte, ist nicht in Sicht.

Unser Vorschlag, ganz ohne böse Hintergedanken: Ausser der Partikelwolke stammen alle Grafik-Elemente und Texte, auch die grünfärbende Lupe, von den Webseiten des FFR bzw. des UNH. Nur die Anordnung ist etwas angepasst.
02.03.2023
Die wichtigste Botschaft des zwei Wochen vorher angekündigten Treffens im Umwelthaus am 22.02. war die Erklärung von seiten des UNH, dass der Zuschlag für den ersten Teil des UFP-Projekts, die Belastungsstudie, erteilt wurde und das Projekt formal zum 01.04. starten wird.
Einige Inhalte und Rahmenbedingungen wurden in einer Powerpoint-Präsentation vorgestellt, aber da die weder verteilt noch versandt wurde, können wir hier nur das wiedergeben, was wir (hoffentlich korrekt) speichern konnten.
Das Konsortium, das das Projekt durchführen wird, steht unter der Leitung von
TROPOS,
dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, und ist sehr breit aufgestellt. Gefühlt gehört alles, was hierzulande in diesem Gebiet Rang und Namen hat, dem Konsortium an. Das bestärkt die Hoffnung, dass alle Themen, die in diesem Projekt behandelt werden können, tatsächlich auch kreativ und auf hohem Niveau abgearbeitet werden.
Was sich in den Projektinhalten an Konkretisierungen, Nuancierungen und vielleicht auch Verschiebungen im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung
ergeben hat, wird sich erst genau beurteilen lassen, wenn das Arbeitsprogramm des Konsortiums schriftlich vorliegt.
Aktuell besteht durchaus die Hoffnung, dass es noch einige Verbesserungen gegeben hat.
Die Vorstellung der Arbeiten zur Wirkungsstudie hinterliess den Eindruck, dass hier noch wesentlich mehr offen ist, als es aufgrund der
Leistungsbeschreibung
für das Design der Wirkungsstudie zunächst schien. Es wird noch Workshops geben, in denen offene Fragen zur Konzeption der Studie diskutiert werden können.
Hier ist als Kuriosum zu erwähnen, dass das UNH sich zwei Personen ausgesucht hat, die als Vertreter*innen der BIs zu einem dieser Workshops eingeladen werden sollen. Dazu gab es in dem Treffen keinen Widerspruch.
Kurios daran ist einerseits, dass das UNH darüber entscheidet, wer die Bürgerinitiativen in solchen Workshops vertreten soll. Andererseits ist es aber auch so, dass es nur eine kleine Zahl von Personen gibt, die die BIs in solchen Workshops inhaltlich vertreten können, und zumindest eine der beiden Personen sich durch inhaltliche Vorarbeiten zu diesem Thema in einer Weise qualifiziert hat, dass diese Wahl ohne jeden Zweifel gerechtfertigt ist.
Man kann dieses Vorgehen natürlich auch akzeptieren, wenn man die Position vertritt, dass es völlig egal ist, wer an diesen Workshops teilnimmt, weil es am Ergebnis ohnehin nichts ändern wird.
Ein weiteres Kuriosum betrifft eine Diskussion mit scheinbar verkehrten Fronten. In den UNH-Präsentationen wurde betont, dass die Ergebnisse, die in dem Projekt erarbeitet werden, so schnell wie möglich auch veröffentlicht werden sollen, und bevorzugt auch in frei zugänglichen
Open Access-Medien.
Einige BI-Vertreter waren dem gegenüber der Meinung, dass höchste Qualität und Wirksamkeit der Ergebnisse nur erzielt werden kann, wenn sie im Elfenbeinturm der Wissenschaft verbleiben und nur nach einem
Peer Review-Prozess hinter einer Bezahlschranke verfügbar sind.
Angesichts der Tatsache, dass einerseits 'Open Access' 'Peer Review' keinesfalls ausschliesst, von allen grossen deutschen Wissenschaftsorganisationen
unterstützt und weiterentwickelt
wird und in der Schweiz inzwischen sogar
Vorschrift ist,
andererseits Preise für wissenschaftliche Artikel exorbitant hoch sind und Zitierrechte für gekaufte Artikel trotzdem erheblichen Einschränkungen unterliegen, sind wir der Auffassung, dass eine solche Position dem Interesse der Bevölkerung an einer schnellen und umfassenden Information über vorhandene Belastungen und mögliche Risiken diametral widerspricht.
Das Nervigste zum Schluss: Der Moderator des Treffens begann mit einer Vorbemerkung, von der wir uns angesprochen fühlen, die wir aber wegen mangelnder Aufzeichnungsmöglichkeiten, Gedächtnis und Verständnis nur grob wiedergeben können. Demnach gehe es nicht an, dass Personen namentlich mit Beiträgen aus Sitzungen in diesem Format zitiert werden, explizit wurde die
Chatham House Regel
erwähnt. Ausserdem gehe es auch nicht an, Papiere zu veröffentlichen, die noch nicht diskutiert worden seien. Darüber hinaus wurde ein "respektvoller Umgang" zwischen den Teilnehmer*innen angemahnt.
Wir fühlen uns angesprochen, weil wir im
Bericht
vom letzten Treffen drei agierende Personen namentlich genannt haben und in der
Vorbereitung
des jetzigen Treffens die vom UNH verschickte Diskussionsgrundlage veröffentlicht und kritisch gewürdigt haben. Es ist uns nicht bekannt, dass andere ähnliche Vergehen begangen hätten, daher beziehen wir die Vorwürfe auf uns.
Wir haben dazu folgendes zu sagen:
"Respektvoller Umgang" gehört zu den Dingen, die im Allgemeinen selbstverständlich sein sollten, aber im Detail doch schwierig zu bestimmen und zu erkennen sind. Natürlich gehört dazu, Personen nicht zu beschimpfen und nicht blosszustellen, aber wie scharf darf Kritik sein, ohne ungehörig zu werden? Das hängt sicher auch davon ab, wen die Kritik trifft. Wer immer wieder gerne und kräftig austeilt, muss sich nicht wundern, wenn das Echo auch mal etwas lauter ausfällt.
Im konkreten Fall haben wir unsere Texte nochmal kritisch durchgesehen und finden nichts zurückzunehmen. Wer das anders sieht, sollte konkrete Punkte benennen. Sollte es sich hier allerdings nur um eine Breitseite handeln, die generell Kritik diffamieren und einschüchtern möchte, können wir nur sagen: tut uns leid, funktioniert nicht.
Auf der anderen Seite gehört zu respektvollem Umgang auch, Beiträge von eingeladenen Diskussionspartnern auch tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und darauf einzugehen. Ebenso gehört dazu, bei einer Einladung zur Diskussion auch Materialien vorzulegen, die halbwegs aktuell und diskutierbar sind. Hier kann man durchaus gewisse Mängel erkennen.
Was den Charakter der Treffen angeht, sollte das UNH zunächst einmal erklären, was es eigentlich will. Bürgerinitiativen haben unterschiedlich Strukturen, sind aber in aller Regel keine geschlossenen Gesellschaften. Die BIFR z.B. hat keinerlei formale Struktur, Mitglied ist, wer sich selbst als solches erklärt. Wer derartige BIs über einen offenen Verteiler zum Gespräch einlädt, mit der Aussage, sie gelte
"aber ausdrücklich auch für alle weiteren Interessierten aus Bürgerinitiativen und kann gerne weitergeleitet werden",
der kündigt damit eine öffentliche Veranstaltung an. Und wer dazu ein Papier als Diskussionsgrundlage verschickt, das nach eigener Aussage für
"eine eigene Webseite für die UFP-Studie"
erstellt wurde, die demnächst veröffentlicht wird, aber
"bis zu unserer Veranstaltung noch nicht fertiggestellt ist",
kann nicht davon ausgehen, dass dieses Papier vertraulich behandelt wird.
Um was geht es also? Sollen diese Treffen die
Aufgabe
erfüllen,
"Bürgerinnen und Bürger ... über die Entwicklung des Frankfurter Flughafens und der Region zu informieren"
und
"die Kommunikation und Kooperation ... kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern",
oder sollen sie nur der
Strategischen Einbindung
der BIs in ein Projekt dienen, das die Gefährdung der Akzeptanz des Flughafens in der Region minimieren soll (oder ist das etwa dasselbe)? Wenn Letzteres der Fall ist und diese Treffen unter Regeln stattfinden sollen, die von elitären Zirkeln für politische Hinterzimmergespäche erfunden wurden, müssten wir unsere Teilnahme daran noch einmal überdenken.
Sollte das aber alles nicht so gemeint und diese Einleitung nur ein kurzes Aufjaulen gewesen sein, weil die Kritik einen Nerv getroffen hat, aber eine inhaltliche Erwiderung nicht parat war, können wir uns zufrieden zurücklehnen und weitermachen wie bisher.
Für das Bündnis der Bürgerinitiativen könnte diese Diskussion gerade anlässlich seines 25. Geburtstags ein Grund sein, nochmal darüber nachzudenken, was aus seiner Geschichte zu lernen wäre. Man kann unterschiedlicher Auffassung darüber sein, was von den früheren Positionen heute noch Gültigkeit haben sollte, aber eines ist sicher: blindes Vertrauen in die guten Absichten der Landesregierung und ihrer Institutionen hilft bestimmt nicht dabei, die Bündnis-Ziele durchzusetzen.
18.02.2023
Am 14. Februar gab es einen weiteren
weltweiten Aktionstag
zum Verbot von Privatjets. Wie schon bei den Aktionen
Ende letzten Jahres
und
anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels
reichten die Aktionsformen von demonstrativen Protesten bis zu
echten Blockaden.
Deutsche Flughäfen waren diesmal leider nicht dabei, obwohl Deutschland nach der Menge an Emissionen von Privatjets an
Platz 4
in Europa liegt (und die Münchner Unsicherheitskonferenz einen guten
weiteren Anlass
geboten hätte).
Auch waren die Auswirkungen bei weitem nicht so gross wie die der Aktionen
subversiver Baggerfahrer
oder
der Gewerkschaften,
aber sie rückten einmal mehr das Hauptproblem des Luftverkehrs in den Mittelpunkt: die immensen Klimaschäden, die der
Luxuskonsum Flugreisen
anrichtet.
Wie dringend dieses Problem ist, haben eine Reihe von Veröffentlichungen der letzten Wochen wieder einmal überdeutlich gemacht. Wir steuern auf ein
neues Rekordjahr
zu, in dem vermutlich die 1,5°C-Grenze des Pariser Klimaabkommens bereits temporär überschritten wird. Eine neuartige
Studie
sagt voraus, dass sowohl diese als auch die 2°C-Schwelle
sehr viel früher
als bisher angenommen auch dauerhaft überschritten werden wird, auch weil einige
Feedback Loops
bisher in ihrer Wirkung unterschätzt wurden. Aktuelle Forschungen in der Antarktis stellen fest, dass nun auch dort, wie schon seit Jahren in der Arktis,
das Meereis zurückgeht,
und neuere Daten zum Meeresspiegel-Anstieg sind
derart dramatisch,
dass sich sogar der
UN-Sicherheitsrat
damit befassen muss.
Studien, die die für den Kampf gegen die Klimakatastrophe relevanten
gesellschaftlichen Dynamiken untersuchen, kommen zu dem
Ergebnis,
dass
"eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius ... derzeit nicht plausibel"
ist, selbst wenn sie technisch noch möglich sein sollte. Hauptursache dafür ist, dass die großen Unternehmen ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht werden
und keine angemessenen Klimastrategien entwickeln. Andere Studien warnen vor einem
Doom Loop,
in dem die Staaten und Gesellschaften so damit beschäftigt sind, auftretende Klimaschäden zu bewältigen, dass sie keine Ressourcen mehr dafür aufbringen können, ihre Ursachen zu bekämpfen.
"Mangelnde gesellschaftliche Verantwortung" gilt insbesondere für die Luftverkehrswirtschaft, deren globale Dachorganisation ICAO es tatsächlich fertig bringt, ihr
längst gescheitertes
"Kompensationssystem" CORSIA
als Erfolg zu feiern,
weil es organisatorisch halbwegs funktioniert. Sein aktueller Beitrag zum Klimaschutz wird in folgendem Satz zusammengefasst:
"Der Sektor-Wachstumsfaktor 2021 wurde von ICAO als Null berechnet, so dass sich für die Akteure für 2021 keine Kompensationspflichten ergeben." (eigene Übersetzung)
Und es wird nicht besser: nach
unabhängigen Berechnungen
werden auch 2030 nur rund 22% der Emissionen des internationalen Flugverkehrs 'kompensiert' (mit
äusserst fragwürdigen
Ergebnissen).
Die Diskrepanz zwischen dem, was die Luftverkehrswirtschaft tatsächlich tut, was sie sich als Ziel gesetzt hat und
was zum Schutz des Klimas notwendig
wäre, ist inzwischen dermaßen gross, dass selbst in einem Kommentar in einem Luftfahrt-Fachblatt schon gefragt wird, ob die Fliegerei nicht Gefahr läuft, ihre
Soziale Lizenz
zu verlieren.
Das Verbot der Privatfliegerei könnte ein erster Schritt sein, die oben erwähnten 'gesellschaftlichen Dynamiken' in die richtige Richtung zu lenken. Wer genauer wissen möchte, was da verboten werden soll, kann sich auf YouTube eine Vielzahl von Berichten dazu ansehen. Wir haben wegen des Lokalbezugs mal zwei herausgesucht: einen
HR-Beitrag
über das
General Aviation Terminal
am Flughafen Frankfurt (bis etwa Minute 7:30) und einen längeren
ProSieben-Beitrag
über den
Flughafen Egelsbach,
der insgesamt für diese Art von Flugbetrieb ausgebaut wurde.
Es gibt sicher andere Beiträge, in denen die Dekadenz und/oder Ignoranz der Beteiligten noch drastischer dargestellt werden, aber wir finden es schon schlimm genug. Es wird jedenfalls deutlich, dass die Welt keinen Verlust erleidet, wenn es das nicht mehr gibt. Und auch die
Rechtfertigungen der intelligenteren unter den Privatfliegern (die offenbar
nicht besonders zahlreich
sind) klingen bei näherer Betrachtung ziemlich hohl.
Dass ein Verbot von Privatjets zu spürbaren Emissions-Senkungen führen würde, haben
Studien
schon vor Jahren gezeigt, und der Trend, sie zu nutzen, ist durch die Corona-Pandemie
noch verstärkt
worden. Die Hauptwirkung würde aber wohl von dem politischen Signal ausgehen, das u.a. auch darin bestünde, dass damit diejenigen zu Emissionsminderungen gezwungen werden, die das Klima
am stärksten schädigen.
Bislang ist die Klimapolitik auf allen Ebenen von sozialer Schieflage geprägt. Die reichen Industriestaaten verteilen nicht nur intern die Lasten der Krisen
extrem ungleich,
sie fordern auch von den Schwellen- und Entwicklungsländern Transformationsleistungen im Energiebereich, die sie selber
nie erbringen konnten
und auch heute nicht erbringen wollen. Krassestes Beispiel dafür ist die Weigerung der Bundesregierung, ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, weil dadurch die
Freiheit gefährdet
sei. Was sie damit wirklich verteidigt, ist die Freiheit der Autokonzerne, mit
Luxuskarossen Extraprofite
zu scheffeln.
Es ist aber höchste Zeit, nachhaltig deutlich zu machen, dass auch noch so viel Geld nicht das Recht kaufen kann, die Lebensgrundlagen der Menschheit zu zerstören. Es ist dringend nötig, endlich das, was Menschen schaffen, dafür einzusetzen, dass sie
sicher und zunehmend besser
leben können. Alles, was dem im Weg steht, muss beseitigt werden. Privatjets und die
perversen Versuche,
deren Geschäftsmodell noch weiter auszudehnen, wären ein guter Anfang.

Ob sowas auch in Frankfurt kommen wird? Die Grenzen dieser Technik werden hier schon deutlich: Der seitliche Abstand zur aktiven Anfluglinie beträgt (aus Sicherheitsgründen) rund 2 km. Damit lässt sich die Ausbreitung der UFP unter den Anfluglinien nur sehr begrenzt erfassen.
13.02.2023
"Am Mittwoch, den 22. Februar 2023 hat das Umwelt- und Nachbarschaftshaus (UNH) zu einem zweiten gemeinsamen Austausch zum Thema UFP in das UNH nach Kelsterbach eingeladen."
So beginnt die UNH-Mail, mit der einem ausgewählten Kreis von BI-Mitgliedern und -Vertreter*innen mitgeteilt wird, worüber bei diesem Treffen
gesprochen werden
soll. Die Mail erklärt auch, warum es seit März letzten Jahres keine Aktualisierung der Projekt-Webseite mehr gegeben hat: es soll
"in den nächsten Wochen – zum Start der UFP-Belastungsstudie - eine eigene Webseite für die UFP-Studie"
veröffentlicht werden. Dafür wurde
"u. a. eine „FAQ-Sammlung“ erstellt, die auch viele offene Punkte und kritische Fragen aufgreift, die ... in unserem letzten Treffen angesprochen worden sind".
Diese
Sammlung
soll dann auch eine Diskussionsgrundlage für das Treffen sein. Da es mehr zur Vorbereitung (bisher?) nicht gibt, muss man sehen, ob darin etwas Neues zu finden ist.
Betrachten wir zunächst die Struktur dieser Sammlung. Es gibt die folgenden hervorgehobenen Überschriften:
Zu den "Übergreifenden Fragen" zählt auch der Zeitplan für dieses Projekt. Dazu heisst es in den FAQs:
"Bis Ende 2022 ist geplant ..." ? Die FAQs mögen für eine neue Webseite gesammelt worden sein, aktuell sind sie deswegen aber offensichtlich nicht. Wenn, wie in der Einladungs-Mail angekündigt, der
"Start der UFP-Belastungsstudie ... in den nächsten Wochen"
erfolgen soll, dann muss der Zuschlag für die Vergabe ja wohl erteilt worden sein, aber wer die erfolgreichen Bieter sind und was genau sie angeboten haben, wird nicht mitgeteilt.
So geht es durch die ganze Fragensammlung. "Inhaltliche Fragen" werden mit Zitaten aus den bereits beim
letzten Treffen
verteilten Leistungsbeschreibungen in vager Form beantwortet. Details zu dem, was tatsächlich gemacht werden soll, fehlen nach wie vor. An unserer
Kritik
an den Aussagen ändert sich daher ebenso wenig.
Das gesamte Papier scheint auf dem Stand vom Sommer 2022 zu sein. Uns ist es lediglich gelungen, eine einzige Information neueren Datums darin zu finden: die Mitglieder der 'Wissenschaftlichen Qualitätssicherung' sind namentlich mit "Stand 1.1.2023" aufgelistet.
Einige kritische Anmerkungen zu dem, was im Papier steht bzw. nicht steht, haben wir trotzdem noch.
Man könnte noch weitere Details dieses Fragenkataloges diskutieren, aber sowohl Erkenntnisgewinn als auch Spaßfaktor wären dabei sehr begrenzt. Das Fazit bleibt dasselbe: dieses Papier ist hoffnungslos veraltet, inhaltlich oberflächlich und weitgehend ohne relevante Aussagen. Selbst die halbe Stunde, die beim Treffen für die Diskussion darüber vorgesehen ist, ist schon zu großzügig bemessen.
Bleibt die Frage, was von dem Treffen sonst zu erwarten ist. Es mag überraschend klingen, aber es wird seinen Zweck, zumindest für einige Beteiligte, wohl trotzdem erfüllen.
Wir werden mit dem vorliegenden Beitrag und ggf. einer Ergänzung nach dem Treffen die Gelegenheit gehabt haben, unsere Kritik an diesem Projekt einmal mehr einer wenn auch begrenzten Öffentlichkeit näher zu bringen. Das UNH wird im Projektplan im Bereich 'Öffentlichkeitsarbeit' ein weiteres Häkchen setzen können. Alle werden den Job gemacht haben, für den sie bezahlt werden bzw. sich engagieren wollen, und sich auf die nächste derartige Gelegenheit vorbereiten.
Dass die Sache, um die es eigentlich geht, dadurch um keinen Millimeter vorankommt, liegt an den gegebenen Strukturen, die sich so schnell nicht ändern werden. Man darf allerdings die Hoffnung nicht aufgeben, dass die beauftragten Wissenschaftler*innen ebenfalls ihren Job machen und trotz der schlechten Ausgangsbedingungen eine Reihe von neuen, nutzbaren Erkenntnissen produzieren werden - wenn auch erst in ein paar Jahren.

31.01.2023
Wie schon
Ende letzten Jahres,
gab es auch zum Jahresbeginn wieder einige Gipfel, von denen herab 'Entscheider' dem Rest der Menschheit mitteilten, wo es dieses Jahr langgehen soll. Mindestens zwei davon hatten auch oder hauptsächlich mit der Luftfahrt zu tun.
Ihre offiziellen Botschaften enthalten wenig bis nichts Neues, aber unter den präsentierten Aussagen und Materialien gibt es das eine oder andere Interessante.
Beim 53. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) stand die Luftfahrt nicht explizit auf der Tagesordnung. Das Familientreffen derjenigen, die seit Jahrzehnten wissen, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe das Klima ruiniert, deren Verbrauch aber aus Macht- und Profitgründen weiter massiv anheizen und über die Folgen weiter lügen, trug zur öffentlichen Diskussion über das Thema 'Fliegen' hauptsächlich bei durch eine Kritik von Greenpeace. Deren Studie kommt nämlich zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass sich während der WEF-Woche "die Zahl der Privatjetflüge verdoppelt" und "Privatjet-Emissionen vervierfachen", im Vergleich zu einer durchschnittlichen Woche.
Das WEF schweigt zu solchen Vorwürfen und überlässt es der Lobbyorganisation der Privatfliegerei, der "European Business Aviation Association (EBAA)", sich mit einer
Antwort
zu blamieren, die Zahlen manipuliert, irrelevante Beispiele zitiert und auf eine
Initiative
verweist, mit der die Privatjet-Nutzer ihre Emissionen "kompensieren" könnten, wenn sie denn wollten. Ob es jemand getan hat, wird nicht mitgeteilt. Dass diese
Argumente unglaubwürdig
und solche "Offsets" generell
völlig unzureichend
sind, wird auch nicht diskutiert.
Der jüngste Skandal bezüglich derartiger Kompensationen wurde allerdings auch erst zum Ende des Gipfels von
der ZEIT,
dem
Guardian
und der investigativen Plattform
SourceMaterial
veröffentlicht. Demnach ergab eine Studie, dass rund 90% der Offsets des grössten Anbieters auf dem globalen Markt, die für Regenwald-Projekte ausgestellt wurden, wirkungslos sind oder die Klimakatastrophe sogar noch verschlimmern. Wenig überraschend sind die Offsets dieses Anbieters auch für das ohnehin
völlig desolate
ICAO-Kompensationssystem CORSIA
anerkannt.
Vom WEF selbst gab es eine Talkrunde zum Thema
Reisen und Tourismus,
und in einigen anderen Runden wurde das Thema 'Luftfahrt' auch angesprochen, aber diese Runden sind im Großen und Ganzen ohnehin nur die Show für die Öffentlichkeit. Was das Publikum davon mitnehmen soll, steht in den anschliessend veröffentlichten
5 Punkten,
"die man wissen sollte", der Liste der neu geschlossenen
Kooperationen,
"die eine fragmentierte Welt wieder zusammenflicken können", und den
5 technologischen Trends,
die in den nächsten Jahren stärker subventioniert werden sollen, darunter Gentechnik, Kernfusion und Künstliche Intelligenz.
Wer bisher noch Zweifel hatte, was von der Welt in Davos gerettet werden soll, ist nach der Lektüre insbesondere des letzten Papiers klüger. Es geht um die Sicherung der Profite grosser Konzerne und Finanzinvestoren durch die globale Durchsetzung monopolisierter und monopolisierender Technologien.
Die wichtigstens Bestandsaufnahmen wurden bereits vorher geliefert, darunter insbesondere der
Global Risks Report 2023
und eine
Zusammenfassung,
in denen die Top Ten der Krisen der nächsten zwei bzw. zehn Jahre und ihre Abhängigkeit untereinander beschrieben werden. Diesen Bericht kann man auf zweierlei Art lesen. Für normale Menschen liefert er ein Bild einer Weltgesellschaft und eines Planeten am Abgrund, ohne eine reale Perspektive für eine grundlegende Wende.
Für Investoren
ist er eine Auflistung möglicher neuer Märkte und der Risiken, die jeweils drohen, sowie der politischen Rahmenbedingungen, für die lobbyiert werden muss, um Profite abzusichern.
An Materialien zum Luftverkehr gibt es vom WEF nur noch eine blumige
Zusammenfassung
all der schönen Initiativen, mit denen der Luftverkehr irgendwann in ferner Zukunft mal 'klimaneutral' werden will - falls bis dahin noch eine relevante Zahl an Menschen fliegen kann und will. In den Referenzlisten findet man durchaus auch kritischere Materialien, aber nichts, was nicht schon anderswo publiziert worden wäre.
Klimaaktivisten haben schon vor Beginn des Spektakels vor weiteren Ablenkungen und Greenwashing gewarnt. Auf dem Forum selbst haben vier prominente Vertreterinnen ein von fast einer Million Menschen unterschriebenes Abmahnschreiben "an die CEOs der fossilen Energieunternehmen" übergeben. Was im sozialen Bereich notwendig wäre, um die vielfältigen Krisen in der Welt angehen zu können, was aber in Davos natürlich niemand hören wollte, hat ein neuer Bericht von Oxfam zur Bekämpfung der Ungleichheit in der Welt durch gerechte Besteuerung zusammengestellt.
Ein
echter Luftfahrtgipfel
ist dagegen die von der Zeitschrift
Airline Economics ebenfalls jährlich organisierte
"Finanz- und Leasing-Konferenz" der Luftfahrt-Industrie, dieses Jahr in
Dublin
vom 15.-18. Januar. Dort trafen sich neben Airlines und Flugzeugbauern auch der Öffentlichkeit weniger bekannte Firmen, die teils
grosse Flugzeug-Flotten
besitzen und deren Kerngeschäft das
Leasing
ist, sowie Finanzinstitutionen, die den ganzen Betrieb finanzieren.
In deutschen Medien war fast nichts über diese Konferenz zu lesen, lediglich ein möglicher
Flugzeugmangel
wegen der reduzierten Produktionskapazitäten der grossen Hersteller war der Börsenzeitung eine Meldung wert. Die Hersteller
wehrten sich
natürlich gegen die Kritik, auch wenn sowohl
Boeing
als auch
Airbus
immer wieder neue Verzögerungen einräumen müssen und die Frage von
Strafzahlungen
für verspätete Lieferungen in Dublin ebenfalls Thema war.
Ein weiteres Problem, das dort diskutiert wurde, ohne Lösungen dafür zu finden, war die Frage, wer denn die immensen Summen für das angestrebte schnelle Hochfahren der Produktion der famosen
grünen Treibstoffe,
mit denen die Luftfahrt "klimaneutral" werden möchte, aufbringen soll. Nach dort geäusserten Schätzungen geht es um rund
"1,5 Billionen Dollar über 30 Jahre",
und die Luftfahrtindustrie befürchtet (hoffentlich zu recht), dass solche Summen nicht allein über staatliche Subventionen hereinzuholen sind.
Für die Financiers des Luftverkehrs gabs in Dublin
wenig Raum für Trübsinn,
auch wenn wegen Krieg und Sanktionen im russischen Markt
etliche Milliarden abgeschrieben
werden mussten.
"Ihr Geschäftsmodell zwingt sie auf riskante Märkte, ... dort machen sie das meiste Geld",
stellen Analysten trocken fest, und ausserdem gibt es ja Versicherungen.
Ansonsten sind die Aussichten aber hervorragend, wie ein zusammenfassender
Bericht
über diese Tagung beschreibt. Airlines machen wieder Profit, der Finanzierungsmarkt entwickelt sich, Engpässe in der Produktion neuer Flugzeuge erhöhen den Wert der vorhandenen Flotten, und auch der Frachtmarkt verspricht weiter Profit. Das Klima-Gedöns macht weiterhin Ärger, aber wenn, wie KPMG prognostiziert, die sog. "nachhaltigen Treibstoffe (SAF)" nur 1/3 statt, wie geplant, der Hälfte des Gesamtbedarfs decken können und weiterhin zu 60% fossiles Kerosin getankt wird, dann heisst das ja auch, dass erstens die alten fossilen Infrastrukturen noch lange weiter Profit abwerfen und zweitens Investitionen in SAF relativ risikolos sind, weil durch Knappheit hohe Preise winken. Für Investoren sind das gute Nachrichten, und das Klima kann man doch bitte woanders retten. Airbus z.B.
investiert
ja schon in Projekte zur technischen Entnahme und Speicherung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre.
Dass die Industrie aktuell nicht befürchten muss, dass staatliche Stellen ihnen allzuviel hineinreden, zeigt das
harmlose Geplänkel zwischen dem Chef des Airline-Dachverbandes IATA und dem obersten EU-Bürokraten für den Luftfahrtsektor, das schon als "Streit" verkauft wurde. Ernsthafte Differenzen wurden dort nicht sichtbar.
Welches Fazit lässt sich aus all dem ziehen? Offenkundig gibt es von diesen Gipfeln keinen klaren Blick auf die Probleme dieser Welt. Vielmehr scheinen die dort tagenden Eliten in ihren jeweiligen Blasen derart gefangen zu sein, dass ihnen "Weiter so!" mit kleinen Korrekturen hier und da und einigen neuen Technologien als gangbarer Weg aus den zahlreichen nicht zu übersehenden Krisen erscheint. Von Davos geht jedenfalls weder ein Great Reset noch irgend eine andere relevante Kurskorrektur aus, die einen entscheidenden Beitrag zur Krisenlösung leisten könnte.
Für die Luftfahrtindustrie ist das Bild vom Elfenbeinturm, in dem sie abgehoben und unangreifbar sitzt, vielleicht garnicht schlecht, auch wenn die Direktorin der NGO Transport & Environment, die es in ihrem
Jahresrückblick 2022
benutzt, die kleinen Fortschritte, die es gegeben haben mag, in allzu rosigem Licht beschreibt. Dass einige Airlines die dreckigsten 'Bio-Treibstoffe' nicht als nachhaltig anerkennen wollen, ist zwar begrüssenswert, ändert aber nichts daran, dass die Luftfahrtindustrie insgesamt bisher keinerlei gangbaren Weg zu einem halbwegs klimaverträglichen Luftverkehr beschreiben kann, geschweige denn einen solchen Weg gehen wollte.
Sie wollen zurück auf
ihren alten Wachstumspfad,
und wenn es dabei wegen der
Einsparexzesse
während der Pandemie noch an vielen Stellen
hängt und klemmt,
stört das nicht weiter, solange nicht zu viele Kund*innen abspringen.
Zusammenfassend könnte man also sagen: diese Gipfel tragen nichts zur Lösung der dringendsten Probleme der Welt bei, sie stehen eher als Hindernisse im Weg. Die Lösungen liegen unten längst auf dem Tisch. Sie beinhalten einiges, was diese Gipfelhelden auf keinen Fall wollen: u.a.
Einschränkungen ihrer Freiheit,
Profit zu machen und damit den Planeten zu ruinieren, indem
Kurzstreckenflüge
und
Privatjets
verboten werden. Ausserdem muss ein grosser Teil ihrer Vermögen
dazu eingesetzt werden,
die notwendigen Umbauten von Wirtschaft und Gesellschaft zu finanzieren und die Folgen der Klimakatastrophe einzudämmen.
Der Weg dorthin wird nicht in luftigen Höhen, sondern in den ganz profanen Kämpfen am Boden, auf den Strassen und in Parlamenten, bereitet werden müssen.
17.01.2023
Die Abschiedsfeier für Ehrenbürgermeister Thomas Jühe bestand aus zwei Teilen. Die offizielle Trauerfeier mit geladenen Gästen im Bürgersaal des Rathauses kann vollständig auf dem YouTube-Kanal der Stadt Raunheim angesehen werden. Wir haben die Reden von Minister Al-Wazir und der Fluglärmschutzbeauftragten Fr. Barth, die sich teilweise oder ganz mit Thomas Jühes Leistungen im Bereich Fluglärm-Schutz beschäftigen, zum Anhören herauskopiert. Einiges aus dem Inhalt der anderen Reden wird in der Main-Spitze zitiert.
Tonaufzeichnung der Reden, die sich mit dem Thema
'Fluglärm' beschäftigten:
Frau Barth betont am Anfang ihrer Rede, dass Thomas sich gewünscht hat, dass sie dieses Thema im Rahmen der Feier behandelt. Dass ihr dafür eine gute halbe Stunde Redezeit eingeräumt wurde, macht deutlich, dass er sein Wirken in diesem Bereich erinnert und gewürdigt haben wollte, wohl wissend, dass dieses Erbe nur Bestand haben kann, wenn seine Nachfolger*innen in den verschiedensten Funktionen, die er innehatte, die Aufgaben entsprechend weiterführen.
Der Überblick, den Frau Barth gibt, ist zwar in einigen Details nicht ganz präzise, macht aber insgesamt recht gut deutlich, wie Thomas an die vielfältigen Probleme, die sich mit dem Flughafenausbau gestellt haben, herangegangen ist und in welcher Weise er Lösungen zu finden versucht hat.
Im zweiten Teil auf dem Rathausplatz gab es Beiträge der im Stadtparlament vertretenen Parteien und anderer Institutionen und Vereine, die in irgend einer Weise mit Thomas Jühes Wirken in Raunheim verbunden waren.
Hier hatte auch die BI Gelegenheit, etwas dazu zu sagen, wie sein Erbe in diesem Bereich zu werten ist und welche Aufgaben für die Zukunft bestehen. Die Bedingungen für eine Aufzeichnung waren wegen des starken Winds etwas schwierig, aber trotzdem kann der Beitrag nebenstehend angehört werden.
Alles, was dazu zu sagen wäre, in fünf Minuten hineinzupacken, war natürlich unmöglich, und trotz zwei Minuten überziehen blieb vieles ungesagt. Ausführlicher haben wir dazu aber ja bereits im
Nachruf vom 15.12.2022 Stellung genommen. Und um Herrn Al-Wazir zu erklären, dass ein Nachtflugverbot nicht fünf, sondern acht Stunden Nachtruhe schützen muss und eine echte Lärmobergrenze tatsächlich auch eine verbindliche Grenze für die Lärmbelastung setzen müsste, war das nicht der richtige Anlass. Er war zu dieser Zeit ohnehin nicht mehr da.
Was Thomas Jühe sich noch alles vorgenommen hatte, hat er zumindest zum Teil in seinem wohl letzten öffentlichen
Interview
im 'Frankfurt Talk' von Radio Frankfurt beschrieben. Sein Nachfolger als Bürgermeister wird durch die
Wahl am 05.März
bzw. die Stichwahl am 19.März entschieden, da es nicht wahrscheinlich ist, dass einer der
sechs Kandidaten
im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht.
Die Fluglärmkommission wird die Nachfolge im Vorsitz möglicherweise schon in der Sitzung am 22. Februar regeln, aber sicher scheint das noch nicht zu sein. Wann die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen den Vorsitz neu besetzt, ist nicht bekannt. Und bis klar ist, wer sich in Raunheim künftig um Fluglärm-Fragen kümmern wird, wird wohl auch noch einige Zeit vergehen.
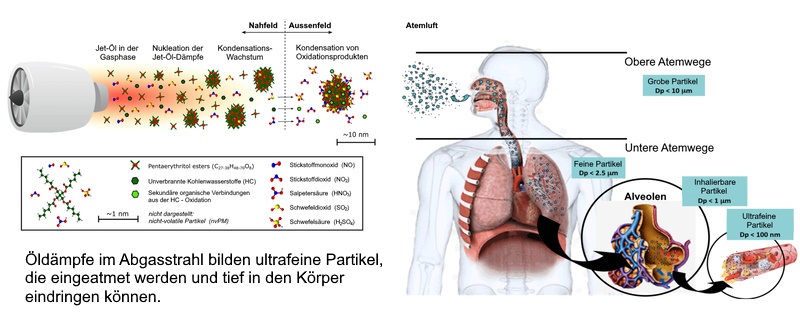
Und falls sie damit ausreichende Mengen besonders toxischer Substanzen transportieren, wären sie auch besonders gefährlich.
(Für eine grössere Darstellung mit Bildquellennachweis
hier
klicken.)
15.01.2023
Gleich zu Beginn des Jahres liefert das Institut für Atmosphäre und Umwelt eine interessante Neuigkeit:
"Schmieröle von Flugzeugen sind wichtige Quelle für Ultrafeinstaub"lautet die Überschrift der Pressemitteilungen der Uni Frankfurt und des an den Messungen beteiligten Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie HLNUG. Darin heisst es:
In der
Veröffentlichung
selbst wird genauer erläutert, dass in den an der
HLNUG-Meßstation Frankfurt-Schwanheim
genommenen Proben die UFP aus Turbinen-Ölen in der kleinsten Partikel-Fraktion (10-18 nm) über 20%, in den beiden grösseren Fraktionen (18-32 und 32-56 nm) 5 bzw 9% ausmachten.
Aus nachfolgend durchgeführten Laborexperimenten und theoretischen Überlegungen schliessen die Autor*innen, dass diese Anteile eher eine Untergrenze darstellen und dass
"Jet-Öl-Dämpfe in abkühlenden Abgasfahnen Übersättigung erreichen und zu schneller Nukleation und der Entstehung von UFPs im Bereich ~10-20 nm führen" (eigene Übersetzung).
In der medialen Wiedergabe dieser Meldung, z.B. in der
Hessenschau
oder der
Frankfurter Rundschau,
gehen die Feinheiten bezüglich der Grössenverteilungen weitgehend verloren, und es entsteht leicht der Eindruck, als seien diese Öle eine Hauptquelle für die Ultrafeinstaub-Belastung insgesamt. Tatsächlich gibt es aber für die Entstehung ultrafeiner Partikel aus Verbrennungsprozessen, wie eine aktuelle
Übersicht,
im Detail beschreibt, eine Anzahl von Prozessen, und die mengenmäßig bedeutendsten in den Grössenklassen bis 100 Nanometer sind auch für Flugzeugtriebwerke die Bildung feiner Rußteilchen bei der Kerosinverbrennung und die Nukleation ('Kernbildung') und Kondensation aus Verbrennungsprodukten wie Stickstoff- und Schwefel-Verbindungen.
Aber natürlich ist es vollkommen richtig, wenn in den Pressemitteilungen darauf hingewiesen wird, dass
"eine Reduzierung der Schmierölemissionen ... ein wichtiges Potenzial zur Minderung der ultrafeinen Partikel" birgt, dass bisher noch nicht in Betracht gezogen wurde. Die Veröffentlichung empfiehlt dazu,
"die Luft/Öl-Separatoren sollten im Hinblick auf verbesserte Öl-Rückgewinnung optimiert werden. Zusätzlich könnten die Entwicklung fortgeschrittener Unterhalts-Routinen und die Reduzierung der Triebwerkslaufzeiten am Boden ... die Ölemissionen weiter reduzieren" (eigene Übersetzung).
Eine solche Reduzierung könnte sogar besonders dringend sein, denn der anschließend in der Veröffentlichung diskutierte Aspekt taucht in den Pressemitteilungen interessanter Weise nicht auf. Wir zitieren (wiederum in eigener Übersetzung und mit von uns ergänzten Hervorhebungen und Links):
"Weiterhin sollte eine Evaluation der toxikologischen Eigenschaften der Jet-Öl-UFPs durchgeführt werden, um ihre Gesundheitseffekte zu erfassen, auch unter Betrachtung schädlicher und potentiell neurotoxischer Substanzen, die entweder direkt emittiert werden (z.B.
Organophosphate
als Schmieröl-Additive) oder die durch thermische Transformation der verwendeten Trimethylolpropan-Ester gebildet werden (z.B.
Trimethylolpropanphosphat)".
Über die Entdeckung derartiger Substanzen war bereits in der
ersten Veröffentlichung
zu diesen Untersuchungen vor nunmehr fast zwei Jahren (März 2021) berichtet worden, allerdings ohne quantitative Aussagen über die Häufigkeit von deren Vorkommen zu machen. Auch die jetzt vorgelegten Ergebnisse reichen längst nicht aus, um die mögliche Belastung von Flughafenanrainern durch diese Substanzen abzuschätzen, liefern aber einen weiteren deutlichen Hinweis, dass hier ein Problem liegen könnte.
Wenn es dann in den Pressemitteilungen heisst:
"Die Belastung durch ultrafeine Partikel und deren gesundheitliche Auswirkung wird ab 2023 im Rahmen einer umfangreichen wissenschaftlichen Studie des Landes Hessen untersucht werden. Hierbei können die Ergebnisse der aktuellen Studie helfen, flughafenspezifische Partikel zu identifizieren und mögliche Minderungsmaßnahmen abzuleiten",
könnte man natürlich hoffen, dass die oben zitierten Anregungen da aufgegriffen werden. Andererseits lässt die Betonung von "identifizieren und ... Minderungsmaßnahmen ableiten" befürchten, dass es im FFR-Projekt bei der bereits
früher kritisierten Ausklammerung der besonderen toxikologischen Aspekte der Triebwerks-UFP bleiben wird.
Genau wissen kann man es nicht, denn die Informationen zum aktuellen Stand auf der
Projekt-Webseite
sind inzwischen auch schon fast ein Jahr alt, und von der versprochenen Transparenz bezüglich der Studieninhalte kann bisher keine Rede sein. Da aber die erste Studie bei der Ausschreibung der Belastungsstudie des Projekts schon ein Jahr bekannt war, aber nicht berücksichtigt wurde, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das noch geändert hat. Deshalb ist zu befürchten, dass die Frage der Toxizität ultrafeiner Partikel aus den Schmieröl-Emissionen in diesem Projekt nicht geklärt werden wird.
Mehr Hoffnungen gibt es diesbezüglich aufgrund der fortgesetzten Anstrengungen, die Hintergründe des sog.
Aerotoxischen Syndroms,
besser bekannt unter dem Begriff
Fume Events,
aufzuklären. Diese Ereignisse werden weitgehend auf durch die Triebwerke angesaugte und durch Triebwerksöle kontaminierte Kabinenluft zurückgeführt. Die für Flugsicherheit in der EU zuständige European Union Aviation Safety Agency EASA hat dazu bereits 2017
Studien
erstellen lassen, die allerdings keine eindeutige Ursache identifizieren konnten. Im zugehörigen
Abschlussbericht
wird ausgeführt, dass in Ölkomponenten und deren Pyrolyse-Produkten zwar neurotoxische Substanzen gefunden wurden, aber nicht in relevanten Konzentrationen. Partikel wurden dort nur summarisch als Anzahl der Grösse 1-1.000 nm erfasst und chemisch nicht charakterisiert.
Im
Abschlussbericht
eines weiteren Projekts und in einem
Beitrag
zum
EASA Workshop Future Cabin Air Quality Research 2020
wurde zumindest auf die mögliche Rolle ultrafeiner Partikel bei der Entstehung der bisher ungeklärten medizinischen Symptomatiken hingewiesen. Aktuell findet gerade der
EASA Cabin Air Quality Research Workshop 2023
statt. Ob das Thema dort schon ausführlicher behandelt wird, ist (uns) noch nicht bekannt, wird sich aber in Kürze klären. Man kann vermutlich davon ausgehen, dass dort ein grösseres Interesse besteht, diese Fragen zu klären, weil alle Störfälle im Flugbetrieb und daraus resultierende negative Schlagzeilen unerwünscht sind.
Aber auch wenn die Luftverkehrswirtschaft ein starkes Interesse haben sollte, störende Vorfälle an Bord von Flugzeugen zu vermeiden und dafür auch die Rolle ultrafeiner Partikel in der Kabinenluft genauer zu untersuchen, heisst das noch lange nicht, dass entsprechende Ergebnisse auch zu Konsequenzen in der Beurteilung der Belastung der Bevölkerung im Umfeld von Flughäfen führen werden.
Deren Belastung ist, im Unterschied zu der der Passagiere oder gar der Crew, für einen profitablen Flugbetrieb nicht relevant, deshalb wird in diesem Bereich bestenfalls dann etwas passieren, wenn die Betroffenen die Probleme selbst publik machen und nachdrücklich Lösungen einfordern.
11.01.2023
... auf den alten, zerstörerischen Wachstumspfad. "Wir" meint in diesem Fall einerseits die Luftverkehrsindustrie, die insbesondere ihre Profite wieder wachsen sieht, und andererseits all diejenigen, die unter der wieder wachsenden Zahl der Flugbewegungen und deren negativen Folgen, insbesondere zunehmendem Lärm, steigender Schadstoffbelastung und ungebremst wachsenden Treibhausgas-Emissionen, zu leiden haben.
In den Medien wird das als
Erholung
beschrieben, die aber noch nicht vollständig sei, weil noch nicht alle Sektoren wieder das Niveau von 2019, dem Jahr vor dem
Corona-Einbruch,
erreicht haben. Dabei wird verdrängt, dass dieses Jahr nur der vorläufige Höhepunkt einer
chaotischen Wachstumsphase
war, die den Luftverkehr in Deutschland und Europa in mehrfacher Hinsicht an seine Grenzen gebracht hat.
Nach dem radikalen
Abbau von Personal
und teilweise auch von Material ist das gesamte System natürlich
noch störanfälliger
geworden, so dass selbst eingefleischte Luftfahrtfans
anfangen zu nörgeln.
Airlines und Flughäfen haben aber in den beiden letzten Reisewellen gesehen, dass höhere Preise und miserabler Service nur wenig abschreckende Wirkung haben, und planen unverdrossen für weiteres Wachstum.
In Zahlen zeigt das eine Zusammenstellung der Sitzplatz-Angebote von "Airlines und Flughäfen für die kommenden sechs Monate ... von, nach und in Deutschland", die der 'Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL)' künftig monatlich erstellen will. Diese Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu geniessen. Sie besagen im Grunde nur, worauf die Airlines sich vorbereiten, aber nicht wieviele Menschen tatsächlich fliegen werden und wieviele Flugbewegungen es dadurch geben wird (2022 wurden fast 7% der geplanten Flüge nicht durchgeführt). Auch werden aktuelle Entwicklungen darin erst verzögert sichtbar. So weist der BDL darauf hin, dass ein "voraussichtlicher Anstieg der China-Verkehre ... in den aktuellen Daten noch nicht sichtbar" ist, die Zahlen für den Interkontinental-Verkehr also wahrscheinlich deutlich zu niedrig sind.
Dennoch geben die Zahlen einen Eindruck davon, was uns erwartet. Demnach erreicht die Gesamt-Passagierzahl 78% des Wertes des gleichen Zeitraums vor der Corona-Pandemie. Der innerdeutsche Verkehr liegt bei nur 56%, wobei dies hauptsächlich auf den Einbruch bei den schon vorher
kriselnden Regionalflughäfen
zurückzuführen ist, deren innerdeutsche Verkehre nur noch ein Drittel des Vorkrisen-Niveaus erreichen. Alles, was die Hubs Frankfurt und München innerdeutsch einbezieht, liegt schon wieder bei 67%.
Die nächste Kategorie, "Kurz- und Mittelstrecke", ist etwas mißverständlich benannt, denn sie wird nicht nach Entfernung, sondern nach Staatengruppen abgegrenzt. Dazu gehören alle europäischen Staaten, ganz Russland und alle Mittelmeer-Anrainer. Hier werden 80% des Vorkrisen-Niveaus erreicht, wobei 'Schweiz/Österreich' und 'Ost- / Südosteuropa' (dazu gehören Russland und die Ukraine, deren Luftraum ganz oder teilweise gesperrt ist) mit 71% den niedrigsten Wert erreichen. Die Urlaubsregionen rund ums Mittelmeer erreichen 87-92%. Für die Tendenz in dieser Region stellt der BDL besorgt fest:
"Wachstum und Erholung des Europa-Verkehrs zeigen Sättigungstendenzen".
Den besten Wert zeigt die "Langstrecke" mit 84%, das ist auch exakt der Wert, den das wichtigste internationale Drehkreuz Frankfurt erreicht. Nach unten gedrückt wird dieser Wert vom Asienverkehr, wo nur 70% erreicht werden. Falls aber die deutlichen Erleichterungen des Verkehrs von und nach China durch die
Aufhebung der Reisebeschränkungen
aufgrund der dortigen 'Null-Covid-Politik' Bestand haben, sind hier wohl deutliche Entwicklungen nach oben zu erwarten.
Eine etwas andere Datenbasis für den Ausblick auf die kommenden Monate nutzt
EUROCONTROL,
der europäische
Network Manager.
In deren
Analysis Paper: 2022 werden nicht nur umfangreiche Daten über den Luftverkehr in Europa im Jahr 2022 aufbereitet, sondern auch drei Szenarien gezeigt, die die Entwicklung der Flüge in, von und nach Europa in den kommenden 8 Monaten bzw. 7 Jahren auf der Basis unterschiedlicher Annahmen über die ökonomische Entwicklung darstellen.
Diese Szenarien gehen davon aus, dass im August dieses Jahres bereits wieder 95-105% der Zahl der Flüge 2019 erreicht werden ("wahrscheinlichstes" bis "optimistisches" Szenario). Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Wert von 92-101% erwartet, nach 87% in 2022. Angesichts der Tatsache, dass die 8-Monats-Szenarien der letzten Zeit trotz einiger unvorhergesehener Krisen (sprich Krieg und "Zeitenwende") die Entwicklung relativ gut vorhergesagt haben, muss man wohl davon ausgehen, dass auch diese Zahlen nicht nur Wunschträume sind.
Allerdings geht aus der Analyse des Verkehrs 2022 auch hervor, dass das Chaos zu Spitzenzeiten noch
deutlich grösser
war als 2019, und auch für 2023 werden
"Luftraum-Probleme wegen des Ukraine-Kriegs, zusätzliche Flugzeuge im System, mögliche Streikaktionen, Systemveränderungen und die fortschreitende Wiederöffnung der asiatischen Märkte"
(EUROCONTROL, eigene Übersetzung)
als schwierige "Herausforderungen" für alle Beteiligten gesehen. Speziell der Frankfurter Flughafen hatte wegen selbstgemachten Personalproblemen eine miserable Pünktlichkeits-Bilanz (70,5% der Anflüge, aber nur 55,7% der Abflüge pünktlich, Platz 19 unter den 20 grössten europäischen Flughäfen).
Auch die
DFS beklagt
für Deutschland eine
"schleppende Erholung";
im Vergleich zu 2019 wurden nur 79% der Zahl der Flugbewegungen registriert. Auch nach den EUROCONTROL-Daten führt Deutschland mit 25% Verlust, bleibt aber nach Grossbritannien das europäische Land mit der zweithöchsten Zahl an Flugbewegungen.
Interessant an der EUROCONTROL-Analyse ist auch, dass
"Billigflieger die grosse Erholungs-Erfolgs-Story in 2022"
waren (Ryanair erreichte 109% der 2019er Zahlen) und inzwischen nahezu den gleichen Marktanteil haben wie die 'Netzwerk-Carrier' (jeweils 1/3). Auch bleibt
"der Geschäftsflugverkehr mit 116% weiterhin über dem 2019er Niveau".
Mit anderen Worten: die "Erholung" wird vom
Urlaubs-
und
Luxus-Verkehr dominiert.
Auch der Frachtflugverkehr lag, wie in den beiden vorhergehenden Jahren, 2022 noch über 2019er Niveau, nimmt aber allein schon deshalb wieder ab, weil mit ansteigendem Passagier-Flugverkehr wieder mehr Fracht als Zuladung in Passagiermaschinen befördert wird.
Zu den längerfristigen Perspektiven gehört auch, dass es eine
boomende Nachfrage nach neuen Flugzeugen
gibt, die die Hersteller
"angesichts angespannter Lieferketten ... nicht wie geplant bedienen"
können. Deshalb und wegen generell fehlender Kapazitäten hat Airbus 2022 sowohl das
Jahresziel bei Auslieferungen
als auch den
"Rekord ... aus dem Jahr 2019"
verfehlt, aber der Konzernchef hält
"an seinen Plänen für eine Rekordproduktion in den kommenden Jahren"
fest. Boeing sieht das ähnlich.
Was bedeutet das nun alles für die Belastungen, die wir zu erwarten haben? Es sind nicht wirklich die Prozentzahlen im Vergleich zu 2019, die relevant sind. Betrachtet man die Lärmbelastungen der Jahre vor 2019, so zeigt sich, dass sie zwar mit steigender Zahl der Flugbewegungen zunehmen, aber im Detail noch von vielen anderen Faktoren abhängig sind. Dazu gehören speziell für Raunheim die
Betriebsrichtungsverteilung,
aber auch die Zahl der
speziellen Wetterlagen
oder sonstiger Ereignisse, die den 'normalen' Ablauf stören und zu chaotischen Notlösungen führen.
Aus den Zahlen und Beschreibungen ist offenkundig, dass uns wieder eine solche Phase chaotischen Wachstums bevorsteht, die zu vermehrten Störungen der Nachtruhe führen und dadurch besonders belastend sein wird. Da hilft es garnichts, wenn vielleicht tagsüber vorübergehend noch ein paar Prozent weniger Flugbewegungen stattfinden.
Nimmt man dazu, dass nach der EUROCONTROL-Analyse aufgrund der chaotischen Luftraum-Verhältnisse auch noch bis zu 10% Treibstoff zusätzlich verbrannt werden ('excess fuel burn XFB') und entsprechend auch der Ausstoss an Schadstoffen und Treibhausgasen höher ist, wird klar, dass sich durch die Pandemie
nichts wirklich verändert
hat. Wir sind zurück in einem System, das zur Profitmaximierung die Befriedigung von Luxusbedürfnissen anheizt und sein
zerstörerisches Wachstum
immer weiter fortsetzen will. Ob und wann es dabei wieder vorübergehend oder dauerhaft am eigenen Unvermögen scheitert, ist unmöglich vorherzusagen.
Die politische Unterstützung für den Chaoskurs
ist ungebrochen, und Widerstand dagegen wird stärker diskriminiert als je zuvor. Die Aussichten für das neue Jahr sind nicht wirklich gut, aber wenn es nicht noch schlimmer werden soll, darf man sich dadurch nicht entmutigen lassen. Zumindest sollte man bei allen anstehenden Wahlen in diesem Jahr die jeweiligen Kandidat:innen fragen, wie sie zu diesen Problemen stehen und welche Lösungen sie anzubieten haben. Es kann aber auch nicht schaden, bei allen sich bietenden Gelegenheiten auch nachdrücklicher deutlich zu machen,
was nötig ist.
Ältere Nachrichten befinden sich im Archiv.